Ortsgemeinde Reckershausen Baugebiet
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Wernerkapelle in Womrath
Jahrgang 51 DONNERSTAG, 07. Januar 2021 Nummer 1 Wernerkapelle in Womrath Mitteilungen für den Bereich der Verbandsgemeinde Kirchberg/Hunsrück und ihre Gemeinden Bärenbach, Belg, Büchenbeuren, Dickenschied, Dill, Dillendorf, Gehlweiler, Gemünden, Hahn, Hecken, Heinzenbach, Henau, Hirschfeld, Kappel, Kirchberg, Kludenbach, Laufersweiler, Lautzenhausen, Lindenschied, Maitzborn, Metzenhausen, Nieder Kostenz, Niedersohren, Niederweiler, Ober Kostenz, Raversbeuren, Reckershausen, Rödelhausen, Rödern, Rohrbach, Schlierschied, Schwarzen, Sohren, Sohrschied, Todenroth, Unzenberg, Wahlenau, Womrath, Woppenroth, Würrich. Sprechzeiten der Verwaltung: montags, dienstags, mittwochs und freitags 8.30 – 12.00 Uhr, donnerstags (durchgehend) 8.00 – 18.00 Uhr; Einwohnermeldeamt jeden 1. Samstag im Monat 9.00-12.00 Uhr; Telefon 0 67 63 / 910-0, Fax 0 67 63 / 910 699, www.kirchberg-hunsrueck.de, [email protected] @vgkirchberg Kirchberg/Hunsrück 2 Nr. 1/2021 Notrufe / Bereitschaftsdienste ■ Polizei, Verkehrsunfall, Überfall Betreuter Erinnerungstreffpunkt für Senioren und Seniorinnen im Erreichbarkeiten der Polizei Simmern Gesundheitszentrum Büchenbeuren. In dringenden Fällen: Notruf ............................................................... 110 Informationen Heike Wilhelm, Pflegedienstleitung In allen anderen Fällen: Tel........................................................................................ 06763-30110 Festnetz Schutz- und Kriminalpolizei ............................ 06761 / 921-0 E-mail [email protected] -

Kehrbezirke-Übersicht Stand 02 2021.Xlsx
Liste der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger (Stand Februar 2021) Gemeinde Vorname Name PLZ Wohnort Straße Telefon Fax E-Mail Kehrbezirk Alterkülz Jens Untermair 56154 Boppard ST Buchholz Casinostraße 15 06742 82361 06742 896549 [email protected] Rhein-Hunsrück-Kreis III Altlay Andreas Rosenbach 55469 Simmern Schönburgstr. 7 06761 2929 06761 908990 [email protected] Rhein-Hunsrück-Kreis VII Altweidelbach Bernd Rosenbach 55471 Kümbdchen In der Au 6 06761 6985 06761 961139 [email protected] Rhein-Hunsrück-Kreis IV Argenthal Frank Rühl 55469 Niederkumbd Auf der Poßwies 11 06761 9128157 06761 9128158 buero.schornsteinfeger-frankruehl.de Rhein-Hunsrück-Kreis IX Badenhard Oliver Kammermayer 55494 Rheinböllen Simmerner Straße 15 06764 7491342 06764 74922219 [email protected] Rhein-Hunsrück-Kreis II Bärenbach Andreas Rosenbach 55469 Simmern Schönburgstr. 7 06761 2929 06761 908990 [email protected] Rhein-Hunsrück-Kreis VII Belg Andreas Rosenbach 55469 Simmern Schönburgstr. 7 06761 2929 06761 908990 [email protected] Rhein-Hunsrück-Kreis VII Belgweiler Jens Untermair 56154 Boppard ST Buchholz Casinostraße 15 06742 82361 06742 896549 [email protected] Rhein-Hunsrück-Kreis III Bell Stefan Rosenbach 55469 Simmern Am Stadtgarten 9 06761 7830 06761 9672611 stefan-rosenbach@t-online Rhein-Hunsrück-Kreis I Bell OT Hundheim Stefan Rosenbach 55469 Simmern Am Stadtgarten 9 06761 7830 06761 9672611 stefan-rosenbach@t-online Rhein-Hunsrück-Kreis I Bell OT Krastel Stefan Rosenbach 55469 Simmern Am Stadtgarten -
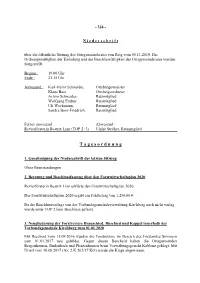
T a G E S O R D N U N G
- 324 - N i e d e r s c h r i f t über die öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates von Belg vom 05.11.2019. Die Ordnungsmäßigkeit der Einladung und die Beschlussfähigkeit des Ortsgemeinderates wurden festgestellt. Beginn : 19.00 Uhr Ende : 21.15 Uhr Anwesend : Karl-Heinz Schneider, Ortsbürgermeister Klaus Bast, Ortsbeigeordneter Achim Schneider, Ratsmitglied Wolfgang Endres, Ratsmitglied Uli Weckmann, Ratsmitglied Sandra Boor-Friedrich, Ratsmitglied Ferner anwesend : Abwesend : Revierförsterin Beatrix Linn (TOP 2+3) Ulrike Ströher, Ratsmitglied T a g e s o r d n u n g 1. Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung Ohne Beanstandungen 2. Beratung und Beschlussfassung über den Forstwirtschaftsplan 2020 Revierförsterin Beatrix Linn erklärte den Forstwirtschaftsplan 2020. Der Forstwirtschaftsplan 2020 ergibt ein Fehlbetrag von 1.250,00 €. Da die Beschlussvorlage von der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchberg noch nicht vorlag wurde unter TOP 2 kein Beschluss gefasst. 3. Neugliederung der Forstreviere Brauschied, Buschied und Kappel innerhalb der Verbandsgemeinde Kirchberg zum 01.01.2020 Mit Bescheid vom 15.09.2016 wurden die Forstreviere im Bereich des Forstamtes Simmern zum 01.01.2017 neu gebildet. Gegen diesen Bescheid haben die Ortsgemeinden Bergenhausen, Budenbach und Pleizenhausen beim Verwaltungsgericht Koblenz geklagt. Mit Urteil vom 30.08.2017 (Az: 2 K 262/17.KO) wurde die Klage abgewiesen. - 325 - Auch die Berufung beim OVG Koblenz (Az: 8 A 10826/18) wurde abgewiesen. Eine Revision wurde nicht zugelassen, so dass die Revierneugliederung, die mit Bescheid vom 15.09.2016 zum 01.01.2017 festgesetzt wurde, rechtskräftig ist. Zwischenzeitlich haben die drei zuvor genannten Ortsgemeinden nach § 9 Landeswaldgesetz (LWaldG) ein Revierabgrenzungsverfahren eingeleitet und mit Zustimmung aller Waldbesitzenden des gleichen Forstrevieres die Abgrenzung eines eigenen Forstrevieres mit Schreiben vom 24.03.2019 beantragt. -

Gebäude Und Wohnungen Am 9. Mai 2011, Reckershausen
Gebäude und Wohnungen sowie Wohnverhältnisse der Haushalte Gemeinde Reckershausen am 9. Mai 2011 Ergebnisse des Zensus 2011 Zensus 9. Mai 2011 Reckershausen (Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis) Regionalschlüssel: 071405004122 Seite 2 von 32 Zensus 9. Mai 2011 Reckershausen (Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis) Regionalschlüssel: 071405004122 Inhaltsverzeichnis Einführung ................................................................................................................................................ 4 Rechtliche Grundlagen ............................................................................................................................. 4 Methode ................................................................................................................................................... 4 Systematik von Gebäuden und Wohnungen ............................................................................................. 5 Tabellen 1.1 Gebäude mit Wohnraum und Wohnungen in Gebäuden mit Wohnraum nach Baujahr, Gebäudetyp, Zahl der Wohnungen, Eigentumsform und Heizungsart .............. 6 1.2 Gebäude mit Wohnraum nach Baujahr und Gebäudeart, Gebäudetyp, Zahl der Wohnungen, Eigentumsform und Heizungsart ........................................................... 8 1.3.1 Gebäude mit Wohnraum nach regionaler Einheit und Baujahr, Gebäudeart, Gebäudetyp, Zahl der Wohnungen, Eigentumsform und Heizungsart ..................................... 10 1.3.2 Gebäude mit Wohnraum nach regionaler Einheit und Baujahr, Gebäudeart, Gebäudetyp, -

Kirchberg Gültig Ab 01.08.19
FAHRPLANHEFT Verbandsgemeinde Kirchberg Gültig ab 01.08.19 Neue Linien, neue Ziele. 2019 kostenfrei, INFO-HOTLINE 0800 5 986 986 täglich von 8 bis 20 Uhr 6 MoritzheimM MerlMeMerrll HaserichHHaaseserriicchh 7222 71971919 6536 BudenbachB 657•7199 727 791 657 657 Leideneckk Alterkülzül 719 Völkenroth 652 Zell (Mosel) Kloster- Bergen- Tellig 719 657 Panzweiler 653 kumbd hausen 648 Pleizen- 641 Schauren Wal- 750 657 659 651 620 722 hausen Wüschheim Neuerkirch hausen 642•652 642•65252 653•659 653 3 Althaus Löffel- 666 Nieder- 642 607•642 Rayer- Benz-Ben Michelbach 653 schied wweiler Peterswald scheid 658 kumbd 640 653•657 659 Külz 642•6644 723 653•659 646•6655 761 657 653 Kappel 663 653 607•641•642 Wahlbach Rödel- Reich 658•659 653 655•657 607 620 hausen 655 641 640 Altweidelbach 723 655 657 Keidel- 649 607 607 723 657 Kludenbach 658•659 659 642 761 Altlay Würrich 663 Biebern heim 651 Belg 663 607 655 655 Reckers- Fronhofen Schnorbach 663 659 650 607 649 655 655 653 hausen 658 607 657 655 649 607 662•663655 658 Mutterschied 662 608 663 609 Maier- Hohen- Briedeler Todenroth 653•657 607•609 230•649 655 Nannhausen Simmern 601 620 640 Argenthalg mund stein Heck 655 662 Metzen- Heinzen- 608•609 609•669 660 650 660 230 602 603 609 750 663 hausen bach Unzenberg 609•658Ohlweiler 604 607 609 641 642 Schwarzen 602•604 662 Hahn 661•663 666 Nickweiler 649 651 659 669 645 Ravers- 662 669 beuren 657 602 Riesweiler 608•669 604 604•669 660 750 615 662 Ober Kostenz 655 608 Holzbach 602 (VRM-LINIENNETZPLAN) Hahn (Hunsr) 660 Schönborn Bärenbach 661 Rödern 604 665 Flughafen Nieder Kostenz 663 Opperts- 608 Belgweiler 660 669 608 661 608 hausen 604•606 606 Tiefenbach Lautzenhausen 663 604 608 32321 663•669 669 Kirchberg Maitz- 606 1 352 662 602 665 605 608 born 608 602 661•668 Sargenroth 605 Lötzbeuren 669 664•665 Nieder- Liederbach 605 609 655 665 Büchenbeuren Sohren 667•669 Ravengiers- 321•665 sohren 661 668 608 657 661 Weitere Liniennetzpläne, z.B. -

Verordnung Zur Einstufung Der Gemeinden in Eine Mietniveaustufe Im Sinne Des § 254 Des Bewertungsgesetzes (Mietniveau-Einstufungsverordnung – Mietneinv)
3738 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2021 Teil I Nr. 58, ausgegeben zu Bonn am 26. August 2021 Verordnung zur Einstufung der Gemeinden in eine Mietniveaustufe im Sinne des § 254 des Bewertungsgesetzes (Mietniveau-Einstufungsverordnung – MietNEinV) Vom 18. August 2021 Auf Grund des § 263 Absatz 2 des Bewertungsgesetzes, der durch Artikel 1 Nummer 2 des Gesetzes vom 26. November 2019 (BGBl. I S. 1794) eingefügt worden ist, verordnet das Bundesministerium der Finanzen: § 1 Gemeindebezogene Einordnung Die gemeindebezogene Einordnung in die jeweilige Mietniveaustufe zur Ermittlung der Zu- und Abschläge im Sinne des § 254 des Gesetzes in Ver- bindung mit der Anlage 39, Teil II, zum Gesetz ergibt sich aus der Anlage zu dieser Verordnung. Maßgeblicher Gebietsstand ist der 25. Januar 2021. § 2 Inkrafttreten Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Der Bundesrat hat zugestimmt. Berlin, den 18. August 2021 Der Bundesminister der Finanzen Olaf Scholz Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger-verlag.de Bundesgesetzblatt Jahrgang 2021 Teil I Nr. 58, ausgegeben zu Bonn am 26. August 2021 3739 Anhang zu § 1 Anlage Gemeindebezogene Einordnung in die jeweilige Mietniveaustufe nach § 254 des Bewertungsgesetzes Baden-Württemberg (BW) Baden-Württemberg (BW) lfd. Mietniveau- lfd. Mietniveau- Gemeindenamen AGS Gemeindenamen AGS Nr. stufe Nr. stufe 1 Aach, Stadt 08335001 2 38 Altheim 08425004 2 2 Aalen, Stadt 08136088 3 39 Altheim 08426008 1 3 Abstatt 08125001 2 40 Altheim -

Kirchberg/Hunsrück – St. Michael
Kirchberg/Hunsrück – St. Michael Alphabetische Liste Familiennamen Ortschaften Alphabetische Liste Alphabetische Liste - 19.874 Personen Kirchberg/Hunsrück - St. Michael (kath.) 1675-1900 Autoren: Käthe Wimmer, Michael Frauenberger und Rudolf Schwan A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z A ABELS Heinrich *u1890, Denzen u1920 ASSMANN Catharina ABINCKE Peter *Gascogne 1705 GOFFIN Catharina ABSOVEN Wilhelm vhKirchberg 1707 WEBER Anna Catharina ACHT Catharina *1791 Niedert 1834 REIBEL Georg Wilhelm ACHT Matthias 1659 SCHMIDT Elisabeth Catharina ACHT Philipp *e1761, Raum Niedert FISCHER Helena ACKERMANN Johann Peter *1728 Kirchberg 1752 SPENGLER Susanna Kunigunde Catharina ACKERMANN Maria Elisabeth *1726 Kirchberg <1752 SUPHÜL Philipp ACKERMANN Maria Magdalena *1719 Kirchberg ACKERMANN Maria Magdalena *1723 Kirchberg ACKERMANN Maria Magdalena *1731 Kirchberg ACKERMANN Peter Salomon *u1695, +Kirchberg I. <1719 NN Anna Barbara II. 1722 WEIHNACHT Anna Elisabeth III. 1741 NN Anna Catharina ADAM Anna Catharina *1786 Schönborn 1807 LINK Johann Peter ADAM Anna Elisabeth *e1770, Raum Dickenschied MÜLLER Johann Nikolaus ADAM Anna Elisabeth *e1724, vhHeinzenbach 1754 ZINCK Franz Nikolaus ADAM Caroline *u1849 Lindenschied 1874 WAGNER Johann Peter ADAM Christian *e1730, Lindenschied <1760 NN Anna Maria ADAM Christian *1760 Lindenschied 1783 GRÜNEWALD Anna Gertrud ADAM Elisabeth *e1804 Spesenroth I. 1837 DILLMANN Caspar II. 1849 LUKAS Johann Nikolaus ADAM Elisabeth *u1870, Raum Kirchberg <1894 KITSCH Johann ADAM Johann *e1741, Raum Kirchberg <1771 -

HEIMAT-Freunde, Impressum
Liebe Gäste, liebe HEIMAT-Freunde, Impressum Edgar Reitz sind mit den Filmzyklen »HEIMAT«, Herausgeber: »DIE ZWEITE HEIMAT« und mit »HEIMAT 3« Meilensteine der deutschen und internationalen Filmgeschichte gelungen. Selten hat eine Filmer- zählung die Landschaft, in der sie spielt und ihre Menschen so in die Herzen der Zuschauer ver- ankert wie HEIMAT. Die Charaktere von HEIMAT sind undenkbar ohne ihre Bezüge zur Familie, zu den Dörfern, zu den Landschaften des Hunsrücks. Wir möchten Ihnen mit dieser Broschüre die Hunsrück Touristik GmbH bedeutendsten Drehorte der Filmzyklen im Gebäude 663 · 55483 Hahn-Flughafen Hunsrück und im Rheintal vorstellen. Neben Fon: 06543-507700 · Fax: 06543-507709 der bildreichen Präsentation der hier gedrehten [email protected] Filmszenen ist es uns ein Anliegen, Ihnen die www.hunsruecktouristik.de »wahren« Orte und die Menschen, die hier leben, Texte zum Film: vorzustellen. Es sind Menschen, die im Hunsrück Regine Meldt · Mainz zu Hause sind, die in der Region verwurzelt und unmittelbar mit dem Drehort oder mit der Film- Erläuterungstexte zu Orten und Personen: crew verbunden sind. Jörn Winkhaus und Iris Müller Idealer Ausgangspunkt Ihrer Wege in die HEIMAT Hunsrück Touristik GmbH kann das Hunsrück-Museum in Simmern sein. Die Filmfotos Heimat 1: dortige Dauerausstellung zu Edgar Reitz, seinem Edgar Reitz Filmproduktionsgesellschaft · München Filmschaffen und den Filmzyklen stimmt Sie auf HPM Photographie · Simmern HEIMAT ein. Wir laden Sie ganz herzlich ein, Ihre Reise in die Filmfotos Heimat 3: HEIMAT -

Windkraftanlagen Im Rhein-Hunsrück-Kreis Stand: 05/2021
Windkraftanlagen im Rhein-Hunsrück-Kreis Stand: 05/2021 Nr. Gemeinde windpark Gemarkung Stadt /Verbandsgemeinde Betreiber Planstand Anlagentyp Nennleistung [kW] Nabenhöhe [m] Rotordurchmesser [m] Gesamthöhe [m] Rechtswert Hochwert Höhe ü. NN [m] 1 Alterkülz Alterkülz Alterkülz VG Kastellaun JUWI am Netz Vestas V 90 2000 105,00 90,00 150,00 390945,95 5544405,62 457 2 Alterkülz Alterkülz Alterkülz VG Kastellaun JUWI am Netz Vestas V 90 2000 105,00 90,00 150,00 391348,86 5544324,41 444 3 Alterkülz Alterkülz Alterkülz VG Kastellaun JUWI am Netz Vestas V 90 2000 105,00 90,00 150,00 391398,34 5544707,48 448 4 Alterkülz Alterkülz III Alterkülz VG Kastellaun Windpark GmbH & Co. Wüschheim KG am Netz ENERCON E-82 2000 108,00 82,00 149,00 391136,67 5544072,83 443 5 Altweidelbach Altweidelbach II (001) Altweidelbach VG Simmern-Rheinböllen Futura am Netz ENERCON E-92 2300 92,00 138,38 184,38 398201,00 5538813,00 427 6 Altweidelbach Altweidelbach II (002) Altweidelbach VG Simmern-Rheinböllen Futura am Netz ENERCON E-92 2300 92,00 138,38 184,38 397923,00 5540077,00 405 7 Altweidelbach Altweidelbach II (003) Altweidelbach VG Simmern-Rheinböllen Futura am Netz ENERCON E-92 2300 92,00 138,38 184,38 397609,00 5540068,00 402 8 Altweidelbach Altweidelbach II (004) Altweidelbach VG Simmern-Rheinböllen Futura am Netz ENERCON E-92 2300 92,00 138,38 184,38 398049,00 5540347,00 396 9 Altweidelbach Altweidelbach Altweidelbach VG Simmern-Rheinböllen GVK Windpark Nieder Kostenz/Altweidelbach GmbH & Co. KG rückgebaut FL1000 1000 70,00 54,00 97,00 398136,00 5538960,00 430 10 Altweidelbach Altweidelbach Altweidelbach VG Simmern-Rheinböllen GVK Windpark Nieder Kostenz/Altweidelbach GmbH & Co. -

Information-Busverkehr.Pdf
Information für die Eltern: Wiederaufnahme der Verkehre zum 2. September 2019 Ab dem 2. September 2019 starten die Busverkehre im Raum der Verbandsgemeinde Kirchberg und in angrenzenden Teilen der Verbandsgemeinde Simmern mit einem reduzierten Fahrplanangebot. Eine ordnungsgemäße Durchführung aller Schüler- und Kindergartenverkehre wurde uns durch das ausführende Verkehrsunternehmen zugesichert. Die zum 12. August 2019 geltenden Ankunfts- und Abfahrtszeiten bleiben unverändert. Auf der Homepage Ihrer Schule finden Sie die Fahrpläne aller Linien, die zum 2. September wiederaufgenommen werden und für Ihre Schule relevant sind. Im Folgenden sind diese Linien nochmal alle aufgelistet: 602 Gehlweiler – Gemünden – Sargenroth – Simmern 604 Ravengiersburg – Simmern 605 (Sargenroth –) Gemünden – Dickenschied – Kirchberg 606 Gemünden – Sargenroth – Ravengiersburg – Gemünden 608 Reckershausen / Ravengiersburg / Dickenschied – Womrath – Kirchberg 609 Kirchberg / Reckershausen – Unzenberg – Simmern 655 Altlay – Würrich – Kappel – Kirchberg 657 Haserich / Blankenrath – Kappel – Metzenhausen – Kirchberg 658 Nickweiler – Wüschheim – Biebern – Nickweiler 659 Kappel – Wüschheim – Simmern 660 RegioBus: Flughafen Hahn – Büchenbeuren – Sohren – Kirchberg – Simmern (Die Wochenendverkehre der Linie 660 finden erst ab dem 28.09.2019 statt) 661 Schwarzen – Dillendorf – Kirchberg 662 Maiermund / Belg – Hahn – Sohren – Büchenbeuren 663 Kappel – Schwarzen – Sohren – Büchenbeuren 664 Irmenach – Hirschfeld – Büchenbeuren – Sohren 665 Raversbeuren – Hirschfeld – Büchenbeuren -

Letzte Änderungen Datum Text In-Kraft-Treten 27.06.2000 Änderung Zu Nr
4.3.0 Sachbearbeitende Sachgebiet 34.5 Stelle: Letzte Änderungen Datum Text In-Kraft-Treten 27.06.2000 Änderung zu Nr. 138 15.07.2000 03.08.2000 Änderung zu Nr. 112 12.08.2000 10.10.2001 Änderungen zu Nr: 39, 47, 55, 61, 73, 90, 99, 100, 109 17.10.2001 14.12.2001 Änderung zu Nr. 66 22.12.2001 05.03.2007 Änderung zu Nr. 87, 118 08.03.2007 Rechtsverordnungen zur Sicherung von Naturdenkmälern im Rhein-Hunsrück-Kreis Nr. Name Standort Gemarkung RVO 2 Hedwigseiche in Abt. 120a Boppard 27.01.1977 3 Linde in der Niedersburg Rheinallee Nr. 68 Boppard 27.01.1977 4 Linde westl. der Am Amtsgericht Boppard 27.01.1977 kurfürstlichen Burg 5 Kratzenburger Waldabt. 20 Boppard 27.01.1977 Marktbuche 7 Katzenbuche Waldabt. 7 Badenhard 27.01.1977 8 Eiche Westausgang des Dorfes Morshausen 27.01.1977 9 Ulme Südausgang des Dorfes Leinigen- 27.01.1977 Lamscheid 11 3 Eichen Galgenberg Bell 27.01.1977 12 Ulme Ortslage Abzw. Straße nach Gödenroth Beltheim 27.01.1977 13 Eiche Staatswald "Sang" Buch 27.01.1977 15 Eiche Bärensknipp Buch 27.01.1977 16 2 Eichen Dorfmitte Buch 27.01.1977 17 Eiche nordwestl. Ortseingang L 203 Buch 27.01.1977 18 Napoleonseiche 540 m östl. L 218 Laubach - Ebschied Ebschied 27.01.1977 19 Linde vor der Kirche Frankweiler 27.01.1977 20 2 Linden auf dem Holler Mannebach 27.01.1977 21 Eiche Galgenhöhe Mastershausen 27.01.1977 22 Eiche Kriegerehrenmal Roth 27.01.1977 23 Linde vor der Kirche vor der Kirche Sevenich 27.01.1977 24 Buche Birges Berg Wohnroth 27.01.1977 25 Buche Flur 9 Wohnroth 27.01.1977 26 Eiche Südecke Waldabt. -

Der Rhein-Hunsrück-Kreis Als Referenzregion Für Klimaschutz Und
Regionale Wertschöpfung aus Erneuerbaren Energien im Rhein-Hunsrück-Kreises Vorstand- und10. Vorstandsbeirat Windenergietag GVV-Kommunalversicherung, Rheinland-Pfalz, Vortrag von Frank-Michael Vortrag von LandratUhle am Bertram 21.06.2017 Fleck in Bingenam 11.09.2012 in Köln Vorstellung Klimaschutzkonzept des Rhein-Hunsrück-Kreises 102.000 Einwohner 991 km² Fläche 137 Städte und Ortsgemeinden (75% unter 500 Einwohnern) Frank-Michael Uhle Dipl.-Ing. (FH) Architekt Klimaschutzmanager Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis Ludwigstraße 3-5, 55469 Simmern Tel. (06761) 82611 Email: [email protected] 10. Windenergietag Rheinland-Pfalz, Vortrag von Frank-Michael Uhle am 21.06.2017 in Bingen 2 Energieverbräuche im Rhein-Hunsrück-Kreis im Jahr 2011 Gesamtenergieverbrauch des Rhein-Hunsrück-Kreises (IST-Zustand) (nach Sektoren und Energieträgern) Diesel CO2 - Bilanz: 1.200.000.000 Flüssiggas 573.077 Tonnen im Jahr 1.000.000.000 Ottokraftstoff 800.000.000 Kohle 600.000.000 kWh/a Wärmepumpen 400.000.000 Solarthermie 200.000.000 0 Biomasse Erdgas Heizöl Strom (Bilanziell 66% EE-Strom) Wärme: ca. 1,2 Mio. MWh/a (49,5%) Verkehr: ca. 799.533 MWh/a (32%) Strom: ca. 463.040 MWh/a (18,5%) Gesamtenergieverbrauch ca. 2,5 Mio. MWh im Jahr Dies entspricht einer Heizölmenge von ca. 250 Millionen Litern ! 10. Windenergietag Rheinland-Pfalz, Vortrag von Frank-Michael Uhle am 21.06.2017 in Bingen 3 Energieverbräuche im Rhein-Hunsrück-Kreis im Jahr 2050 GesamtenergieverbrauchGesamtenergieverbrauch des Rhein-Hunsrück-Kreises des Rhein-Hunsrück-Kreises (IST-Zustand)