Melanargia 9 Heft 2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Plan De Gestion De La Roche De Mûrs Et Ses Abords -2019
d Plan de gestion de la Roche de Mûrs et ses abords 2019 - 2024 Sommaire Table des illustrations ................................................................................................................................................. 4 Préambule ................................................................................................................................................................... 5 Section A : Approche descriptive et analytique du site .................................................................................................. 6 A. Localisation et statuts du site ............................................................................................................................. 6 1. Généralités ...................................................................................................................................................... 6 2. Périmètres de protection et d’inventaires ..................................................................................................... 8 3. Statuts fonciers et maitrise d’usage ............................................................................................................. 13 4. Actions et démarches en cours ..................................................................................................................... 15 5. Historique du site .......................................................................................................................................... 19 B. Milieu physique................................................................................................................................................ -

Lost Life: England's Lost and Threatened Species
Lost life: England’s lost and threatened species www.naturalengland.org.uk Lost life: England’s lost and threatened species Contents Foreword 1 Executive summary 2 Introduction 5 England’s natural treasures 7 From first life to the Industrial Revolution 12 Scale of loss to the present day 15 Regional losses 24 Threatened species 26 Our concerns for the future 36 Turning the tide 44 Conclusions and priorities for action 49 Acknowledgements 52 England’s lost species This panel lists all those species known to have been lost from England in recent history. Species are arranged alphabetically by taxonomic group, then by scientific name. The common name, where one exists, is given in brackets, followed by the date or approximate date of loss – if date is known. Dates preceded by a ‘c’ are approximate. Foreword No one knows exactly when the last Ivell’s sea anemone died. Its final known site in the world was a small brackish lagoon near Chichester on the south coast of England. When the last individual at this site died, probably in the 1980s, the species was lost forever: a global extinction event, in England, on our watch. We live in a small country blessed with a rich variety of wildlife – one in which the natural world is widely appreciated, and studied as intensely as anywhere in the world. Today this variety of life is under pressure from human activities as never before. As a result, many of our native species, from the iconic red squirrel to the much less familiar bearded stonewort, are in a fight for survival. -

Magyar Coleophoridae Katalógus I. Microlepidoptera.Hu 11
Buschmann Ferenc & Ignác Richter A Magyar Természettudományi Múzeum Coleophoridae katalógusa I. Coleophoridae Catalogue of the Hungarian Natural History Museum I. (Lepidoptera: Coleophoridae) Coleophora uralensis Toll, 1961 Redigit Fazekas Imre Microlepidoptera.hu 11: 1–183. Pannon Intézet, Pécs 2016 Microlepidoptera.hu 11: 1–183. (20.05.2016) HU ISSN 2062–6738 A folyóirat évente 1–3 füzetben jelenik meg. Taxonómiai, faunisztikai, állatföldrajzi, öko- lógiai és természetvédelmi tanulmányokat közöl Magyarországról és más földrajzi terüle- tekről. Az archivált publikációk az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Periodika Adatbázis és Archívumban (EPA) érhetők el: http://epa.oszk.hu/microlepidoptera. A folyóirat, nyomtatott formában, a szerkesztő címén megrendelhető. Hungarian Microlepidoptera News. A journal focused on Hungarian Microlepidoptero- logy. Can be purchased in printed form and in CD. For single copies and further infor- mation contact the editor. Szerkesztő | Editor: FAZEKAS Imre E-mail: [email protected] Web: www.microlepidoptera.hu Szerkesztőbizottság |Editorial Board: BÁLINT ZSOLT (H-Budapest) PASTORÁLIS Gábor (SK-Komárno) SZEŐKE Kálmán (H-Székesfehérvár) Kiadványterv, tördelés, tipográfia | Design, lay-out, graphics: FAZEKAS Imre Kiadó | Publisher: Pannon Intézet | Pannon Institute, H-Pécs Nyomda | Press: Rotari Nyomdaipari Kft., H-Komló Megjelent | Published: 2016.05.20. | 20.05.2016 A Microlepidoptera.hu archívuma | Archives of Microlepidoptera.hu: http://epa.oszk.hu/microlepidoptera Web: www.microlepidoptera.hu Minden jog fenntartva | All rights reserved © Pannon Intézet/Pannon Institute |Hungary | 2016 HU ISSN 2062–6738 Tartalom – Contents Abstract…………………………………………………………………………………. 1 Bevezetés……………………………………………………………………….... 2 Anyag és módszer………………………………………………………………. 3 Eredmények.……………………………………………………………………... 5 1.1. A gyűjteményben található ivarszervi preparátumokról.…………………….... 5 1.2. A típuspéldányok és adataik…………………………………………………. 6 1.3. Néhány szó egyes gyűjteményi fajokról………………………………………. 9 1.3.1. -

The Impact of Herbicides on Weed Abundance and Biodiversity PN0940
The impact of herbicides on weed abundance and biodiversity PN0940 IACR - Long Ashton Research Station & Marshall Agroecology Ltd Dr Jon Marshall Marshall Agroecology Limited, 2 Nut Tree Cottages, Barton Winscombe, North Somerset, BS25 1DU. Email: [email protected] CAER, University of Reading Professor Valerie Brown Centre for Agri-Environmental Research (CAER), Department of Agriculture, University of Reading, Earley Gate, P.O. Box 236, Reading, RG6 6AT. Email: [email protected] CSL, York Dr Nigel Boatman Central Science Laboratory, Sand Hutton, York, YO41 1LZ. Email: [email protected] IACR – Rothamsted Dr Peter Lutman IACR- Rothamsted, Harpenden, Hertfordshire, AL52JQ. Email: [email protected] Scottish Crops Research Institute Dr Geoff Squire Scottish Crop Research Institute, Invergowrie, Dundee, DD2 5DA. Email: [email protected] The impact of herbicides on weed abundance and biodiversity PN0940 Contents Page Acknowledgements EXECUTIVE SUMMARY AND CONCLUSIONS 1. INTRODUCTION 1 1.1. Policy Rationale 1 1.2. Scope of the Desk Study 1 1.3. Objectives 1 1.4. Target and Non-Target Plant (Weed) Species 2 2. ECOLOGY OF REPRESENTATIVE WEED SPECIES 7 3. UPDATING PN0923 - NON-TARGET EFFECTS OF HERBICIDES 13 3.1. Is Biodiversity Important? 13 3.2. Change in Weed Communities 13 3.3. Impacts of Farming 14 3.4. Interactions Between Weed Diversity and Biodiversity 15 3.5. Non-Target Effects Within the Crop 15 3.6. Non-Target Effects Beyond the Crop 15 3.7. Genetically Modified Herbicide Tolerant (GMHT) Crops 16 3.8. Spatial Distribution, Remote Sensing and Mapping of Weeds 16 3.9. -

Microlepidoptera Pannoniae Meridionalis, VIII. Data to Knowledge of Micro-Moths from Dombóvár (SW Hungary) (Lepidoptera)
DOI:10.24394/NatSom.2010.17.273 Natura Somogyiensis 17 273-292 Ka pos vár, 2010 Microlepidoptera Pannoniae meridionalis, VIII. Data to knowledge of micro-moths from Dombóvár (SW Hungary) (Lepidoptera) IMRE FAZEKAS 1 & ARNOLD SCHREURS 2 1Biology Dept. of Regiograf Institute, Majális tér 17/A, H-7300 Komló, Hungary, e-mail: [email protected]; 2Conventuelenstr. 3, NL-6467 AT Kerkrade, Netherlands, e-mail: [email protected] FAZEKAS , I. & SCHREURS , A.: Microlepidoptera Pannoniae meridionalis, VIII. Data to knowledge of micro- moths from Dombóvár (SW Hungary) (Lepidoptera). Abstract A list of 436 species of micro-moth recorded from the area around Dombóvár-Gunaras (Tolna County, SW Hungary) is presented. Most of the material is from light traps, and several rarities have been found personally by Arnold Schreurs and Imre Fazekas between 1985 and 2009. Faunistic and biological notes on 35 species are given. Structure of genitalia and morphological characteristics of wings are illustrated with figures. Specimens are deposited in the private collections of Arnold Schreurs (NL), Willy Biesenbaum (D) and in the collection of Regiograf Institute (H). One species, Coleophora alnifoliae Barasch, 1934 is new to the fauna of Hungary. 14 species of Microlepidoptera are recorded as new to the fauna of the Transdanubian Hills: Borkhausenia fuscescens (Haworth, 1828) (Oecophoridae), Coleophora pseudorepentis Toll, 1960 (Coleophoridae), C. artemisicolella Bruand, 1855 (Coleophoridae), C. onobrychiella Zeller, 1849 (Coleophoridae), Sorhagenia lophyrella (Douglas, 1846) (Cosmopterigidae), Aristotelia subdecurtella (Stainton, 1858) (Gelechiidae), Caryocolum blandulella (Tutt, 1887) (Gelechiidae), Gynnidomorpha alismana (Ragonot, 1883) (Tortricidae), Apotomis betuletana (Haworth, 1811) (Tortricidae), Eucosma flavispecula Kuznetzov, 1964 (Tortricidae), Pammene regiana regiana (Zeller, 1849) (Tortricidae), P. -
La Miniera Di Raibl E Le Ultime Fasi Del Processo Idrotermale Enrico
Atti Mus. Civ. St. Nat. Trieste 56 2013 7-15 XII 2014 ISSN: 0335-1576 LA MINIERA DI RAIBL E LE ULTIME FASI DEL PROCESSO IDROTERMALE ENRICO FRANGIPANI Via dei Fabbri 1, I-34124 Trieste. E-mail: [email protected] Abstract – After studying the mine, we assume that a hydrothermal system was present during the Triassic period, which was more than likely active at the time, and was located in the Julian Alps area. There was a possibility of several stages of hydrothermal system, which lasted uninterrupted to the final stage. An occurrence of simple cooling may be the reason for Sphalerite, and Galena precipitation, while water turbulence, or a drop in pressure due to restrictions in various locations, can be the possible mechanisms of Calcium Carbonate precipitation, during the final process stages. It is very likely that this hydrothermal system didn’t last long, perhaps for only a few years. Key words: Riassunto – Il presente lavoro si propone di delineare alcuni aspetti genetici della mineralizzazione di Raibl che vengono interpretati inquadrandoli in una prospettiva di eventi idrotermali che si succedettero senza interruzione di continuità nel Triassico. Se la diminuzione di temperatura di un fluido in risalita dal sottofondo marino può ben essere la causa di una sua sovrasaturazione in solfuri, flussi turbolenti e conseguenti cadute di pressione appaiono i meccanismi più probabili in grado di spiegare la precipitazione della calcite. Si ipotizza che i fenomeni idrotermali non durarono a lungo, forse pochi anni solamente. Parole chiave: Miniera, Cave del Predil, blenda, galena, Raibl, idrotermale sistema, calcite. 1. – Introduzione Fin quando le miniere delle nostre Alpi erano attive, furono scritti diversi articoli di argomento minerario, poi con la loro chiusura, negli anni settanta circa del secolo scorso, gli articoli diminuirono. -

Proceedings and Transactions of the British Entomological and Natural History Society
o z -J z RIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOIiniliSNI NVINOSHilWS SBIMVHail .liSNi NviN0SHiiws^S3iavaan libraries Smithsonian institution RIES SMITHSONIAN *9 INSTITUTION NOIiniliSNI NVIN0SHlIWs'^S3 I H Vy 11 t^ ^ </) 2 .- ^ ^ ^ «. ^ * iisni"'nvinoshiiws S3idvaan libraries smithsonian'^institution r- , z r- 2 r- w = (/) t: {/) RIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOIiniliSNI NVINOSHIIINS S3iyvaan t^ 2 » t/> 2 t/^ I iJ llSNI_NVIN0SHlltNs'^S3 Va 8 n_LI B R AR I Es'^SMITHSONIAN_INSTITUTION N <^ Z -I Z _j 2 RIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOfiniUSNI NVINOSHIIINS S3favaan rr, XCliS^- i; s!^5iasii>' m f/> — — CO . _ LUSNi NViNOSHims S3iavMan libraries Smithsonian institution (/) Z ^ W Z .... 2 2 <D T3 O < 3 (5 D *; " z y is £ 5 SMITHSONIAN INSTITUTION NOIIfliliSN! NVIN a .0 (0 • CD tr"- do 70 "•(0 > S > ~ t/) - v> «? ji NviNosHiiws S3iyvaan libraries sm'^ 3N en <A z t/> z ...• 1^ EQ « <u O "> — <- OJ OJ.t; S <N " t: >= X I i ^ %M '^p I wXQ-.E ^^C CO _ .73 00 Z to >> 2 2oS^ I S SMITHSONIAN INSTITUTION NOIiniliSNI NIVl| <^ 07 :; ^ ^ - ° t <D Q, a. .0. E _- "D _- nj Bd cn CD 00 X 0<M t- »- C 0) oj „ 0)(v. <u c en 5 .E2E:• "'2 0.21 -J <B O _i Z 2 , II NviNOSHims SBiyvyan libraries sm r- , Z r- Z DO ^ — /<^S^^ ro /^^"^^^/X — X) > m - S § ™ CO — w £ S SMITHSONIAN INSTITUTION NOIiniliSNI NV t/' . w 2 z nj X CD i: cnS 0< (13 3 T3 — c tt) II NviNOSHiiws S3iMvyan libraries sn c >-n I- <0 "3 to — tn <tt. CD en to ,_ IT) QJ OJ 000^ o " H 03 <- CD H ° C " S^ oS* o 2.2 " ~ CD S't z _j 2 '•.P " CD r^ 05 S SMITHSONIAN INSTITUTION NOIiniliSNI . -

Pflanzengallen Und Gallenkunde – Plant Galls and Cecidology
© Autonome Provinz Bozen, Abteilung Forstwirtschaft, download unter www.biologiezentrum.at forest observer vol. 5 2010 207 - 328 Pflanzengallen und Gallenkunde – Plant Galls and Cecidology Klaus Hellrigl Abstract: Plant Galls and Cecidology The present paper on Plant Galls and Cecidology in South Tyrol constitutes the supplementary General Part to the Special Part on the indigenous gall-wasps and their galls, published last year (HELLRI G L 2008). Whereas the special part dealt mainly with the biodiversity, variety of forms of gall-wasps galls and their faunistic distribution in our region, the present general part concentrates on basic questions, such as the induction and formation of galls, host-plant association, survey and quantification of the various indigenous gall inducers. Questions on the development of the single gall inducers, and the circumstances of alternation of generations and hosts, are also discussed. The Author further explains the historical development and economical significance of cecidology as well as the mutual relations between the main actors, especially between the 17 th and 19 th Centuries. This General Part treats not only the gall-wasps and their galls (Hymenoptera, Cynipidae), but also other galls caused by animals (Nematodes & Arthropods). This basic procedure is also maintained with regard to the historical record of plant galls in Tyrol, with a numeric survey in the last section. The record for South Tyrol reveals a quantity of some 700 plant galls induced by animals (Zoocecidia – Cecidozoa). Of these, the following have been recorded so far: gall-mites (115), gall-midges (280), gall-wasps (50 -70), Sawflies (20), Homoptera Sternorrhyncha (105), beetles (60), butterflies (10), others (25-40). -

Nota Lepidopterologica
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Nota lepidopterologica Jahr/Year: 1990 Band/Volume: 13 Autor(en)/Author(s): Razowski Josef [Jozef] Artikel/Article: Morphology of the intromittent organ and distal male genital duct in Coleophoridae (Lepidoptera, Gelechioidea) 221-228 ©Societas Europaea Lepidopterologica; download unter http://www.biodiversitylibrary.org/ und www.zobodat.at Nota lepid. 13 (4) : 221-228 ; 31. XII. 1990 ISSN 0342-7536 Morphology of the intromittent organ and distal male genital duct in Coleophoridae (Lepidoptera, Gelechioidea) Jôzef Razowski Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polish Academy of Sciences, 17 Slawkowska, 3 1-016 Krakow, Poland Summary A phallotheca type intromittent organ is described from the Coleophoridae. Supposed autapomorphies of the family are listed and a list of morphological terms is added. Introduction The coleophorid intromittent organ may be called a phallus of the phallotheca type as proposed by Snodgrass (1935). This term was also used by Matsuda (1976) and Kristensen & Nielsen (1979). The enlarged and distally extending phallobase forms a tube surrounding the aedeagus, named the phallotheca. The cited authors consider, that the anterior portion of the phallotheca is double-walled and consists of a wall or phallocrypt, and the phallotheca proper (illustrated by Kristensen (1984b) in the Agatiphagidae). They also use the term endotheca for the inner wall of the former. This interpretation is followed in the present paper. The phallotheca type of phallus is known in some other groups of insects (e.g. Trichoptera), and in the Lepidoptera has been noted in the Agatiphagidae (Kristensen, 1984b) and Hetero- bathmiidae (Kristensen & Nielsen, 1979). -

Microlepidoptera Pannoniae Meridionalis, VIII. Data to Knowledge of Micro-Moths from Dombóvár (SW Hungary) (Lepidoptera)
Natura Somogyiensis 17 273-292 Ka pos vár, 2010 Microlepidoptera Pannoniae meridionalis, VIII. Data to knowledge of micro-moths from Dombóvár (SW Hungary) (Lepidoptera) IMRE FAZEKAS 1 & ARNOLD SCHREURS 2 1Biology Dept. of Regiograf Institute, Majális tér 17/A, H-7300 Komló, Hungary, e-mail: [email protected]; 2Conventuelenstr. 3, NL-6467 AT Kerkrade, Netherlands, e-mail: [email protected] FAZEKAS , I. & SCHREURS , A.: Microlepidoptera Pannoniae meridionalis, VIII. Data to knowledge of micro- moths from Dombóvár (SW Hungary) (Lepidoptera). Abstract A list of 436 species of micro-moth recorded from the area around Dombóvár-Gunaras (Tolna County, SW Hungary) is presented. Most of the material is from light traps, and several rarities have been found personally by Arnold Schreurs and Imre Fazekas between 1985 and 2009. Faunistic and biological notes on 35 species are given. Structure of genitalia and morphological characteristics of wings are illustrated with figures. Specimens are deposited in the private collections of Arnold Schreurs (NL), Willy Biesenbaum (D) and in the collection of Regiograf Institute (H). One species, Coleophora alnifoliae Barasch, 1934 is new to the fauna of Hungary. 14 species of Microlepidoptera are recorded as new to the fauna of the Transdanubian Hills: Borkhausenia fuscescens (Haworth, 1828) (Oecophoridae), Coleophora pseudorepentis Toll, 1960 (Coleophoridae), C. artemisicolella Bruand, 1855 (Coleophoridae), C. onobrychiella Zeller, 1849 (Coleophoridae), Sorhagenia lophyrella (Douglas, 1846) (Cosmopterigidae), Aristotelia subdecurtella (Stainton, 1858) (Gelechiidae), Caryocolum blandulella (Tutt, 1887) (Gelechiidae), Gynnidomorpha alismana (Ragonot, 1883) (Tortricidae), Apotomis betuletana (Haworth, 1811) (Tortricidae), Eucosma flavispecula Kuznetzov, 1964 (Tortricidae), Pammene regiana regiana (Zeller, 1849) (Tortricidae), P. aurita Razowski, 1992 (Tortricidae), Phycitodes inquinatella exustella (Ragonot, 1888) (Pyralidae) and Catoptria permutatella (Herrich-Schäffer, 1848) (Crambidae). -
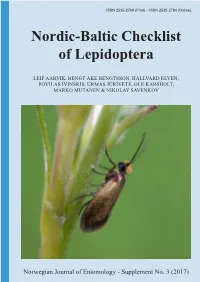
Nordic-Baltic Checklist of Lepidoptera
Supplement no. 3, 2017 ISSN 2535-2768 (Print) – ISSN 2535-2784 (Online) ISSN XXXX-YYYY (print) - ISSN XXXX-YYYY (online) Nordic-Baltic Checklist of Lepidoptera LEIF AARVIK, BENGT ÅKE BENGTSSON, HALLVARD ELVEN, POVILAS IVINSKIS, URMAS JÜRIVETE, OLE KARSHOLT, MARKO MUTANEN & NIKOLAY SAVENKOV Norwegian Journal of Entomology - Supplement No. 3 (2017) Norwegian JournalNorwegian of Journal Entomology of Entomology – Supplement 3, 1–236 (2017) A continuation of Fauna Norvegica Serie B (1979–1998), Norwegian Journal of Entomology (1975–1978) and Norsk entomologisk Tidsskrift (1921–1974). Published by The Norwegian Entomological Society (Norsk entomologisk forening). Norwegian Journal of Entomology appears with one volume (two issues) annually. Editor (to whom manuscripts should be submitted). Øivind Gammelmo, BioFokus, Gaustadalléen 21, NO-0349 Oslo, Norway. E-mail: [email protected]. Editorial board. Arne C. Nilssen, Arne Fjellberg, Eirik Rindal, Anders Endrestøl, Frode Ødegaard og George Japoshvili. Editorial policy. Norwegian Journal of Entomology is a peer-reviewed scientific journal indexed by various international abstracts. It publishes original papers and reviews on taxonomy, faunistics, zoogeography, general and applied ecology of insects and related terrestial arthropods. Short communications, e.g. one or two printed pages, are also considered. Manuscripts should be sent to the editor. All papers in Norwegian Journal of Entomology are reviewed by at least two referees. Submissions must not have been previously published or copyrighted and must not be published subsequently except in abstract form or by written consent of the editor. Membership and subscription. Requests about membership should be sent to the secretary: Jan A. Stenløkk, P.O. Box 386, NO-4002 Stavanger, Norway ([email protected]). -

Lepidoptera; Coleophoridae) 1Sibyl Bucheli, 2Jean-François Landry and 1John Wenzel 1Dept
Larval case architecture ♦ 77 Larval case architecture and implications of host-plant associations for North American Coleophora (Lepidoptera; Coleophoridae) 1Sibyl Bucheli, 2Jean-François Landry and 1John Wenzel 1Dept. of Entomology, Museum of Biological Diversity, The Ohio State University 2Agriculture & Agri-Food Canada Introduction noxious secondary chemicals of a particular plant may be pre-adapted to digest the same or very similar chemicals of Plant-insect herbivore relationships are difficult to novel unrelated plants. Colonization of host-plants based on quantify because each lineage is under many selective plant chemical cues, or resource tracking, may produce very pressures, including the pressures supplied by each similar cladograms (Jermy, 1976; Mitter and Brooks, 1983; other. Cladistic methods provide a means to examine Miller and Wenzel, 1995). In resource tracking, host-plant coevolutionary situations empirically. cladogenesis takes place prior to and independent of insect Mitter and Brooks (1983) set the standard for phylogenetic cladogenesis. Insects subsequently colonize plants that analysis of coevolutionary events by constructing produce particular chemicals. The plants colonized may have phylogenies of the insects and their host-plants and similar chemicals because of either phylogenetic relatedness comparing the two cladograms to ascertain the level of or through convergent evolution. Sequential evolution may coevolution. Two expectations must be met to argue that be much more common than nearly simultaneous coevolution a host-plant and its herbivore have undergone reciprocal in the sense of Ehrlich and Raven (Jermy, 1976; Miller and evolution: (1) there must be a nonrandom fit overall to Wenzel, 1995). association by descent (the overall branching patterns of Janz and Nylin (1998) reconsidered the relationship the cladograms must be congruent), and (2) derivations between angiosperms and butterflies in light of the Chase et al.