Ein Dorf Wird Stadt
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Quartierspiegel Wollishofen
KREIS 1 KREIS 2 QUARTIERSPIEGEL 2014 KREIS 3 KREIS 4 KREIS 5 KREIS 6 KREIS 7 KREIS 8 KREIS 9 KREIS 10 KREIS 11 KREIS 12 WOLLISHOFEN IMPRESSUM IMPRESSUM Herausgeberin, Stadt Zürich Redaktion, Präsidialdepartement Administration Statistik Stadt Zürich Napfgasse 6, 8001 Zürich Telefon 044 412 08 00 Fax 044 412 08 40 Internet www.stadt-zuerich.ch/quartierspiegel E-Mail [email protected] Texte Nicola Behrens, Stadtarchiv Zürich Michael Böniger, Statistik Stadt Zürich Nadya Jenal, Statistik Stadt Zürich Judith Riegelnig, Statistik Stadt Zürich Rolf Schenker, Statistik Stadt Zürich Kartografie Michael Böniger, Statistik Stadt Zürich Fotografie Titelbild: Micha L. Rieser, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-4.0 international Bild S. 7: Roland Fischer, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0 unportiert Bild S. 27 oben: Abderitestatos, Wikimedia Commons, CC-BY-3.0 unportiert Bild S. 27 unten: Micha L. Rieser, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-4.0 international Lektorat/Korrektorat Thomas Schlachter Druck FO-Fotorotar, Egg Lizenz Sämtliche Inhalte dieses Quartierspiegels dürfen verändert und in jeglichem For- mat oder Medium vervielfältigt und weiterverbreitet werden unter Einhaltung der folgenden vier Bedingungen: Angabe der Urheberin (Statistik Stadt Zürich), An- gabe des Namens des Quartierspiegels, Angabe des Ausgabejahrs und der Lizenz (CC-BY-SA-3.0 unportiert oder CC-BY-SA-4.0 international) im Quellennachweis, als Fussnote oder in der Versionsgeschichte (bei Wikis). Bei Bildern gelten abwei- chende Urheberschaften und Lizenzen (siehe oben). Der genaue Wortlaut der Li- zenzen ist den beiden Links zu entnehmen: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de In der Publikationsreihe «Quartierspiegel» stehen Zürichs Stadtquartiere im Mittelpunkt. -
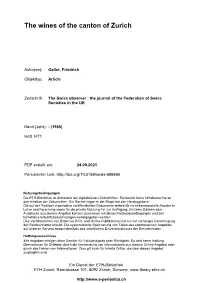
The Wines of the Canton of Zurich
The wines of the canton of Zurich Autor(en): Galler, Friedrich Objekttyp: Article Zeitschrift: The Swiss observer : the journal of the Federation of Swiss Societies in the UK Band (Jahr): - (1965) Heft 1471 PDF erstellt am: 24.09.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-686695 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch 51356 THE SWISS OBSERVER 12th February 1965 THE WINES OF THE CANTON OF ZURICH measures are being taken. The vineyards are heated in By FRIEDRICH GALLER winter and spring when the cold threatenes to freeze the buds. The vines are sprayed to ward off pests and has few features. -

Quartierspiegel Enge
KREIS 1 KREIS 2 QUARTIERSPIEGEL 2011 KREIS 3 KREIS 4 KREIS 5 KREIS 6 KREIS 7 KREIS 8 KREIS 9 KREIS 10 KREIS 11 KREIS 12 ENGE IMPRESSUM IMPRESSUM Herausgeberin, Stadt Zürich Redaktion, Präsidialdepartement Administration Statistik Stadt Zürich Napfgasse 6, 8001 Zürich Telefon 044 412 08 00 Fax 044 412 08 40 Internet www.stadt-zuerich.ch/quartierspiegel E-Mail [email protected] Texte Nicola Behrens, Stadtarchiv Zürich Michael Böniger, Statistik Stadt Zürich Judith Riegelnig, Statistik Stadt Zürich Rolf Schenker, Statistik Stadt Zürich Kartografie Marco Sieber, Statistik Stadt Zürich Fotografie Regula Ehrliholzer, dreh gmbh Korrektorat Gabriela Zehnder, Cavigliano Druck Statistik Stadt Zürich © 2011, Statistik Stadt Zürich Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Committed to Excellence nach EFQM In der Publikationsreihe «Quartierspiegel» stehen Zürichs Stadtquartiere im Mittelpunkt. Jede Ausgabe porträtiert ein einzelnes Quartier und bietet stati stische Information aus dem umfangreichen Angebot an kleinräumigen Daten von Statistik Stadt Zürich. Ein ausführlicher Textbeitrag skizziert die geschichtliche Entwicklung und weist auf Besonderheiten und wich tige Ereignisse der letzten Jahre hin. QUARTIERSPIEGEL ENGE 119 111 121 115 101 122 123 102 61 63 52 92 51 44 71 72 42 12 34 14 13 11 91 41 31 73 24 82 74 33 81 83 21 23 Die Serie der «Quartierspiegel» umfasst alle Quartiere der Stadt Zürich und damit 34 Publikationen, die in regelmässigen Abständen -

Züri Z'fuess Unterwegs in Wollishofen
S-Bahn-Haltestelle Brunau (S4) Aspweg Mythenquai Seestrasse e Scheideggstrasse s s a r t s l h ü 19 b n 20 e g g u . M r Mutschellenstrasse t s ja u 2 h se T e s s ra s t a s r g Gretenweg t in s d r e e R s e s s 1 e s m a r u Bahnhof t a s Wollishofen H a i r a l e l s Rainstrasse tras e bs B u ta S T a Renggerstrasse n n e n r a u c 18 h s t r a s e s s e s S a r e Mythenquai t e s s is t lb r A a s s e 3 M or ge Rainstrasse nt alstrasse 6 Frohalpstrasse Speerstrasse Kilchbergstr. Kilchbergstrasse 7 4 E 9 se ggw as Butzenstrasse eg tr s n 17 e 8 Eggpromenade z Kalchbühlstrasse t u B Albisstrasse 16 Lettenholzstrasse Tramendstation Hesen- e Wollishofen looweg s Honegger- e s s a weg s r t Moosstrasse 5 a s r r 15 t e s t b r l a a B w Entlisbergstr. h c r a M Hauriweg Albisstrasse Gustav-Heinrich-Weg S eeb Weitling- l ic Gstalderweg weg k s t r a s s e Widmerstrasse P 12 D ar a Kalchbühlstrasse a Nidelbadstrasse diesstrasse v i Talweg d - 14 Dangelstrasse H Rolliweg Oberscheunenweg e . s rw s e tt - a W g i . l r 13 E Bühl- 11 rebenweg Luftbild 2018 0 100 200 300 400 500m 10 1 Haumesser 6 Märchenbrunnen 11 Städtisches Seewasserwerk Moos 16 Zentrum für Gehör und Sprache Zweischneidiges Metzgerbeil Drei Küsse für drei Frösche Vom See- zum Trinkwasser Ein neuer Name für eine alte Schule 2 Landiwiese und Saffainsel 7 Vom Unterdorf zum Dorfteil «Auf 12 ABZ Siedlung Moos 17 Ehemaliges Waisenhaus Zürichs spektakulärster Rasen dem Rain» Ein Hochhaus und neun Haustypen Heimatkunde im Turm Auf Spurensuche 3 Rote Fabrik 13 Entlisberg 18 Friedhof -

Quartierspiegel Leimbach
KREIS 1 KREIS 2 QUARTIERSPIEGEL 2011 KREIS 3 KREIS 4 KREIS 5 KREIS 6 KREIS 7 KREIS 8 KREIS 9 KREIS 10 KREIS 11 KREIS 12 LEIMBACH IMPRESSUM IMPRESSUM Herausgeberin, Stadt Zürich Redaktion, Präsidialdepartement Administration Statistik Stadt Zürich Napfgasse 6, 8001 Zürich Telefon 044 412 08 00 Fax 044 412 08 40 Internet www.stadt-zuerich.ch/quartierspiegel E-Mail [email protected] Texte Nicola Behrens, Stadtarchiv Zürich Michael Böniger, Statistik Stadt Zürich Judith Riegelnig, Statistik Stadt Zürich Rolf Schenker, Statistik Stadt Zürich Kartografie Marco Sieber, Statistik Stadt Zürich Fotografie Regula Ehrliholzer, dreh gmbh Korrektorat Gabriela Zehnder, Cavigliano Druck Statistik Stadt Zürich ©2011, Statistik Stadt Zürich Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Committed to Excellence nach EFQM In der Publikationsreihe «Quartierspiegel» stehen Zürichs Stadtquartiere im Mittelpunkt. Jede Ausgabe porträtiert ein einzelnes Quartier und bietet stati stische Information aus dem umfangreichen Angebot an kleinräumigen Daten von Statistik Stadt Zürich. Ein ausführlicher Textbeitrag skizziert die geschichtliche Entwicklung und weist auf Besonderheiten und wich tige Ereignisse der letzten Jahre hin. WOLLISHOFEN LEIMBACH ENGE KREIS 2 QUARTIERSPIEGEL LEIMBACH 119 111 121 115 101 122 123 102 61 63 52 92 51 44 71 72 42 12 34 14 13 11 91 41 31 73 24 82 74 33 81 83 21 23 Die Serie der «Quartierspiegel» umfasst alle Quartiere der Stadt Zürich und damit 34 Publikationen, -

Zurich on Foot a Walk Through the Inner City
Postbrücke Bahnhof- platz 1 Bahnhof- Lagerstrasse platz Bahnhofbrücke Kasernenstrasse Schützengasse Waisenhausstr. Bahnhofquai Gessnerbrücke Militärstrasse Löwenstrasse Beaten- Schweizergasse platz Limmatquai Löwen- platz Mühlesteg Usteristrasse Am Rank 2 Militärbrücke Gessnerallee S e i Bahnhofquai d e e n s Löwenstrasse s g a a r s t Rudolf-Brun- 17 3 s Uraniastrasse s Mühleg. n e Brücke Heiristeg e Horner- L n i Bahnhofstrasse r gasse n e 5 d 6 . s r e t a Zähringer- n s Hirschengraben K Oetenbachgasse f platz h r o o se f Predigergasse tras s d Schanzengraben ls t r 4 r e 16 h a Predigerplatz i s d S Rennweg s e i Bahnhofstrasse e Spitalgasse N e Uraniastrasse ass ag Schipfe Hirschen- un rt platz Fo Brunngasse Linden- Limmatquai hof 7 Pfalzgasse Neumarkt Stüssi- hofstatt Wohllebg. M treh S l- ü 15 n Rindermarkt s 14 t U gasse e n r t g e a Spiegelg. r s e s Z e ä u n St.Peter- Wein- Obere Zäune e hofstatt 9 platz 8 Thermen- gasse Ankengasse Limmatquai Schoffelgasse Bahnhofstrasse Zwingli- Storchengasse g platz - a ag s a s W e Kirchgasse Münsterhof 13 10 Münsterbrücke Parade- platz 11 Poststrasse 12 Zentralhof Stadt- haus Tiefen- höfe Fraumünsterstrasse Kappelergasse Bahnhofstrasse Stadthausquai Aerial photograph, 2015 0 50 100 150 200 250m 1 Alfred Escher Fountain 5 Current city model of Zurich 9 Thermengasse 14 Leuenplätzli A figure symbolising a new beginning A view of the city today and perhaps A highlight of Roman bath culture Open space in the middle of the old in the 19th century how it will be tomorrow town 10 Münsterhof 2 -

Zurich on Foot a Walk Along the River Sihl
Postbrücke Lagerstrasse 1 Kasernenstr. Gessner- brücke Löwenstrasse 2 Löwen- platz Bahnhofstrasse 4 3 Gessnerallee Sihl- brücke 5 Sihlstrasse 6 Pelikan- Selnaustrasse platz 7 8 Selnaustrasse Talacker i Talstrasse a u q r 10 e h c a ff 9 u Sihlamtstr. ta S esse Sihlhölzlistrasse an stra hölzlibr.Sihl- M sse Tödistrasse Stockerstr. Zurlindenstrasse 11 Brandschenkestr. 12 13 e ss tra es k n e h c s d n a r 14 B Parkring Manesse- platz 15 Üetlibergstrasse Bahnhof Giesshübel Manessestrasse Rüdigerstrasse Bederstrasse Lessingstrasse Edenstrasse Aerial photograph, 2013 0 100 200 300 400 500m Giesshübelstr.16 1 The River Sihl 6 Schanzengraben 11 Synagogue 15 Sihl elevated roadway A small river with great importance The Venice of Zurich Prayer centre for the Jewish population 93 pillars dedicated to traffic 2 Sigi Feigel Terrace 7 Männerbadi (men’s bathhouse) 12 Sihl waterfall 16 Sihlcity New recreational area on the water The city’s oldest bathing facility The railway runs below it The new centre at the edge of the city 3 Kulturinsel (Culture Island) 8 Old Botanical Garden 13 Sihlhölzli Theatre, music and pirates Medicinal plants from the Middle Ages From a boys’ shooting tournament to a sports facility Through the old botanical garden leads Zurich on foot 4 Stones in the River Sihl 9 Selnau neighbourhood a gravel path. Why three stones in the river are The furthermost tip of District 1 14 Hürlimann Complex 3 A walk along the River Sihl painted red Commerce and apartments instead 10 Selnau development of beer 5 Sihlporte A model for contemporary housing Where cannons once fired upon the city estates 1 The River Sihl 9 Selnau neighbourhood Along the River Sihl on foot Duration of the walk: More than a thousand years ago, the River Sihl was Here the street names remind you of times past: The old District Courthouse from People love water. -

Quartierspiegel Enge
KREIS 1 KREIS 2 QUARTIERSPIEGEL 2015 KREIS 3 KREIS 4 KREIS 5 KREIS 6 KREIS 7 KREIS 8 KREIS 9 KREIS 10 KREIS 11 KREIS 12 ENGE IMPRESSUM IMPRESSUM Herausgeberin, Stadt Zürich Redaktion, Präsidialdepartement Administration Statistik Stadt Zürich Napfgasse 6, 8001 Zürich Telefon 044 412 08 00 Fax 044 270 92 18 Internet www.stadt-zuerich.ch/quartierspiegel E-Mail [email protected] Texte Nicola Behrens, Stadtarchiv Zürich Michael Böniger, Statistik Stadt Zürich Nadya Jenal, Statistik Stadt Zürich Judith Riegelnig, Statistik Stadt Zürich Rolf Schenker, Statistik Stadt Zürich Kartografie Reto Wick, Statistik Stadt Zürich Fotografie Titelbild, Bild S. 7 oben, Bilder S. 15, Bild S. 27 oben: Roland Fischer, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0 unportiert Bild S. 7 unten: Bobo11, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0 unportiert Bild S. 27 unten: Micha L. Rieser, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-4.0 international Lektorat/Korrektorat Thomas Schlachter Druck FO-Fotorotar, Egg Lizenz Sämtliche Inhalte dieses Quartierspiegels dürfen verändert und in jeglichem For- mat oder Medium vervielfältigt und weiterverbreitet werden unter Einhaltung der folgenden vier Bedingungen: Angabe der Urheberin (Statistik Stadt Zürich), An- gabe des Namens des Quartierspiegels, Angabe des Ausgabejahrs und der Lizenz (CC-BY-SA-3.0 unportiert oder CC-BY-SA-4.0 international) im Quellennachweis, als Fussnote oder in der Versionsgeschichte (bei Wikis). Bei Bildern gelten abwei- chende Urheberschaften und Lizenzen (siehe oben). Der genaue Wortlaut der Li- zenzen ist den beiden Links zu entnehmen: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de In der Publikationsreihe «Quartierspiegel» stehen Zürichs Stadtquartiere im Mittelpunkt. -

Gruppeneinteilungen
Fussballverband Region Zürich FVRZ Zusammenstellung der Gruppen aller Kategorien für die Saison 2021/2022 Inhalt: Junioren Juniorinnen Junioren Junioren A+ BRACK.CH, Gr FVRZ BRACK.CH, Gr FTC BRACK.CH, Gr IFV Blue Stars Zürich Regensdorf a Lachen-Altendorf Bülach a Wiedikon ZH Team Limmattal Süd a (Urdorf) Dietikon Höngg Küsnacht Red Star Zürich a Schaffhausen FC a Schaffhausen SV a Seefeld ZH Veltheim a Wettswil-Bonstetten a YF Juventus Junioren B BRACK.CH, Gr FVRZ BRACK.CH, Gr FTC BRACK.CH, Gr IFV Bassersdorf a Stäfa a Buchs-Dällikon a Bülach a Zürich-Affoltern a Herrliberg a Einsiedeln a Horgen a Küsnacht a Red Star ZH a Schaffhausen FC a Schwamendingen a Schaffhausen SV a Wettswil-Bonstetten a YF Juventus a Zollikon Junioren C BRACK.CH, Gr FVRZ BRACK.CH, Gr FTC Bassersdorf a Seefeld a Bülach a Wetzikon a Horgen a Küsnacht a Schwamendingen a Soccer a Veltheim a Wettswil-Bonstetten a Wiedikon a Witikon a YF Juventus a Zürich Frauen U-17 a Zürich-Affoltern a Gruppen alle Kategorien Seite 1 Junioren A+ Promotion Gruppe 1 Gruppe 2 Bassersdorf Albisrieden Brüttisellen-Dietlikon Einsiedeln Effretikon a Glattbrugg Ellikon Marthalen Horgen a Fällanden Kilchberg-Rüschlikon Gossau Kloten Niederwenigen Richterswil Oberwinterthur Schwamendingen Pfäffikon a Thalwil a Rüti a Unterstrass Seuzach Wallisellen Wetzikon Zürich-Affoltern Junioren A+ Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Buttikon Affoltern a.A. Buchs-Dällikon b Buchs-Dällikon a Beringen Elgg Feusisberg-Schindellegi Altstetten Centro Lusitano Zurich Bülach b Cholfirst United Männedorf b Freienbach Benfica Clube de Zurique Dielsdorf b Dielsdorf a Diessenhofen Tössfeld Horgen b Engstringen Effretikon b Embrach Glattfelden Uster FC Lachen/Altendorf b Hausen a.A. -

Zurich-Alpenquai: a Multidisciplinary Approach to the Chronological Development of a Late Bronze Age Lakeside Settlement in the Northern Circum-Alpine Region
Journal of Wetland Archaeology 12, 2012, 58–85 Zurich-Alpenquai: a multidisciplinary approach to the chronological development of a Late Bronze Age lakeside settlement in the northern Circum-Alpine Region Philipp Wiemann, Marlu Kühn, Annekäthi Heitz-Weniger, Barbara Stopp, Benjamin Jennings, Philippe Rentzel and Francesco Menotti Abstract The Alpenquai lake-dwelling is located on Lake Zurich, and can be considered as one of the rare Late Bronze Age lake-dwellings with a pronounced organic-rich cultural layer in the northern Circum-Alpine region. Within a larger research project, investigating the final abandonment of the lakeshores in the Circum-Alpine area at the end of the Late Bronze Age, this settlement has been investigated using a multidisciplinary research design. Combining micromorphology, archaeobotany, palynology, archaeozoology and material culture studies, the formation of the site is reconstructed, and the reasons for its final abandonment are sought. A highly dynamic lake system that caused a lake water level rise before 900 BC, a regression in the second half of the 9th century BC, and a later transgression, could be detected. The settlement appears to have been established during the lake regression, and abandoned during the transgression, proving a high degree of environmental adaptation by its inhabitants. Keywords: lake-dwellings, Switzerland, Bronze Age, multidisciplinary approach, site formation, abandonment Authors’ addresses: Philipp Wiemann, Marlu Kühn, Annekäthi Heitz-Weniger, Barbara Stopp, Benjamin Jennings, Philippe Rentzel and Francesco Menotti Institute of Prehistory and Archaeological Science (IPAS), University of Basel, Spalenring 145, 4055, Basel, Switzerland. Email: [email protected] Zurich-Alpenquai 59 Introduction The 3500-year long lake-dwelling tradition of the Circum-Alpine lakes cannot be seen as a continuous event. -

Stadt Zürich | Zurich City
Stadt Zürich | Zurich City Zürich Flughafen Tarifzone 110 111 121 Fare zone 110 S9 REGENSDORF 10 S Glattbrugg 762 116 111 1 S24 768 Halden 5 764 12 KATZENSEE 110 Bhf. Lätten- 115 162 Käshaldenstr. Im Ebnet S16 Zentrumwiesen 161 Birch-| 114 113 124 Köschenrüti Glatttalstr. S2 Post 160 118 163 Leimgrübelstr. 123 Schönauring 75 Ausser- 112 120 164 dorfstr. 117 S6 Mühlacker 761 S7 UnteraffolternSchwandenholzWaidhof 742 Ettenfeld 761 Frohbühl- 111 170 62 121 122 171 str. Bhf. Opfikon Chrüzächer Holzerhurd 184 Friedhof Seebach Giebeleichstr. 154 110 130 135 32 Schwandenholz Hertenstein- 131 172 Buhnstr. Lindbergh- OPFIKON 173 Aspholz 40 str. 140 Fronwald platz 155 132 Oberhusen 142 133 Blumen-feldstr. 150 Staudenbühl 141 134 111 Bahnhof 75 143 491 61 Affoltern Nord 768 Lindbergh-Allee 156 151 Hungerbergstr. Maillartstr.Stierenried 180 40 Himmeri Chavez-Allee 152 154 62 Glattpark 182 183 Bhf. Seebach Seebacherplatz Wright-Strasse 153 181 Zehntenhausplatz S6 S21 Fernsehstudio Glaubtenstr.Glaubtenstr. Einfangstr. Hürstholz 12 ENGSTRINGEN 64 Neun- 111 110 Mötteliweg Felsenrain- Grünwald brunnen str. Genossen- 11 Bollinger- schaftsstr. Schauen- berg weg 14 Oerlikerhus Orionstr. Heizenholz Bhf. Auzelg Oerlikon Leutschen- Lerchenhalde Glaubtenstr. Riedbach Rütihof Lerchen- weg Nord bach WALLISELLEN Süd 62 Chalet- 781 rain 79 Herti Belair Giblenstr. Hagenholz Auzelg Ost 46 Schumacherweg Bahnhof 485 80 Geeringstr. Schützenhaus Bhf. Höngg Birchstr. Wallisellen 80 Oerlikon S8 S14 S19 Riedhofstr. Neu- Platz 61 Ost 37 Oberwiesen-Max-Bill- Saatlenstr. S8 Friedhof Bahnhof Hallenbad Riedgraben Dreispitz Aubrücke 89 affoltern str. Hönggerberg Oerlikon 94 Oerlikon 94 Flora- 40 str. 308 Ifang 62 Schürgi- 304 Michelstr. Althoos Frankental ETH 61 str. 110 121 Segantinistr.Singlistr. -

Vereinsnachrichten FC Unterstrass Zürich Dezember 2019
Vereinsnachrichten FC Unterstrass Zürich Dezember 2019 immer am Ball - aktuelle Infos, Spielplan, Resultate und Adressen www.fcunterstrass.ch Co-Sponsor 1. Mannschaft - Saison 2019 / 20 Fussball-Corner Oechslin Schaffhauserplatz 10, 8006 Zürich Tel. 044 362 62 82 Oechslin Fussball Corner DIE NUMMER 1 FÜR FUSSBALL UND FANS Besuchen Sie unser Geschäft oder unseren grossen Online-Shop: www.fussball-corner.ch Spezialgeschäft Ladenöffnungszeiten: für Fussballspieler, Mo. – Fr., 09.00 – 18.30 Uhr Teamsportler und Läufer Samstag, 09.00 – 17.00 Uhr 06_Inserat_A5_Hoch_RZ.indd 1 03.06.15 09:12 2 Vorwort der Präsidenten Liebe FCU-Gemeinschaft Schon wieder ist ein halbes Jahr vorüber und die Winterpause steht vor der Tür. Wie gewohnt Zeit, sich von den sportlichen Strapazen zu erholen, Energie für das kommende Jahr zu tanken und die vergangene Vorrunde Revue passieren zu lassen. Das Sommerfest hat uns Mitte des Jahres wieder ein wunderschönes Wochenende be- schert. Es war aus unserer Sicht sowohl aus gesellschaftlicher als auch aus wirtschaft- licher Sicht ein grosser Erfolg. Vielen Dank nochmals an alle, die sich für diesen Anlass eingebracht haben! Nach dem Fest ist bekanntlich vor dem Fest. Es gilt das 100-Jahr-Jubiläum im 2021 in Angriff zu nehmen. Einige Vorbereitungen wurden schon initiiert (Ideen Box, FCU- Jubiläums-Logo), die grossen Aufgaben stehen aber noch bevor. Im Zeitpunkt, wo euch dieses Heft erreicht, haben wir bereits einen Aufruf für die Teilnahme im Projektteam ver- schickt oder ein solcher wird in Bälde noch folgen. Es wäre schön und ist auch wichtig, wenn sich so viele wie möglich melden, damit wir auch diese Feier gemeinsam zu einem unvergesslichen Anlass gestalten können.