Dissonanz, Dissidenz Und Der ‚Dritte Weg‘ in Der Musik1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
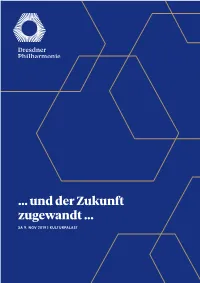
Programmheft (PDF 2.3
… und der Zukunft zugewandt … SA 9. NOV 2019 | KULTURPALAST Spartacus FR 29. NOV 2019 | 19.30 Uhr SA 30. NOV 2019 | 19.30 Uhr KULTURPALAST TSCHAIKOWSKI ›Manfred‹-Sinfonie h-Moll PROKOFJEW Violinkonzert Nr. 2 g-Moll CHATSCHATURJAN Auszüge aus dem Ballett ›Spartacus‹ DMITRIJ KITAJENKO | Dirigent SERGEJ KRYLOV | Violine DRESDNER PHILHARMONIE Tickets 39 | 34 | 29 | 23 | 18 € [email protected] dresdnerphilharmonie.de 9 € Schüler, Studenten © Klaus Rudolph PROGRAMM 17.00 Uhr, Konzertsaal Musik – Demokratie – Europa Harald Muenz (* 1965) [ funda'men de'nit ] per dieci voci, für zehn Stimmen, para diez voces, for ten voices, pour dix voix auf Textauszüge aus dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (1949) und der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (2000), eingerichtet vom Komponisten (2019) Stefan Beyer (* 1981) »Vi« für Vokalensemble und Elektronik (2019) Hakan Ulus (* 1991) »Auslöschung II« für zehn Stimmen (2019) Chatori Shimizu (* 1990) »Rightist Mushrooms« für zehn Stimmen (2019) Fojan Gharibnejad (* 1995) Zachary Seely (* 1988) »hēmi« für zehn Sänger (2019) Olaf Katzer | Leitung AUDITIVVOKAL DRESDEN Die fünf Werke entstanden im Auftrag von AUDITIVVOKAL DRESDEN und erklingen als Urauührungen. PROGRAMM 18.30 Uhr, Konzertsaal I have a dream Kurzeinführung: Zeitzeugen im Gespräch mit Jens Schubbe Friedrich Schenker (1942 – 2013) Sinfonie »In memoriam Martin Luther King« (1969/70) Sehr langsam – Schnell – Ruhige Halbe (in der Art eines Chorals) – Tempo I Schnell und rigoros – Langsam – Ruhig ießend – Tempo I Jonathan -

Friedrich Goldmann
© Astrid Karger Friedrich Goldmann Contemporary BIOGRAPHY Friedrich Goldmann Born in 1941 in Chemnitz, Friedrich Goldmann first studied at the Ferienkurse für Neue Musik in Darmstadt with Karlheinz Stockhausen in 1959. He went on to study composition in Dresden and Berlin until 1964. While still a student he became an assistant composer at Berliner Ensemble, where he met future collaborators Heiner Müller, Luigi Nono and Ruth Berghaus. Since the early 1970s Goldmann emerged as the leading exponent of a new music avant-garde in East Germany, and soon also became widely performed in West Germany and, subsequently, in Western Europe. His oeuvre includes numerous chamber works, four symphonies, four solo concertos, orchestral works and one opera. Around 1969 Goldmann developed a technique of composing with heterogenous layers, appropriating traditional forms (sonata, symphony etc.) and ‘breaking them open from within’ with new techniques. This allowed for highlighting the friction between divergent layers as a distinct aesthetic parameter, predating developments regarding the use of historical references and ‘multiple coding’. In the 1970s Goldmann developed a method of composition that holistically integrates the full range of formal possibilities of new music. He explored perceptual continuums and amalgamations, such as transitions between noise and tone, or chromatic and microtonal material. With parameter boundaries dissolving, he thus challenged the conventional concept of musical parameters as discrete entities. Goldmann received commissions from Berliner Philharmonie, Staatsoper Berlin, Semperoper Dresden and most radio symphony orchestras in Germany, with Konzerthaus Berlin, Wittener Tage Festival and Ensemble Modern being among his most frequent commissioners. Since 1980 he taught at Berlin’s Akademie der Künste and became professor of composition at Universität der Künste in Berlin in 1991. -

Hochschulproduktionen
Hochschulproduktionen Nummer Komponist Werk 1 Domenico Scarlatti Sonate K.337 2 Domenico Scarlatti Sonate K.25 3 Johann Sebastian Bach Prélude 4 Johann Sebastian Bach Allemande 5 Johann Sebastian Bach Courante 6 Johann Sebastian Bach Sarabande 7 Johann Sebastian Bach Gavotte I 8 Johann Sebastian Bach II - Gigue 9 Joaquin Rodrigo Allegro ma non troppo 10 Joaquin Rodrigo Minueto pomposo 11 Joaquin Rodrigo Allegro vivace 12 Leo Brouwer Per Suonare a Due 13 Leo Brouwer Per Suonare a Due 14 J. Hendrix Purple Haze 15 Steffen Reinhold melotos 16 Franz Liszt h-moll Sonate 17 Johannes K. Hildebrandt Quartett um E 18 Thomas Stöß Unerwartete Begegnung 19 Thomas Christoph Heyde Rhythmica Mobile 20 Claudia Stiehl Drei Stücke für Oboe solo 21 Thomas Stöß Alle Wege haben geführt zum Tod 22 Rudi Stephan Abendlied 23 Rudi Stephan Heimat 24 Rudi Stephan DIR 25 Rudi Stephan Pantherlied 26 Rudi Stephan Sonntag 27 Rudi Stephan Das Hohelied der Nacht 28 Rudi Stephan Pappeln im Strahl 29 Rudi Stephan Im Einschlafen 30 Heinrich Sutermeister Das Alter 31 Heinrich Sutermeister Sommernacht auf dem Kirchhof 32 Heinrich Sutermeister Das junge Mädchen 33 Heinrich Sutermeister Abendlied 34 Aribert Reimann Wo ist der Vater 35 Aribert Reimann Der Sommer ist fortgeflogen 36 Aribert Reimann Willst du reiten 37 Aribert Reimann Die Schlange ist gestorben 38 Aribert Reimann Gib mir den Apfel 39 Aribert Reimann Mit dem Zeigefinger 40 Aribert Reimann Schlafkind 41 Luciano Berio Dolce cominciamento 42 Luciano Berio La donna ideale 43 Luciano Berio Avendo gran disio 44 Luciano -

Musik Für Eine Humanistischere Ggesellschaft
Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig Institut für Musikpädagogik Masterarbeit Gutachter: Prof. Christoph Sramek, Prof. Tobias Rokahr MMUSIK FÜR EINE HUMANISTISCHERE GGESELLSCHAFT LEBEN UND WERK DES KOMPONISTEN GÜNTER KOCHAN Masterarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Master of Arts vorgelegt von Christian Quinque Danksagung Diese Arbeit hätte nicht entstehen können ohne die Hilfe zahlreicher Menschen, denen ich an dieser Stelle meinen herzlichen Dank aussprechen möchte. Dieser gilt zuerst meinem Mentor Prof. Christoph Sramek für seine Bereitschaft, diese Arbeit zu betreuen, für seine Offenheit im Gespräch und die vertrauensvolle, sachkundige und stets unverzügliche Beratung. Ebenfalls danke ich Herrn Prof. Tobias Rokahr für die Übernahme des Zweitgutachtens und für seine Beratung zu Analyseverfahren neuer Musik. Zu großem Dank verpflichtet bin ich Frau Inge Kochan, Frau Hannelore Gerlach und Herrn Peter Aderhold aus Berlin. In unseren Gesprä- chen am 19. und 20. November 2012 und weiteren Telefonaten und Briefwechseln haben sie mir großes Vertrauen und Interesse entgegengebracht, sich auch kritischen Fragen gestellt und meine Arbeit bedingungslos nach Kräften unterstützt. Ohne ihre Ermöglichung der Ein- sichtnahme in ansonsten unzugängliche Materialien, in Manuskripte, Fotos, Partituren, Kon- zertmitschnitte und den kompositorischen Nachlass Günter Kochans und die Erteilung urhe- berrechtlicher Genehmigungen hätten diese Arbeit und insbesondere das Werkeverzeichnis nicht in der vorliegenden Form zustande kommen können. Ich danke auch den Mitarbeiterin- nen des Deutschen Musikarchivs in Leipzig für die freundliche und geduldige Unterstützung und Beratung bei der Recherche nach Ton- und Schriftdokumenten. Dem Studierendenrat der Hochschule für Musik und Theater Leipzig gilt mein herzlicher Dank für die finanzielle Förde- rung dieser Arbeit durch vollständige Übernahme der im Zusammenhang mit den Recherchen entstandenen Unkosten. -

Contact: a Journal for Contemporary Music (1971-1988)
Contact: A Journal for Contemporary Music (1971-1988) http://contactjournal.gold.ac.uk Citation Hennenberg, Fritz. 1982. ‘Who Follows Eisler? Notes on Six Composers of the GDR’. Contact, 24. pp. 8-10. ISSN 0308-5066. ! [!] FRITZ HENNENBERG Who Follows Eisler? Notes on Six Composers of the GDR Biographical data Siegfried Matthus Friedrich Goldmann 13 April 1934 Born Mallenuppen (at that time in East 27 April 1941 Born Siegmar-SchOnau (Saxony). Prussia). 1951- Member of the Dresden Kreuzchor. 1952- Studied at the Deutsche Hochschule ftir Musik, 1959- Studied at the Carl Maria von Weber Berlin, with among others Rudolf Wagner- Hochschule ftir Musik, Dresden. Regeny. 1959 Participated in the Internationale Ferienkurse 1958- Studied with Hanns Eisler at the Akademie der ftir Neue Musik and Stockhausen's seminar at Ktinste der DDR. Darmstadt. 1960- Freelance composer in Berlin. 1.962- Studied with Rudolf Wagner-Regeny at the 1964- Dramaturg 1 and composer at the Komische Akademie der Ktinste der DDR. Oper, Berlin. 1964- Studied musicology at the Humboldt 1969- Ordinary member of the Akademie der Ktinste University, Berlin: der DDR. 1968- Freelance composer in Berlin. 1970 Awarded the Arts Prize of the GDR. 1977 Awarded the Arts Prize of the GDR. 1972 Awarded the National Prize of the GDR. 1978- Ordinary member of the Akademie der Ktinste 1972- Secretary of the music section of the Akademie der DDR. der Ktinste der DDR. 1978- Corresponding member of the Bayerische Friedrich Schenker Akademie der SchOnen Ktinste. 23 December 1942 Born Zeulenroda (Thuringia). 1961- Studied at the Hanns Eisler Hochschule ftir Georg Katzer Musik, Berlin (composition with Gtinter 10 January 1935 Born Habelschwerdt (at that time in Kochan). -

Arnold Schönberg in Der DDR Ein Beitrag Zur Verbalen Schönberg-Rezeption
Julia Glänzel Arnold Schönberg in der DDR Ein Beitrag zur verbalen Schönberg-Rezeption sinefonia 19 · wolke Dieser Band erscheint als Band 19 in der Reihe sinefonia © Julia Glänzel alle Rechte vorbehalten Wolke Verlag Hofheim, 2013 Umschlaggestaltung: Friedwalt Donner, Alonissos ISBN 978-3-95593-019-6 www.wolke-verlag.de Inhalt Danksagung.........................................................7 I Einleitung .......................................................9 1 Gegenstand und Vorgehensweise .....................................11 2 Quellenlage und Forschungsstand . 14 3 Grundlagen .....................................................21 3.1 Offizielle Erwartungen an Kunst/Musik in der DDR ..................21 3.2 Schönberg im westeuropäischen Musikleben/im Musikleben der Bundesrepublik Deutschland ..................................24 3.3 Schönberg im Musikleben der DDR ...............................28 II Formalismusverdacht..............................................37 1 Diskussion in der Sowjetunion.......................................39 2 Prager Kongress ..................................................46 3 Formalismusdiskussion in der SBZ/DDR...............................55 4 Schönberg und der Formalismusvorwurf ...............................64 4.1 Darstellung Schönbergs in Periodika . 67 4.1.1 Rezensionen bis 1948 ......................................67 4.1.2 Rezensionen ab 1948 ......................................69 4.1.3 Hanns Eisler, ein Schüler Arnold Schönbergs....................73 4.2 Gründungskonferenz des Komponistenverbandes -
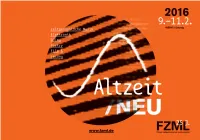
Programmheft Downloaden
Programm Seite 09. Februar 2016 [Dienstag] 01-06 10. Februar 2016 [Mittwoch] 07-11 11. Februar 2016 [Donnerstag] 12 INHALTSVERZEICHNIS FZML 13 FZML RÜCKBLICK 14 MOSAIK 15 FFZML 16 BIOGRAFIEN MITWIRKENDE 17-23 Jan Gerdes | Fabrizio Nocci 17 Erik Drescher | Glissandoflöte 18 Opossum 19 Yana Karkalis | Isis Calil de Albuquerque | Ruben Reniers 20 Felix Anton Lehnert | Stefan Locher | DJ Mesia 21 Christian Meyer | Boris Flekler | Julia Berke 22 Mark Daniel | Ralph Grüneberger | DJ Filburt 23 BIOGRAFIEN KOMPONISTEN 24-26 Samir Odeh-Tamimi | Hans-Werner Henze | Karlheinz Stockhausen 24 Luigi Nono | Georg Katzer | Thomas Christoph Heyde 25 Michael Maierhof | Dror Feiler | Alvin Lucier 26 IMPRESSUM 27 FÖRDERER & PARTNER 28 PROGRAMM 20:30 Uhr WERK 2 [Halle D] Samir Odeh-Tamimi: Skiá für Klavier [2008] 2016 FEBRUAR 09. Hans-Werner Henze: Präludien zu »Tristan« für Klavier [2003] Nr. 1: Achtel = 92 Nr. 3: Lento Konzert Musik und Politik - Karlheinz Stockhausen: Klavierstück IX [1961] Klavierwerke aus Ost und West 1 Luigi Nono: … sofferte onde serene … für Klavier und Tonband [1976] Jan Gerdes [Klavier] Georg Katzer 5 Miniaturen [1971] Nr. 1-3 Thomas Christoph Heyde Ingrimm/Ero[t]ica [2011] für Klavier - Uraufführung Die Musiksprache des palästinensisch-israelischen Komponisten Samir Odeh- Tamimi, der seit seinem 22. Lebensjahr seinen schöpferischen Mittelpunkt in Deutschland hat, ist geprägt von einer lebendigen Auseinandersetzung sowohl mit arabischen Musiktraditionen, als auch der Avantgardemusik Mittel- und Westeuropas. Das 2008 in New York uraufgeführte »Skiá« bildet in diesem 2016 FEBRUAR 09. Kanon keine Ausnahme: mit einer flirrenden Trillerfigur, die immer wieder abgewandelt in Erscheinung tritt, beginnt das Werk, verdichtet sich mit Akkordstrukturen und kontrastreichen Passagen, bis es zum Schluss in höchsten Höhen ankommt und plötzlich mit einem tiefen Flimmern im Nichts endet. -

Anna Maria Olivari Doktor Faustus (Ver-) Stimmen Kompositionen Zu Thomas Manns Roman Doktor Faustus (Ver-)Stimmen Anna Maria Olivari
Anna Maria Olivari Doktor Faustus (ver-) stimmen Kompositionen zu Thomas Manns Roman Doktor Faustus (ver-)stimmen Anna Maria Olivari Doktor Faustus (ver-)stimmen Kompositionen zu Thomas Manns Roman Anna Maria Olivari Berlin, Deutschland ISBN 978-3-662-62634-4 ISBN 978-3-662-62635-1 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-662-62635-1 Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbiblio- grafie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en) 2021. Dieses Buch ist eine Open-Access-Publikation. Open Access Dieses Buch wird unter der Creative Commons Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine Bearbeitung 4.0 International Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ deed.de) veröffentlicht, welche die nicht-kommerzielle Nutzung, Vervielfältigung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die Lizenz gibt Ihnen nicht das Recht, bearbeitete oder sonst wie umgestaltete Fassungen dieses Werkes zu verbreiten oder öffentlich wiederzugeben. Die in diesem Buch enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genann- ten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist auch für die oben auf- geführten nicht-kommerziellen Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. -

Positionen – Texte Zur Aktuellen Musik
Positionen Inhaltsverzeichnis Hefte 1-93 (1988-2012) Ablinger, Peter, Für und wider das Kunstwerk: Annäherung, 23/1995, 36-39 –, Konventionalität der Musik, 34/1998, 5 –, Differenz und Differenzierung, 41/1999, 6-7 –, Motette, 44/2000, 16-17 –, Opern, Mischformen, Niemandsland ..., Standpunkte von Komponistinnen und Komponis- ten, 55/2003, 30-31 –/Markus Fein, Überschneidungen. Ein Gespräch, 59/2004, 18-21 –, Ausdruck/Sonate, 73/2007, 7-12 –, Keine Überschreitung, 78/2009, 11 –, Überflüssig. Zum Begriff des Experimentellen, 90/2012, 21-23 Abromeit, Peter, Bericht: Grosses Lernen in Bremen, 80/2009, 59 Adkins, Helen, »Dead chickens« Schrottmutationen und Klangapokalypse, 14/1993, 7-8 Albrecht, Norbert, Ruth Zechlin: Kristallisation für Orchester, 3/1989, 20-21 de Alvear, Maria, Zur Verfügbarkeit und Geschichtlichkeit des Materials, 49/2001, 31 –/ Mörchen, Raoul, »Es geht um eine Verrückung...« , 67/2006, 26-27 –, Über Aufmerksamkeit im Alltag, 76/2008, 31-32 Amme, Kristin, Bericht: MachtMusik, 69/2006, 54-56 –, Bericht: Leipzig: stéle 2008, 78/2009, 57 –, Bericht: FreiZeitArbeit in Leipzig: Bahnhofskonzert, 80/2009, 66 –, Bericht: Reisen bildet: Flughafenkonzert, 84/2010, 62 Amzoll, Stefan, Georg Katzers »Multi-Media«-Projekte, 14/1993, 26-28 –, Radio-Oper Die Gebeine des Dantons von Schenker/Mickel, 5/1990, 19-20 –, Zeugnisse: Offener Brief an die Akademie der Künste Berlin-Brandenburg, 22/1995, 54-55 –, Störfall. Gespräch mit Friedrich Schenker, 35/1998, 36-38 –, Von Anfang an dialektisch gedacht, der Hallenser Komponist Thomas Müller, 41/1999, 44-48 –, Goldberg-Passion. Ein Gespräch mit Friedrich Schenker, 42/2000, 50-51 –, Bericht: IX. Randspiele in Zepernick, 48/2001, 64-66 –, Bericht: XI. Randspiele in Zepernick, 56/2003, 55-56 –, Bericht; Pyramidale in Berlin-Hellerdorf, 58/2004, 62-63 –, Bericht: Randspiele Zepernick, 69/2006, 56-57 –, Der Dorn im Fleisch. -
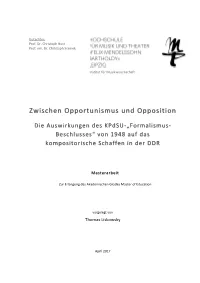
MA Final2acli
!"#$%&#'()* +(,-.*/(.*0&(12#,3&*4"2#* +(,-.*'5.*/(.*0&(12#,3&*6($5'7* * * * *892#1#"#*-:(*;"217<122'92%&$-#* * * * =<12%&'9*>33,(#"9125"2*"9?*>33,21#1,9* * /1'*@"2<1(7"9A'9*?'2*B+?6CDEF,(5$G125"2D H'2%&G"22'2I*J,9*KLMN*$"-*?$2* 7,53,21#,(12%&'*6%&$--'9*19*?'(*//O* * * ;$2#'($(P'1#* ="(*Q(G$9A"9A*?'2*@7$?'512%&'9*!($?'2*;$2#'(*,-*Q?"%$#1,9* * * * * J,(A'G'A#*J,9* R&,5$2*S127,<27T* * * * * * @3(1G*UVKW* /$972$A"9A* F:(*?1'*>--'9&'1#*15*!'23(X%&*"9?*?1'*J'(#($"'92J,GG'*"9?*2$%&7"9?1A'*H'($#"9A*5Y%&#'* 1%&*51%&*P'1*/(.*0&(12#,3&*4"2#*"9?*J,(*$GG'5*P'1*/(.*0&(12#,3&*6($5'7*P'?$97'9.*/$(:P'(* &19$"2*<X('*?1'2'*@(P'1#*91%&#*,&9'*?1'*-$%&G1%&'*B,53'#'9Z*"9?*="$(P'1#*Z$&G('1%&'(*+'(2,D 9'9*19*?'9*H'&Y(?'9*?'(*6#$?#*S'13Z1A*5YAG1%&*A'<'2'9.*[,(*$GG'5*2'1*F($"*H(1A1##'*!'T'(* A'?$97#\*S'1#'(19*?'(*6,9?'(2$55G"9A'9*?'(*;"217$P#'1G"9A*19*?'(*6#$?#P1PG1,#&'7*S'13Z1A\* ,&9'*?1'*'19'*Q1921%&#*19*?'9*]$%&G$22*J,9*4'((9*R('1P5$99*91%&#*5YAG1%&*A'<'2'9*<X('.* /$(:P'(*&19$"2*A1G#*5'19*/$97*F($"*/(.*R&'7G$*BG"##1A*J,5*6X%&212%&'2*6#$$#2$(%&1J*S'13Z1A\* F($"*H'$#'*O'P9'(*J,5*S'13Z1A'(*C91J'(21#X#2$(%&1J\*F($"*8(12*R:(7'*J,5*!'<$9?&$"2$(%&1J\* F($"* B$#&$(19$* H''(* J,9* ?'(* ;"217$P#'1G"9A* ?'(* /'"#2%&'9* ]$#1,9$GP1PG1,#&'7\* F($"* /(.* @GG5"#&*H'&('9?#*J,5*@(%&1J*?'2*;/OD619-,91',(%&'2#'(2*2,<1'*F($"*CG(17'*^1G7'92*J,9*?'(* 6#$21DC9#'(G$A'9P'&Y(?'*S'13Z1A.*F:(*_'AG1%&'*C9#'(2#:#Z"9A*$5*Q9?'*?'(*@(P'1#*A1G#*2%&G1'`D G1%&*5'19*&'(ZG1%&'(*/$97*B$#_$*B($#Z'92#'19\*+$"G$*a$92'9\*6#'--1*B"(#&\*[$G'9#19*!:9#&'(*"9?* A$9Z*P'2,9?'(2*5'19'9*H(:?'(9*;$(#19*"9?*@GP('%&#*2,<1'*5'19'5*[$#'(*[,G7'(*S127,<27T.** D*88*D* * !"#$%&'()*+),-#",'. -

Reflective Nostalgia and Diasporic Memory
Edinburgh Research Explorer Reflective nostalgia and diasporic memory Citation for published version: Kelly, E 2013, Reflective nostalgia and diasporic memory: Composing East Germany after 1989. in A Saunders & D Pinfold (eds), Remembering and Rethinking the GDR: Multiple Perspectives and Plural Authenticities. Palgrave Macmillan, pp. 116-131. Link: Link to publication record in Edinburgh Research Explorer Document Version: Early version, also known as pre-print Published In: Remembering and Rethinking the GDR General rights Copyright for the publications made accessible via the Edinburgh Research Explorer is retained by the author(s) and / or other copyright owners and it is a condition of accessing these publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Take down policy The University of Edinburgh has made every reasonable effort to ensure that Edinburgh Research Explorer content complies with UK legislation. If you believe that the public display of this file breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 26. Sep. 2021 Anna Saunders and Debbie Pinfold, eds., Rembering and Rethinking the GDR: Multiple Perspectives and Plural Authenticities, 2013, reproduced with permission of Palgrave Macmillan. This extract is taken from the author's original manuscript and has not been edited. The definitive, published, version of record is available here: http://www.palgrave.com/la/book/9780230360570 Reflective nostalgia and diasporic memory: Composing East Germany after 1989 Elaine Kelly The redrawing of borders in post-communist Europe led to a significant transformation of the continent’s diasporic landscape. -

Musik Für Kinder Und Jugend Am Beispiel Paul Dessau Eine Musikhistorisch-Politische Studie
Fachgebiet Musikwissenschaft Musik für Kinder und Jugend am Beispiel Paul Dessau Eine musikhistorisch-politische Studie Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster (Westf.) vorgelegt von Hye-Eun Uh aus Busan / Korea (2009) Tag der mündlichen Prüfung: 05. 03. 2009 Dekan: Prof. Dr. Christian Pietsch Gutachter: Prof. Dr. Joachim Dorfmüller Zweitgutachter: Prof. Dr. Andreas Jacob Die vorliegende Arbeit wurde von der philosophischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms- Universität Münster als Dissertation angenommen und wurde durch Promotionsabschluss- stipendien der Universität Münster gefördert. 2 Danksagung Dank schulde ich zuerst Herrn Prof. Dr. Ekkehard Kreft, der am Anfang meine Promotion unterstützte. Obwohl er mich leider aus gesundheitlichen Gründen einem anderen Betreuer anvertrauen musste, zeigte er weiterhin seine Aufmerksamkeit für meine Arbeit. Herrn Prof. Dr. Joachim Dorfmüller danke ich dafür, dass er mit großer Freude mich betreute und mich durch beständige ermutigende Unterstützung anregte. Außerdem bin ich auch Herrn Prof. Dr. Jacob dankbar, dass er als Zweitgutachter meine Arbeit las und mir wissenschaftliche Anregungen gab. Für die gewissenhafte Korrektur meiner Arbeit danke ich Frau Helgard Wortmann, die mit großer Aufmerksamkeit diese Arbeit las und mich neben der sprachlichen Unterstützung von ganzem Herzen ermutigte. Bedanken möchte ich mich auch bei Herrn Helmut Waldhof, der mir stets vertrauensvoll zur Seite stand. Schließlich