Waldschutz Ist Klimaschutz Ist Waldschutz
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

GERMAN GREENS in COALITION GOVERNMENTS a Political Analysis
GERMAN GREENS IN COALITION GOVERNMENTS A Political Analysis by Arne Jungjohann 1 GERMAN GREENS IN COALITION GOVERNMENTS A Political Analysis A Political Analysis A Political German Greens in Coalition Governments German Greens in Coalition Governments A Political Analysis By Arne Jungjohann Published by the Heinrich-Böll-Stiftung European Union English version published with the support of the Green European Foundation About the author CONTENTS Arne Jungjohann is an energy analyst and political scientist. He advises foundations, think tanks, and civil society in communication and strategy building for climate and energy policy. Previously, he worked for Minister President Winfried Kretschmann of Baden-Württemberg, the Heinrich Böll Foundation in Washington DC, in the German Bundestag, and in the family owned business. As its editor he launched the most influential English Twitter account on the German Energiewende (@ EnergiewendeGER). He co-authored ‘Energy Democracy: Germany’s Energiewende to Renewables’ Foreword 7 (Palgrave Macmillan 2016). Arne is a member of the Green Academy, a network with leading thinkers Foreword by the author 9 from science, politics and civil society which is facilitated by the Heinrich-Böll-Stiftung. He is the founder of the local chapter of the German Green Party in Washington DC and lives in Stuttgart. He studied at Philipps University Marburg and at the Free University of Berlin. 1 Introduction 11 1.1 State of the research and sources used 12 1.2 Lead Questions and Composition of the Study 14 2 Coalition Constellations 15 3 The Coalition Arena at State Level 19 3.1 Departmental Responsibilities of the Greens 19 3.2 Coalition Management in the G-states 26 3.2.1 The Bundesrat Clause 27 3.2.2 Coalition Personnel 28 3.2.3 Coalition Committees 30 You are free to share – copy and redistribute the material in any medium or format and adapt – remix, transform, and build upon the material. -

Plenarprotokoll 18/23
Inhaltsverzeichnis Plenarprotokoll 18/23 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 23. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 20. März 2014 Inhalt: Wahl der Abgeordneten Klaus-Peter Willsch Dr. Hans-Peter Friedrich (Hof) und Swen Schulz (Spandau) als Mitglieder (CDU/CSU) . 1770 C des Kuratoriums Wissenschaftszentrum Gabriele Groneberg (SPD) . 1772 B Berlin für Sozialforschung . 1753 A Michael Stübgen (CDU/CSU) . 1773 B Wahl der Abgeordneten Nadine Schön (St. Wendel) und Waltraud Wolff (Wol- Marieluise Beck (Bremen) (BÜNDNIS 90/ mirstedt) als ordentliche Mitglieder sowie DIE GRÜNEN) . 1774 B Wahl weiterer stellvertretender Mitglieder in Christian Petry (SPD) . 1775 A den Beirat bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post Manfred Grund (CDU/CSU) . 1775 D und Eisenbahnen . 1753 B Klaus-Peter Willsch (CDU/CSU) . 1777 B Wahl der Abgeordneten Dr. Claudia Wolfgang Gehrcke (DIE LINKE) . 1778 D Lücking-Michel als Schriftführerin . 1753 C Manfred Grund (CDU/CSU) . 1779 B Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- nung . 1753 C Absetzung der Tagesordnungspunkte 3 und 9. 1754 A Tagesordnungspunkt 4: Nachträgliche Ausschussüberweisungen . 1754 A Beratung der Unterrichtung durch den Wehr- beauftragten: Jahresbericht 2013 (55. Be- richt) Zusatztagesordnungspunkt 2: Drucksache 18/300 . 1780 A Abgabe einer Regierungserklärung durch die Hellmut Königshaus, Wehrbeauftragter Bundeskanzlerin: zum Europäischen Rat des Deutschen Bundestages . 1780 A am 20./21. März 2014 in Brüssel . 1754 D Dr. Ursula von der Leyen, Bundesministerin Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin . 1755 A BMVg . 1782 A Dr. Gregor Gysi (DIE LINKE) . 1759 A Christine Buchholz (DIE LINKE) . 1784 B Thomas Oppermann (SPD) . 1762 A Heidtrud Henn (SPD) . 1786 C Heike Hänsel (DIE LINKE) . 1763 B Doris Wagner (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) . 1788 A Dr. -

Die Preisträger 2018
Deutscher Umweltpreis DBU Deutscher Umweltpreis – Die Preisträger 2018 Die Preisträger 2018 Inhaltsverzeichnis 4 Nachhaltigkeit bei der Preisverleihung Grußwort 5 Rita Schwarzelühr-Sutter und Alexander Bonde Die Preisträger 2018 6 Prof. Dr. Antje Boetius 18 Prof. Dr. Roland A. Müller, Dr. Manfred van Afferden, Dr. Mi-Yong Lee und Dipl.-Ing. Wolf-Michael Hirschfeld DBU Deutscher Umweltpreis 34 Erfurt – liebenswerte Landeshauptstadt Thüringens 38 Deutscher Umweltpreis 2017 appelliert: ökologische Belastungsgrenzen der Erde nicht überstrapazieren 43 Motivation verstärkt, nachhaltig zu handeln 46 Die Verleihung des 26. Deutschen Umweltpreises 48 Das Bewerbungs- und Auswahlverfahren des Deutschen Umweltpreises Die Preisträger 52 Alle Preisträger im Überblick Das Kuratorium 70 der Deutschen Bundesstiftung Umwelt Die Jury 71 zum Deutschen Umweltpreis 2018 Die Vorschlagsberechtigten 72 für den Deutschen Umweltpreis 2018 2018 74 Impressum Programm des Festaktes Begrüßung Rita Schwarzelühr-Sutter, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, Vorsitzende des Kuratoriums der DBU Anja Siegesmund, Thüringer Ministerin für Umwelt, Energie und Naturschutz Festrede Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Musik GlasBlasSing Preisträger Prof. Dr. Antje Boetius, Alfred-Wegener-Institut (AWI) Prof. Dr. Roland A. Müller, Dr. Manfred van Afferden, Dr. Mi-Yong Lee und Dipl.-Ing. Wolf-Michael Hirschfeld, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) sowie Bildungs- und Demonstrationszentrum Dezentrale Infrastruktur (BDZ) Preisübergabe Bundespräsident -

Dienstwagen Der Landesregierungen 2020
Dienstwagen der Landesregierungen 2020 Bundesland Politiker/in Amt Dienstwagen Kraft- Bau- Motor-/ Höchst- Norm- CO2-Norm- CO2-Norm- Realer Ø Realer 1) 3) 3) stoff jahr System- geschwin- verbrauch ausstoß ausstoß CO2- CO2-Ausstoß leistung2) digkeit kombiniert3) inkl. Ausstoß4) gesamt je 100 km Strommix NEFZ | WLTP NEFZ | WLTP NEFZ | WLTP [kW] [km/h] [l] / [kWh] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km] Dietmar Strehl Senator für Finanzen Kein Dienstwagen - - - - - - - - *) Anja Stahmann Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport Car-Sharing - - - - - 102 102 145 Platz 1 (NEFZ) (NEFZ) Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Benzin/ 5) Dr. Maike Schaefer Mercedes-Benz E 300e 2020 235 250 1,7 l + 14,3 kWh 38 95 184 Wohnungsbau - Bürgermeisterin Elektro (155 + 90) (NEFZ) (NEFZ) (NEFZ) Präsident des Senats und Bürgermeister, Kultursenator sowie Senator für Benzin/ 6) Dr. Andreas Bovenschulte Mercedes-Benz E 300e 2019 235 250 1,7 l + 14,9 kWh 41 101 189 Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften Elektro (155 + 90) (NEFZ) (NEFZ) (NEFZ) Benzin/ 7) Dr. Claudia Bogedan Senatorin für Kinder und Bildung Mercedes-Benz E 300e 2019 235 250 1,7 l + 14,3 kWh 38 95 196 Elektro (155 + 90) (NEFZ) (NEFZ) (NEFZ) 194 Benzin/ 7) Kristina Vogt Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa Mercedes-Benz E 300e 2019 235 250 1,7 l + 14,3 kWh 38 95 196 Bremen Elektro (155 + 90) (NEFZ) (NEFZ) (NEFZ) Benzin/ 8) Claudia Bernhard Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz Mercedes-Benz E 300e 2019 235 250 1,8 l + 14,9 kWh 41 101 200 Elektro (155 + 90) (NEFZ) (NEFZ) (NEFZ) Senatorin für Justiz und Verfassung sowie Senatorin für Wissenschaft und 9) Dr. -

Arne Jungjohann: Grün Regieren
Arne Jungjohann: Grün regieren. Eine Analyse der Regierungspraxis von Bündnis 90/ Die Grünen Heinrich-Böll-Stiftung, Schriftenreihe Demokratie # 44 Anhang 1: Überblick G-Länder Grün Regieren Anhang 1: Überblick G-Länder Anhang 1: Überblick G-Länder Landesregierungen unter Beteiligung von Bündnis 90/Die Grünen im Zeitraum zwischen 2007 und Juni 2016. in % in Sitzen Grünes Grünes Landtag Koalition Anzahl der der Anzahl Bundesland Grüne Sitze im im Sitze Grüne Grüner Anteil an an Anteil Grüner Koalitionspartner Koalitionspartner Sitze der Koalition der Sitze & Besonderheiten Grüne Ministerien Grüne Ministerien Grüne Ministerien Grüne Wahlergebnis in % in Wahlergebnis Koalition in % nach % nach in Koalition Ministerien gesamt Ministerien I (1) Staatsministerium (Winfried Kretschmann, MP) (2) Umwelt, Klima und Energiewirtschaft (Franz Untersteller) (3) Verkehr und Infrastruktur (Winfried Hermann) Rot - 2016) (4) Wissenschaft, Forschung und Kunst (Theresia Bauer) - 24,2% 36 2 71 50,7% SPD 12 5 41,6% (5) ländlichen Raum und Verbraucherschutz (Alexander Bonde) Württemberg Grün - Besonderheiten: (2011 (1) Stabsrätin und Stelle für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung aden B (2) Staatssekretär-Funktion mit Kabinettsrang II (1) Staatsministerium (Winfried Kretschmann, MP) (2) Finanzen (Edith Sitzmann) (3) Soziales und Integration (Manne Lucha) Schwarz Schwarz 30,3% 47 2 88 53,4% CDU 11 6 54,5% (4) Wissenschaft und Kunst (Theresia Bauer) - (5) Umwelt, Energiewirtschaft und Naturschutz (Franz Württemberg Württemberg (ab 2016) (ab - Grün Untersteller) -

Grüner Aufbruch 2017
Änderungsantrag zu FR-04 Ersetze Überschrift und Zeile 2-141 durch: Grüner Aufbruch 2017 In wenigen Wochen feiern wir Grüne unseren 35. Geburtstag. Am 13. Januar 1980 haben sich ÖkologInnen, desillusionierte SozialistInnen, BürgerrechtlerInnen, Frauenbewegte, PazifistInnen, Lesben und Schwule, TierschützerInnen, AktivistInnen aus Bürgerinitiativen, JungdemokratInnen und noch viele mehr zusammengefunden, um unsere Partei zu gründen. Unsere Geschichte als Partei ist geprägt von Höhen und Tiefen. Wir haben in Frage gestellt, diskutiert, wo es weh tut, und sind in Debatten gegangen, die sich viele nicht trauten. Wir haben dabei viel, sehr viel erreicht. In zahlreichen Feldern sind wir mit unseren Ansichten und Konzepten inzwischen mehrheitsfähig geworden, die Gesellschaft ist grüner geworden und wir Grüne haben uns weiterentwickelt. Dazu gehört auch die Bewahrung des Erbes von 25 Jahren friedlicher Revolution in der DDR und des Falls der Mauer. Wir Grüne wurden überlebensnotwendig ergänzt, bereichert und als wiedervereinigt verankert durch das Bündnis 90. Wir Grüne wollen wachsen – um unseren Veränderungsanspruch, unsere Inhalte besser durchsetzen zu können. Das eint uns alle. Um zu wachsen, müssen wir uns auch unsere Vielfalt bewahren: Wir müssen werbend und begeisternd auf die Menschen zugehen, sie dort abholen, wo sie sind und ebenso klar Missstände weiterhin als solche benennen und dagegen ankämpfen. Wir müssen kluge innovative Konzepte vorlegen, die zeigen, wie es anders gehen kann, bei gesellschaftlichen Konflikten aber auch klar Stellung beziehen. Wir müssen regieren, konzeptionieren und demonstrieren. Diese Verbindung war immer unsere Stärke. So macht unsere Partei, machen Bündnis 90/Die Grünen, auch heute den Unterschied im bundesdeutschen Parteiensystem aus. Wir waren, wir sind und wir bleiben anders. Die Bundestagswahl vor einem Jahr war eine Zäsur für uns Grüne im Bund. -
ZDF-Jahrbuch 2014 Start Themen Des Jahres Das Jahr Im Rückblick Finanzen Dokumentation Programmchronik
ZDF-Jahrbuch 2014 Start Themen des Jahres Das Jahr im Rückblick Finanzen Dokumentation Programmchronik ZDF Kultur, Geschichte und Wissenschaft Show Politik und Zeitgeschehen Kinder und Jugend Musik Wirtschaft, Recht, Soziales und Umwelt Fernsehfilm Serie I Aktuelles Sport Fernsehfilm Serie II Zeitgeschehen ZDFspezial Spielfilm ZDFreportage ZDF-Jahrbuch 2014 Start Themen des Jahres Das Jahr im Rückblick Finanzen Dokumentation Programmchronik Kultur, Geschichte Naturwissenschaft und Technik Peter Hahne und Wissenschaft Redaktion: Natalie Müller-Elmau, Michael Faszination Erde (UT/HD) Kramers Mit Dirk Steffens 38 Sendungen (0,48 Mio.; 5,3 MA %) Kultur Berlin Redaktion: Christiane Götz-Sobel 6 Sendungen (4,76 Mio.; 14,7 MA %) Precht (UT/HD) aspekte Redaktion: Werner von Bergen, Natalie Kulturmagazin mit Katty Salié, Jo Schück Faszination Universum (UT/HD) Müller-Elmau und Tobias Schlegel Mit Professor Harald Lesch Leitung: Peter Arens Redaktion: Daniel Fiedler Redaktion: Christiane Götz-Sobel 6 Sendungen (0,51 Mio.; 5,5 MA %) 34 Sendungen (0,80 Mio.; 5,2 MA %) 2 Sendungen (3,83 Mio.; 13,2 MA %) 1914/2014 – Lernen wir aus der Geschichte? Das blaue Sofa (UT/HD) Leschs Kosmos (seit 11.11.2014 HD) 16.2.2014 (0,38 Mio.; 4,6 MA %) Literatur mit Wolfgang Herles Mit Professor Harald Lesch Redaktion: Wolfgang Herles Redaktion: Christiane Götz-Sobel Kampfzone Nationalstaat – 6 Sendungen (0,82 Mio. ; 4,5 MA %) 12 Sendungen (1,53 Mio.; 9,3 MA %) Brauchen wir noch Grenzen? 8.6.2014 (0,54 Mio.; 5,0 MA %) Das blaue Sofa extra: Frag den Lesch (sonntags) Frankfurter -

5-Punkte-Plan Zur Flüchtlingspolitik
Wir, der Ministerpräsident und Vizeministerpräsidenten und Vizeministerpräsi- dentinnen der grün mitregierten Länder, haben zusammen mit dem Bundes- und Fraktionsvorstand von Bündnis90/die Grünen am 18.08.2015 unsere ge- meinsamen Vorschläge zur Asyl- und Flüchtlingspolitik vorgelegt. Im Hinblick auf den am 06.09.2015 tagenden Koalitionsausschuss der die Bundesregie- rung tragenden Parteien und Fraktionen und den für den 24.09.2015 geplan- ten Flüchtlingsgipfel von Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen konkretisieren und fokussieren wir Vorschläge mit nachfolgendem 5-Punkte-Plan zur Flüchtlingspolitik Die Zahl der nach Deutschland kommenden Flüchtlinge wird auf absehbare Zeit auf hohem Niveau bleiben. Das stellt alle Verantwortlichen in Bund, Ländern und Kom- munen gleichermaßen vor hohe Herausforderungen. Die Herausforderung besteht darin, das Grundrecht auf Asyl als individuelles Menschenrecht zu erhalten. Jeder Einzelfall zählt. Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit müssen auf allen Ebe- nen entschieden bekämpft werden. Jede und jeder Asylsuchende hat einen Anspruch darauf, dass ihr oder sein Schutzbedarf festgestellt wird. Wir müssen hierfür die Asyl- verfahren wirksam entlasten, die Zuwanderung über das Asylsystem verantwortbar begrenzen und dafür pragmatische Alternativen für eine geregelte Einwanderung nach Deutschland vor allem für diejenigen schaffen, die mit dem Ziel der Arbeitsauf- nahme nach Deutschland kommen, aber mangels rechtlicher Alternativen bislang den Weg des Asylantrags gehen. -

Grün Regieren Eine Analyse Der Regierungspraxis Von Bündnis 90 / Die Grünen
BAND 44 Grün regieren Eine Analyse der Regierungspraxis von Bündnis 90 / Die Grünen Von Arne Jungjohann GRÜN REGIEREN SCHRIFTEN ZUR DEMOKRATIE BAND 44 Grün regieren Eine Analyse der Regierungspraxis von Bündnis 90 /Die Grünen Von Arne Jungjohann Herausgegeben von der Heinrich-Böll-Stiftung Über den Autor Arne Jungjohann ist Politikwissenschaftler, Autor und freischaffender Berater. Er berät Stiftungen, Parteien, Think-Tanks und zivilgesellschaftliche Akteure in der Klima- und Energiepolitik. Zuvor arbeitete er für das Staatsministerium Baden-Württemberg, die Heinrich-Böll-Stiftung in Washing- ton DC, den Bundestagsabgeordneten Reinhard Loske und im familieneigenen Betrieb. Er studierte an der Philipps-Universität in Marburg und der Freien Universität Berlin. Zusammen mit Thomas Losse-Müller hat er im April 2008 den Ortsverband Washington DC von Bündnis 90 /DIE GRÜNEN gegründet. Er ist Co-Autor des Buches Energy Democracy – Germany's Energiewende to Renewables (2016) und lebt mit seiner Familie in Stuttgart. Diese Publikation wird unter den Bedingungen einer Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de Eine elek tro nische Fassung kann her- untergeladen werden. Sie dürfen das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen. Es gelten folgende Bedingungen: Namensnennung: Sie müssen den Namen des Autors / Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen (wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Wer- kes durch Sie würden entlohnt). Keine -

Histoisch-Politische Mitteilungen. 23/2016. Archiv Für Christlich-Demokratische Politik
Aufriss Bezug für Buchblock 155 x 230 mm: 15 + 4,5 + 155 + 23 + 155 + 4,5 + 15 x 15 + 3 + 230 + 3 + 15 mm HPM 23/2016 HISTORISCH- POLITISCHE MITTEILUNGEN ARCHIV FÜR CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE POLITIK I SBN 3- 412- 50799- 7 ISBN 978-3-412-50799-2 | WWW.BOEHLAU-VERLAG.COM 23 / 2016 412-50799_BZ HPM 23-16.indd 1 24.11.2016 08:59:50 HISTORISCH-POLITISCHE MITTEILUNGEN Archiv für Christlich-Demokratische Politik Im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. herausgegeben von Thomas Brechenmacher, Günter Buchstab, Hans-Otto Kleinmann und Hanns Jürgen Küsters 23. Jahrgang 2016 BÖHLAU VERLAG KÖLN WEIMAR WIEN HISTORISCH-POLITISCHE MITTEILUNGEN Archiv für Christlich-Demokratische Politik 23. Jahrgang 2016 Im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. herausgegeben von Prof. Dr. Thomas Brechenmacher, Dr. Günter Buchstab, Prof. Dr. Hans-Otto Kleinmann und Prof. Dr. Hanns Jürgen Küsters Redaktion: Dr. Wolfgang Tischner, Christopher Beckmann M. A. Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. Wissenschaftliche Dienste / Archiv für Christlich-Demokratische Politik Rathausallee 12 53757 Sankt Augustin Tel. 02241 / 246 2240 Fax 02241 / 246 2669 e-mail: [email protected] Internet: www.kas.de © 2016 by Böhlau Verlag GmbH & Cie., Köln Weimar Wien Ursulaplatz 1, D-50668 Köln, www.boehlau-verlag.com Alle Rechte vorbehalten Satz: Satzpunkt Ursula Ewert GmbH, Bayreuth Druck: Strauss, Mörlenbach ISSN: 0943-691X ISBN: 978-3-412-50799-2 Erscheinungsweise: jährlich Preise: € 19,50 [D] / € 20,10 [A] Erhältlich in Ihrer Buchhandlung oder direkt beim Böhlau Verlag unter: [email protected], Tel. +49 221 91390-0, Fax +49 221 91390-11 Ein Abonnement verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn die Kündi- gung nicht zum 1. -
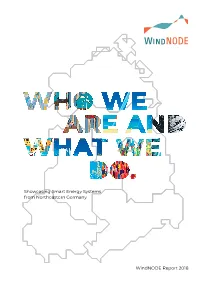
Showcasing Smart Energy Systems from Northeastern Germany
Showcasing Smart Energy Systems from Northeastern Germany. WindNODE Report 2018 WINDNODE REPORT 2018 3 What does a successful energy transition look like? The WindNODE project “Energy and Art” brought 50 different visions of the energy transition to life. Find out more in the section “New Perspectives on Energy” or at www.energie-und-kunst.de/en 4 TABLE OF CONTENTS WINDNODE REPORT 2018 5 Table of Contents The Four Focus Areas ...................................................................................... 32 The Subprojects .................................................................................... 36 – 149 WindNODE Report 2018 ICT Networking Platform .................................................................................. 36 Flexible Generation and Regional Power Plants ................................................. 46 Efficient Operating Concepts for Power Grids .................................................... 56 Connected End Customer ................................................................................. 70 Editorial ......................................................................................................... 06 Market Design and Regulation .......................................................................... 84 What Drives Us ............................................................................................... 08 New Flexibility Options: Sector Coupling ............................................................. 90 Industrial Load Shifting Potential ................................................................... -

H2-International-February-2020
Hydrogeit / www.h2-international.com / Issue 1 / February 2020 / 10 $ Ú THE COMMERCIAL VEHICLE INDUSTRY DISCOVERS HYDROGEN Ú POLITICS PUSHES HYDROGEN AS AN ENERGY STORAGE MEDIUM H y d r o g e i t V l a / w . h z n f 1 7 J 4 O k b 2 0 8 CONTENT CONTENT 2 Legal Notice 3 Editorial 4 News Kerstin Andreae heads BDEW CEP: Growth and strengthening Wrightbus continues driving Flexible, stretchable bio-fuel cell 6 Trade shows Hydrogen and WindEnergy f-cell attracts numerous suppliers 8 House energy Home owners are insecure Enapter promotes the installation of 10 Politics 22 self-sufficient microgrids Green hydrogen economy until 2035 German Federal Council votes for hydrogen economy Major stakeholder conference in Berlin 20 Energy storage Hyundai Source: HyStarter, HyExperts, HyPerformer are started Company portrait: Electrolyser manufacturer Enapter 24 Electromobility 2 Increasing interest in hydrogen from freight forwarders The maritime sector discovers the fuel cell Economies of scale achievable quickly 130 hydrogen filling stations by 2021 Hyundai’s FC trucks could soon Load wheel with H2 drive IAA – New start looks different 24 be on Germany roads 36 Research & Development Sustainable added value of PEM fuel cells 38 Education Stralsund has written H2 history Invisible Kids – Results of an on-line survey 42 Stock market 48 Global market Interview with Randy MacEwen, President & CEO of Ballard 54 Business directory Interview: Ballard builds leading-edge 48 FC stack for Audi 57 Events H2-international Editorial & Research Sven Geitmann, Sven Jösting, News articles that show an author’s name represent the opinions of said Michael Nallinger author and do not necessarily represent the views of the editorial board.