Rote Liste Der Libellen Südtirols (Insecta: Odonata)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

„Ortles“ Rennrad- Woche Von Samstag 07. Juli Bis Sonntag 15
Voraussichtliches Programm für die „Ortles“ Rennrad- Woche von Samstag 07. Juli bis Sonntag 15. Juli 2012 Samstag, 07. Juli: Anreise und Abendliches Briefing mit Vorstellung der „Ortles“ Rennradwoche ab 21.30 Uhr im Hotel Lindenhof in Naturns Sonntag, 08. Juli: Südtirols Süden Seen Tour 117 km 950 hm Start 10 Uhr Strecke: Naturns – Marling - Lana – Apfelradweg - Frangart – Radweg Eppan - Montiggler See – Montiggl - Kalterer See – Kojotenpass – Pfatten - Etschdammradweg – Lana – Naturns Von Naturns (554 m) startet unsere Tour und wir fahren bergab nach Meran. In Algund überqueren wir die Hauptstraße und fahren über welliges Gelände nach Marling. Über Marling und Tscherms gelangen wir nach Lana, der größte Obstbaugemeinde Südtirols. Von Lana geht’s weiter dem Apfelradweg entlang, in Richtung Bozen, bis zur Ortschaft Frangart. Nun erwartet uns der Anstieg nach Eppan und weiter zum Montiggler See. Vom Montiggler See fahren wir ins Dorf Montiggl und über eine Abfahrt erreichen wir den Kalterer See, das größten Weinanbaugebiet Südtirols. Wir fahren am See entlang und bei Klughammer beginnt die kleine Steigung hinauf zum Kojotenpass. Nach einer kurzen Abfahrt gelangen wir hinunter nach Pfatten und über den Etschdammradweg fahren wir wieder zurück nach Lana. Von Lana führt uns die Straße weiter nach Tscherms und Meran. Wir fahren durch die Kurstadt Meran und gelangen nach Algund, hier beginnt die letzte Steigung unserer Tour, hinauf bis Töll. Von Töll haben wir noch die letzten Kilometer zum ausradeln bis Naturns. Südtirols Süden Seen Tour (light) 98 km 450 hm Start 10 Uhr Strecke: Naturns – Marling - Lana – Apfelradweg - Frangart – Radweg Eppan - Montiggler See – Montiggl - Kalterer See – Klughammer – Auer - Etschdammradweg – Lana Von Naturns (554 m) startet unsere Tour und wir fahren bergab nach Meran. -

Viehversicherungsvereine
Angaben im Sinne von Art. 1, Absatz 125 des Gesetzes Nr. 124 vom 4. August 2017 Hinsichtlich der Verpflichtung auf der Internetseite, die von der öffentlichen Verwaltung oder dieser gleichgestellten Körperschaft erhaltenen Geldbeträge auszuweisen, die in Form von Subventionen, Unterstützungen, wirtschaftliche Vergünstigungen, Beiträge oder Sachleistungen, die keinen öffentlichen Charakter aufweisen und keine Gegenleistung, Entgelt oder Schadenersatz darstellen, bescheinigen die Vereine hiermit, im Jahr 2019 folgende öffentliche Beiträge erhalten zu haben (Kassaprinzip): Finanzjahr Name Vorname CUAA Addresse PLZ Gemeinde Provinz Beihilfe 2019 Gerichtsalmen Lazins Timmels 82013270218 GOMION 18 39015 St.Leonhard In Passeier Bozen 94.612,00 2019 Viehversicherungsverein Pfalzen 92007980219 GREINWALDNER STRASSE 15 (GREINWALDEN) 39030 Pfalzen Bozen 37.722,50 2019 Viehversicherungsverein Mölten 94021480218 ZUM KREITER 3 39010 Mölten Bozen 31.972,50 2019 Viehversicherungsverein Lichtenberg 91010030210 MARKTWEG 12 (LICHTENBERG) 39026 Prad Am Stilfserjoch Bozen 30.259,00 2019 Viehversicherungsverein St. Georgen/Bruneck 92007560219 GISSBACHSTRASSE 35 (ST.GEORGEN) 39031 Bruneck Bozen 29.387,50 2019 Viehversicherungsverein Tartsch 91010160215 TARTSCH 96 39024 Mals Bozen 28.419,50 2019 Viehversicherungsverein Terenten 92007900217 WALDERLANERSTRASSE 8 39030 Terenten Bozen 26.395,00 2019 Viehversicherungsverein Sand In Taufers 92007810218 WINKELWEG 60 (KEMATEN) 39032 Sand In Taufers Bozen 25.840,00 2019 Viehversicherungsverein Trens 90008060213 FLANS -

Viehversicherungsvereine
Angaben im Sinne von Art. 1, Absatz 125 des Gesetzes Nr. 124 vom 4. August 2017 Hinsichtlich der Verpflichtung auf der Internetseite, die von der öffentlichen Verwaltung oder dieser gleichgestellten Körperschaft erhaltenen Geldbeträge auszuweisen, die in Form von Subventionen, Unterstützungen, wirtschaftliche Vergünstigungen, Beiträge oder Sachleistungen, die keinen öffentlichen Charakter aufweisen und keine Gegenleistung, Entgelt oder Schadenersatz darstellen, wird bescheinigt im Jahr 2020 folgende öffentliche Beiträge erhalten zu haben (Kassaprinzip): Vereine/Antragsteller MwSt. Nr. / IVA Nr. Adresse PLZ Gemeinde genehmigte Beihilfe Gerichtsalmen Lazins Timmels 82013270218 GOMION 18 39015 St.Leonhard In Passeier 100.091,50 Hagelschutzkonsortium 80000630212 JAKOBISTRASSE 1/A 39018 Terlan 36.066,50 Viehversicherungsverein Lüsen 90012210218 RUNGGER STRASSE 21 39040 Lüsen 30.909,00 Viehversicherungsverein Pfalzen 92007980219 GREINWALDNER STRASSE 15 (GREINWALDEN) 39030 Pfalzen 30.452,00 Viehversicherungsverein Mölten 94021480218 ZUM KREITER 3 39010 Mölten 28.710,00 Viehversicherung Kastelruth - Seis 94022390218 ST.MICHAEL 28 39040 Kastelruth 27.373,00 Viehversicherungsverein Burgeis 91009790212 BURGEIS 152 39024 Mals 27.080,00 Viehversicherungsverein Taisten 92007600213 WIESEN 40 39035 Welsberg - Taisten 26.638,50 Viehversicherungsverein Terenten 92007900217 WALDERLANERSTRASSE 8 39030 Terenten 24.137,50 Viehversicherungsverein St. Magdalena/Gsies 92007670216 MAGDALENA-STRASSE 35 (ST.MAGDALENA) 39030 Gsies 23.700,50 Viehversicherungsverein -

Versuchsbericht Relazione Di Progetto
Versuchsbericht Relazione di progetto Agronomische Charakterisierung der Vinschger Roggenlandsorten Caratterizzazione agronomica delle varietà locali di segale vernina della Val Venosta BLW–ab-09/2 2008–2011 AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE PROVINZIA AUTONOMA DE BULSAN - SÜDTIROL IMPRESSUM © Land- und Forstwirtschaftliches Versuchszentrum Laimburg/Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg, 2012 Herausgeber/editore: Land- und Forstwirtschaftliches Versuchszentrum Laimburg/Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg Laimburg 6 I-39040 Auer/Ora – Pfatten/Vadena Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati Kontakt/contatto: Giovanni Peratoner, Sektion Berglandwirtschaft/Sezione Agricoltura Montana T +39 0471 969 661 | F +39 0471 969 599, [email protected] Untersuchte Landsorten und Zuchtsorten Varietà locali e varietà studiate Genbankcode Sortentyp Lokale Bezeichnung Herkunftsgemeinde Codice della banca Tipo di varietà Nome locale Comune di provenienza del germoplasma (LS = Landsorte/varietà locale , Sortenname ZS = Zuchtsorte/varietà ) Nome della varietà LSC014 LS Prad am Stilfser Joch/ Prato allo Stelvio LSC015 LS Stilfs/ Stelvio LSC046 LS Breita Martell/ Martello LSC053 LS Enneberg/ Marebbe LSC057 LS Petkuser Langstroh Mals/ Malles LSC058 LS Vinschger Laas/ Lasa LSC060 LS Marteller Martell/ Martello LSC062 LS Gial Schluderns/ Sluderno LSC066 LS Vinschger Latsch/ Laces LSC069 LS Chrisanthanser Graun im Vinschgau/ Curon Venosta LSC079 LS Petkuser Prad am Stilfser Joch/ Prato allo Stelvio LSC086 LS Ottenbacher Mals/ Malles LSC090 LS Mals/ Malles LSC092 LS Aichen Martell/ Martello LSC094 LS Vinschger Kastelbell-Tschars/ Castelbello-Ciardes CHD 17 ZS Conduct ZS Eho-kurz ZS Elect ZS Matador ZS Walet ZS Herkunft der Vinschger Winterroggen-Landsorten. LSC053 wird nicht abgebildet, da sie keine Vinschger Landsorte ist. -
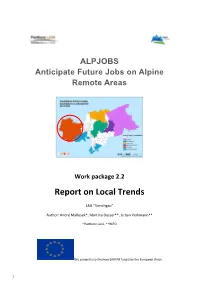
PL Report on Local Trends
ALPJOBS Anticipate Future Jobs on Alpine Remote Areas Work package 2.2 Report on Local Trends LAG “Vinschgau” Author: André Mallosek*, Martina Dosser**, Urban Perkmann** *Plattform Land, **WIFO This project is co-financed (ARPAF funds) by the European Union 1 CONTENTS The Vinschgau A Socio-Economic Portrait 1. Population 3 2. Economy 7 2.1 Tourism 7 2.2 Jobs 8 3. Public services and society 11 4. Summary 12 Appendix Tables 14 1. POPULATION This report examines the socio-economic structure of the Vinschgau district. In order to highlight the special features of this region even better, a comparison with the neighbouring district of Burggrafenamt and South Tyrol as a whole will be carried out. The district Vinschgau consists of 13 municipalities and is located in the west of South Tyrol on the border to Austria and Switzerland. With 35,500 inhabitants and an area of 1,442 km², it is one of the least densely populated areas in South Tyrol. Due to its central location and around 6,000 inhabitants, Schlanders is the capital of the Vinschgau district. The Burggrafenamt, on the other hand, has a much larger population of around 101,600 inhabitants, 40 percent of which are living in Merano, the district's capital. The 26 municipalities of this district cover an area of 1,101 km². Figure 1.1 Location of the districts Vinschgau and Burggrafenamt Source: WIFO © 2018 WIFO Until the reopening of the Vinschgau railway in 2005, the district of Vinschgau was only poorly integrated into South Tyrol's public transport network. The accessibility of the valley by road has also always been difficult, as it is remote from the main traffic axis (Brenner motorway) and the main road is regularly congested. -
Bikeregion Vinschgau–Meran
mit Bikeshuttle- Infos Bikeregion Vinschgau–Meran Mit diesen Tipps kommen Sie auf Touren: MTB-Genussrad-e-Bike und Rennrad-Touren! 1340 m 1770 m 1920 m 2 Inhalt 3 Allgemein 4 Bike-Region Meran-Vinschgau 5 Radwege, Trails und Pässe 8 Beschilderungssystem 9 Konditionelle Fähigkeiten 10 Technische Schwierigkeiten 10 Trail Tolerance 11 Verhaltensregeln 94 Biker-Brettl MTB 15 Touren 16 Bike Highline Meran 19 Touren Partschins/Rabland/Töll 24 Touren Naturns/Plaus 33 Touren Kastelbell-Tschars 37 Touren Latsch bis Schlanders Rennrad 49 Touren 50 Über Pässe 52 Stilfserjoch 56 Rundtouren Genussrad 59 Unterwegs auf den Talradwegen 60 Unterwegs auf der Via Claudia Augusta 61 Meran, Passeiertal, Unterland 62 Touren Ötzi Bike 71 Unterwegs mit Experten Academy 74 Wochenprogramm 75 Bike Guides 78 Technik-Trainingsparcours 79 E-Mountainbike-Testwochen 80 Technikseminare 82 Cross Country Trail-Week 84 Biketouren-Angebote 87 Ötzi Bike Kids Camp 88 Rennrad-Opening 90 Pässewoche Bikeshuttle 91 Bergbahnen mit Radtransport 92 Bikeshuttle 93 Bikeshuttle-Service Impressum Herausgeber: Tourismusverein Naturns, Tourismusverein Partschins, Tourismusverein Kastelbell-Tschars Fotos: BikeHotels Südtirol – Kirsten Sörries, IDM Südtirol – Daniel Geiger, TV Naturns – PhotoGruenerThomas, TV Partschins – Helmuth Rier Texte: Thomas Hanifle, Ex Libris Grafik: ID-Creativstudio Druck: Karo Druck 4 5 Die Bikeregion Meran-Vinschgau Sonne satt und die längste Bikesaison der Alpen, dazu Radwege Radwege, Trails und Pässe und Trails, die von Palmen und Apfelwiesen im Tal über urige -

Gefahrenzonenplanung Piani Delle Zone Di Pericolo
Gefahrenzonenplanung Piani delle Zone di Pericolo Prettau Predoi Ahrntal Valle Aurina Pfitsch Brenner Val di Vizze Sand in Taufers Brennero Campo Tures Sterzing Mühlwald Vipiteno Selva dei Molini Vintl Ratschings Vandoies Racines Freienfeld Terenten Gais Rasen-Antholz Moos in Passeier Mühlbach Campo di Trens Terento Gais Rasun Anterselva Moso in Passiria Rio di Pusteria Pfalzen Gsies Falzes Percha Valle di Casies Kiens Bruneck Perca Brunico Franzensfeste Chienes St.Leonhard in Pass. Graun im Vinschgau Fortezza Rodeneck S.Leonardo in Passiria Rodengo Welsberg-Taisten Curon Venosta St.Lorenzen St.Martin in Passeier Natz-Schabs Monguelfo-Tesido S.Martino in Passiria S.Lorenzo di Sebato Naz-Sciaves Olang Niederdorf Innichen Riffian Valdaora Villabassa S.Candido Rifiano Vahrn Lüsen Varna Luson Tirol Sarntal Toblach Mals Schnals Schenna Brixen Prags Partschins Tirolo Kuens Sarentino Dobbiaco Malles Venosta Senales Scena Bressanone Braies Sexten Parcines Algund Caines Feldthurns Klausen Enneberg Sesto Lagundo Velturno Chiusa Marebbe St.Martin in Thurn Wengen Meran Hafling S.Martino in Badia Marling Villanders Villnöss La Valle Taufers im Münstertal Schluderns Schlanders Merano Avelengo Naturns Plaus Marlengo Villandro Funes Tubre Sluderno Silandro Naturno Plaus Tscherms Glurns Vöran Lajen Kastelbell-Tschars Cermes Glorenza Verano Barbian Laion Castelbello-Ciardes Lana Barbiano St.Ulrich Prad am Stilfser JochLaas Latsch Burgstall Waidbruck Abtei Lana Ortisei St.Christina in Gröden Prato allo Stelvio Lasa Laces St.Pankraz Postal Ponte Gardena Badia S.Pancrazio Gargazon Mölten S.Cristina Valgardena GargazzoneMeltina Jenesien Wolkenstein in Gröden Corvara Ritten Kastelruth Tisens S.Genesio Atesino Selva di Val Gardena Corvara in Badia Renon Castelrotto Tesimo Terlan Stilfs Nals Terlano Völs am Schlern Stelvio Nalles U.L.Frau i.W.-St.Felix Andrian Fie' allo Sciliar Martell Ulten Martello Senale-S.Felice Andriano Bozen Ultimo Proveis Bolzano Tiers Proves Tires Eppan a.d. -
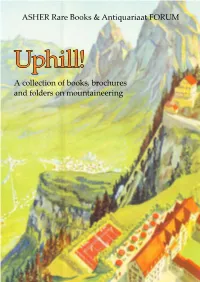
A Collection of Books, Brochures and Folders on Mountaineering ASHER
ASHER Rare Books & Antiquariaat FORUM Uphill! A collection of books, brochures and folders on mountaineering - 1 - UPHILL! A collection of books, brochures and folders on mountaineering [MOUNTAINEERING]. [A collection of brochures and folders on mountaineering]. [Austria and Switzerland, ca. 1920- ca. 1980]. Ca. 653 brochures (including a few duplicates and variant issues). With: [A collection of books relating to mountaineering]. [Various places, ca. 1830- ca. 2000]. Ca. 875 books (including a few duplicates and variant issues, and several multiple-volume titles). Price on request An extensive and wide-ranging collection of brochures, folders and books on climbing, hiking and other subjects related to mountaineering, mainly concerning the Central European mountainous areas. The brochures and folders concentrate on the decisive factor in that far-reaching process: the emergence of tourism. This part of the collection, comprising 653 rare and beautifully designed travel brochures and folders, gives a color- ful and fascinating overview of summer tourism in the central European mountainous areas (mainly the Austrian and Swiss Alps) as it developed beginning in the 1920s: from an exclusive hiking and climbing area for the Europe- an elite during the first half of the 20th century to the very popular and well facilitated commercial centers that we know today. Many of these were designed by well-known poster and other graphic artists such as Herbert Matter (especially interesting for the photomontage techniques used), Hubert Mumelter, Martin Peikert, Franz Stümvoll, Hans Thoni, and contain numerous photographs by leading photographers as well as various panorama's and maps by Josef Rueb, Heinrich Caesar Berann, Max Bieder, Füssli, Wolfgang Hausamann and A. -

Cv Geoanalysis Giovanni Ronzani
Jahr / Abgabe / Provinz / Titel Titolo Gemeinde / comune anno consegna provinca INDAGINE SISMICA (MASW+HVSR) - BOLOGNA Via INDAGINE SISMICA (MASW+HVSR) - BOLOGNA Via Gozzoli civico 4 Gozzoli civico 4 Bologna 2015 05-nov-15 BO INDAGINE SISMICA (MASW+HVSR) - BOLOGNA Via INDAGINE SISMICA (MASW+HVSR) - BOLOGNA Via Solferino civico 42 Solferino civico 42 Bologna 2015 18-dic-15 BO INDAGINE SISMICA (MASW+HVSR) - COMUNE DI INDAGINE SISMICA (MASW+HVSR) - COMUNE DI BOSCO MARENGO (AL) COMPLESSO BOSCO MARENGO (AL) COMPLESSO MONUMENTALE SANTA CROCE MONUMENTALE SANTA CROCE Bosco Marengo 2015 28-apr-15 AL SEISMISCHE UNTERSUCHUNGEN Vs30 INDAGINI SISMICHE Vs30 (MASW+REMI+HVSR) - (MASW+REMI+HVSR) - Fachschule für Scuola professionale per l’economia domestica e Hauswirtschaft und Ernährung agroalimentare Bozen 2015 15-set-15 BZ INDAGINE SISMICA (HVSR) - nel SOTTOSUOLO del INDAGINE SISMICA (HVSR) - nel SOTTOSUOLO del sito in esame localizzato IN PROVINCIA DI sito in esame localizzato IN PROVINCIA DI BELLUNO, BELLUNO, COMUNE DI FELTRE, in Via Lorenzo Luzzo 23, COMUNE DI FELTRE, in Via Lorenzo Luzzo 23, ovvero presso il Museo Civico di Feltre ovvero presso il Museo Civico di Feltre Feltre 2015 22-ott-15 BL REFRAKTIONSSEIMISCHE UNTERSUCHUNGEN - INDAGINI SISMICHE A RIFRAZIONE - Presso l’Hotel Beim Hotel Schönblick in Jenesien Schönblick a San Genesio Jenesien 2015 22-mag-15 BZ SEISMISCHE UNTERSUCHUNGEN Vs30 INDAGINI SISMICHE Vs30 (REMI+HVSR) - Località (REMI+HVSR) - Lokalität St.Jakob -Grundschule San Giacomo - Scuola elementare Leifers 2015 15-set-15 BZ SEISMISCHE -

Ergebnislisten-Landeswintersporttag
Landerwintersporttag der Jäger-innen 2020 Riesentorlauf OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE Rang Stnr Teilnehmer JG Verein Total Diff Jägerinnen 1. 1 .................. BERGMEISTER Antonia 63 VINTL 48,17 2. 2 .................. OBERHAMMER Karin 65 INNICHEN 1:10,19 22,02 Jäger 1950 und älter 1. 7 .................. PRANTL Karl 50 DORF TIROL 46,94 2. 9 .................. TAVELLA Guido 46 ABTEI BADIA 47,28 0,34 3. 8 .................. ELLECOSTA Filippo 49 ENNEBERG 47,94 1,00 4. 5 .................. TROJER Erich 48 VIERSCHACH WINNEBACH 48,49 1,55 5. 3 .................. STECHER Helmut 40 GRAUN IM VINSCHGAU 52,30 5,36 Jäger 1951 bis 1961 1. 10 .................. LERCHNER Martin 59 KIENS 43,13 2. 12 .................. TROJER Josef 53 VIERSCHACH WINNEBACH 44,55 1,42 3. 97 .................. MOSER Stefan 59 PRAGS 45,45 2,32 4. 30 .................. PFITSCHER Ubald 53 OBERMAIS 45,56 2,43 5. 25 .................. PRUGGER Dieter 60 OLANG 45,91 2,78 6. 29 .................. MAIRHOFER Peter 61 TAISTEN 46,25 3,12 7. 18 .................. STEINMAYR Hubert 53 ST. MARTIN GSIES 47,58 4,45 8. 31 .................. ERLACHER Peter 59 ST. MARTIN IN THURN 47,84 4,71 9. 21 .................. PUTZER Josef 59 PRAGS 48,21 5,08 10. 28 .................. MATHA Christian 61 TERLAN 48,83 5,70 11. 33 .................. SCACCHETTI Luciano 56 OLANG 48,91 5,78 12. 20 .................. KLOTZ Andreas 55 ST. PANKRAZ ULTEN 49,01 5,88 13. 26 .................. MERANER Karlheinz 59 EPPAN 49,92 6,79 14. 14 .................. PÖRNBACHER Peter 56 OLANG 50,39 7,26 15. 16 .................. SULZENBACHER Gustav 59 VIERSCHACH WINNEBACH 50,64 7,51 16. 24 .................. STÜRZ Josef 55 ALDEIN 51,08 7,95 17. -

South Tyrol in Figures
South Tyrol in figures 2015 AUTONOME PROVINZ PROVINCIA AUTONOMA BOZEN - SÜDTIROL DI BOLZANO - ALTO ADIGE Landesinstitut für Statistik Istituto provinciale di statistica AUTONOMOUS PROVINCE OF SOUTH TYROL Provincial Statistics Institute General preliminary notes SIGNS Signs used in the tables of this publication: Hyphen (-): a) the attribute doesn’t exist b) the attribute exists and has been collected, but it doesn’t occur. Four dots (….): the attribute exists, but its frequency is unknown for various reasons. Two dots (..): Value which differs from zero but doesn’t reach 50% of the lowest unit that may be shown in the table. ABBREVIATIONS Abbreviations among the table sources: ASTAT: Provincial Statistics Institute ISTAT: National Statistics Institute ROUNDINGS Usually the values are rounded without considering the sum. Therefore may be minor differences between the summation of the single values and their sum in the table. This applies mainly to percentages and monetary values. PRELIMINARY AND RECTIFIED DATA Recent data is to be considered preliminary. They will be rectified in future editions. Values of older publications which differ from the data in the actual edition have been rectified. © Copyright: Autonomous Province of South Tyrol Provincial Statistics Institute - ASTAT Bozen / Bolzano 2015 Orders are available from: ASTAT Via Kanonikus-Michael-Gamper-Str. 1 I-39100 Bozen / Bolzano Tel. 0471 41 84 04 Fax 0471 41 84 19 For further information please contact: Statistische Informationsstelle / Centro d’informazione statistica Tel. 0471 41 84 04 The tables of this publication are www.provinz.bz.it/astat also to be found in internet at www.provincia.bz.it/astat E-mail: [email protected] [email protected] Reproduction and reprinting of tables and charts, even partial, is only allowed if the source is cited (title and publisher). -

South Tyrol in Figures
South Tyrol in figures 2019 AUTONOME PROVINZ PROVINCIA AUTONOMA BOZEN - SÜDTIROL DI BOLZANO - ALTO ADIGE Landesinstitut für Statistik Istituto provinciale di statistica AUTONOMOUS PROVINCE OF SOUTH TYROL Provincial Statistics Institute General preliminary notes SIGNS Signs used in the tables of this publication: Hyphen (-): a) the attribute doesn’t exist b) the attribute exists and has been collected, but it doesn’t occur. Four dots (….): the attribute exists, but its frequency is unknown for various reasons. Two dots (..): Value which differs from zero but doesn’t reach 50% of the lowest unit that may be shown in the table. ABBREVIATIONS Abbreviations among the table sources: ASTAT: Provincial Statistics Institute ISTAT: National Statistics Institute ROUNDINGS Usually the values are rounded without considering the sum. Therefore may be minor differences between the summation of the single values and their sum in the table. This applies mainly to percentages and monetary values. PRELIMINARY AND RECTIFIED DATA Recent data is to be considered preliminary. They will be rectified in future editions. Values of older publications which differ from the data in the actual edition have been rectified. © Copyright: Autonomous Province of South Tyrol Provincial Statistics Institute - ASTAT Bozen / Bolzano 2019 Orders are available from: ASTAT Via Kanonikus-Michael-Gamper-Str. 1 I-39100 Bozen / Bolzano Tel. 0471 41 84 04 Fax 0471 41 84 19 For further information please contact: Statistische Informationsstelle / Centro d’informazione statistica Tel. 0471 41 84 04 The tables of this publication are https://astat.provinz.bz.it also to be found online at https://astat.provincia.bz.it E-mail: [email protected] [email protected] Reproduction and reprinting of tables and charts, even partial, is only allowed if the source is cited (title and publisher).