5 Auswertung
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Preise Saarland + Westpfalz
UNSERE WERBEGEBIETE SAARLAND + WESTPFALZ Birkenfeld Kusel Wadern Freisen Perl St. Wendel Merzig Kaiserslautern SAARLAND + WESTPFALZ Saarlouis Saarbrücken Blieskastel Zweibrücken Pirmasens Hauenstein Gersheim Mit den Individualzeitschriften werben Sie gezielt auf den von Ihnen gewählten Publikumszeitschriften im Saarland und der Westpfalz. 7.000 Abonnenten 4.600 Abonnenten 3.500 Abonnenten 2.300 Abonnenten 1.200 Abonnenten (= 91.300 Leser) (= 60.000 Leser) (= 45.700 Leser) (= 30.000 Leser) (= 15.700 Leser) erreichen Sie mit einer der erreichen Sie mit einer der erreichen Sie mit einer der erreichen Sie mit einer der erreichen Sie mit einer der folgenden Zeitschriften: folgenden Zeitschriften: folgenden Zeitschriften: folgenden Zeitschriften: folgenden Zeitschriften: ADAC Reisemagazin Bild der Frau Eat Smarter Brigitte Autobild Allrad Bunte brandeins Elle Der Spiegel Das Goldene Blatt Elle Decoration Brigitte Woman Focus Frau im Trend Echo der Frau Instyle Cosmopolitan Für Sie Glamour Essen & Trinken Stern Fit for Fun Garten Flora Harpers Bazaar GQ Wohnen & Garten Frau im Spiegel Lisa Joy Jolie Freizeit Revue Mein schönes Land Living at home Mein schöner Garten Freundin Meine Familie & Ich Myself Neue Post Gala Neue Welt Psychologie heute Schöner Wohnen Good Health Petra Reisemobil Tina Shape Zeit Wissen Spektrum der Wissenschaft Sport Bild Vital Zuhause Wohnen INDIVIDUALZEITSCHRIFTEN WERBEGEBIET SAARLAND + WESTPFALZ PREISE INDIVIDUALZEITSCHRIFTEN Werbefläche Preis pro 1.000 Abonnenten Außenseiten (U1+U4) 175,00 €/Tsd. Innenseiten (U2+U3) -

Edigna Menhard Tilo Treede Von Der Idee Bis Zur Vermarktung UVK
Edigna Menhard Tilo Treede Von der Idee bis zur Vermarktung UVK Verlagsgesellschaft mbH Praktischer Journalismus Band 57 Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar. ISSN 1617-3570 ISBN 3-89669-413-8 © UVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz 2004 UVK Verlagsgesellschaft mbH Schützenstr. 24 · D-78462 Konstanz Tel.: 07531-9053-0 · Fax: 07531-9053-98 www.uvk.de Kapitel 1: Die Zeitschrift Glitzer und Glamour, Fakten und Faszination, Information und Unterhaltung, Bilder und interessante Geschichten – daran denken die meisten, wenn sie über Zeitschriften nachsinnen. Die Welt der Zeitschriften übt auf fast jeden eine außergewöhnliche Faszination aus. Kein Wunder: Die verschiedensten Hefte buhlen mit schillernden Titelbildern und reißerischen Schlagzeilen um die Auf- merksamkeit der Leser. Es gibt kaum ein Themengebiet, dem sich nicht ein Heft ausführlich widmen würde: Die trendbewusste Frau kann sich zwischen Dutzenden von Modezeitschriften entscheiden, politisch Interessierte werden von Nachrichtenmagazinen auf dem Laufenden gehalten, für den Bodybuilder gibt es eine spezielle Zeitschrift, ebenso für den passionierten Sportfischer. Das Interesse an Zeitschriften ist groß. Jeden Monat gehen Millionen Hefte über den Ladentisch und werden an Abonnenten verschickt. Diesem Interesse der Leserschaft steht allerdings ein sehr spärliches Wissen auf der Forschungs- seite entgegen. Die Zeitschriftenforschung wurde bislang unverhältnismäßig stark vernachlässigt. Während die Zeitung im Mittelpunkt zahlreicher wissen- schaftlicher Untersuchungen stand, beschäftigten sich nur wenige Wissenschaft- ler mit der schwierigen und unüberschaubar breiten Gattung der Zeitschriften. Zudem erschien es den Forschern wichtiger herauszufinden, wie Tageszeitun- gen mit ihrer aktuellen politischen Berichterstattung die öffentliche Meinung beeinflussen, und nicht, welche Rolle Zeitschriften dabei spielen. -

Stafette-Lesezirkel, Im Engelfeld 16, 87509 Immenstadt Telefon 08323/6068 – Fax 08323/8610 - [email protected]
Im Engelfeld 16, 87509 Immenstadt Tel. 08323/6068, Fax 08323/8610 E-Mail: [email protected] www.stafette-lesezirkel.de Zeitschriften mieten statt kaufen! 5 Zeitschriften für nur € 8,00 Sie wählen aus unserem Angebot: fünf Wochenzeitschriften und eine Monatszeitschrift oder vier Wochenzeitschriften zwei 14-tägige Titel und eine Monatszeitschrift Sämtliche Hefte sind aktuell und ungelesen. Ihre Vorteile auf einen Blick: ➢ neue Zeitschriften ➢ hohe Kostenersparnis ➢ freie Auswahl ➢ Sortiment kann jederzeit geändert werden ➢ inkl. Zustellkosten und Mehrwertsteuer ➢ Preisgarantie für 24 Monate ➢ Lesevergnügen für jedes Alter Ihre Lieblingszeitschrift ist nicht in ist nicht in unsere Auswahl aufgeführt? Dann sprechen Sie uns gerne auf Ihre Wunschzeitschrift an. NEU: Ab sofort erhalten Sie bei uns auch die beliebte Zeitschrift „Die Allgäuerin“ für nur € 0,50 Aufpreis wöchentlich. Stafette-Lesezirkel, Im Engelfeld 16, 87509 Immenstadt Telefon 08323/6068 – Fax 08323/8610 www.stafette-lesezirkel.de - [email protected] Alle Zeitschriften im Überblick Stand 04/19 wöchentlich: Auto Bild Focus Money IN – das Starmagazin Bild der Frau Frau Aktuell Laura Bunte Frau im Spiegel Lea Das neue Blatt Frau im Trend Lisa Der Spiegel Freizeit-Revue Neue Post Die Aktuelle Gala Neue Welt Echo der Frau Grazia Sport Bild Focus Hörzu Stern alle 14 Tage: auto-motor-sport Freundin Micky Maus Auto-Zeitung Für Sie TVdirekt nachstehende Zeitschrift wünsche ich mir 1 x monatlich: Abenteuer Reisen (10 x jährl.) Fit for Fun National Geographic Alpin GEO Ökotest Bild der Wissenschaft GEOlino (13 x jährl.) PM Brigitte Woman GEO Saison Petra (10 x jährl.) Capital GQ Playboy CHIP (ohne DVD) InStyle Schöner Wohnen CHIP Foto-Video (ohne DVD) LandIDEE (6 x jährl.) Spektrum d. -
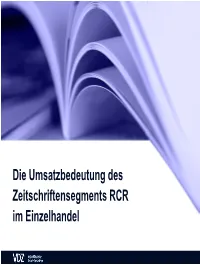
RCR Im Einzelhandel RCR – Ein Starkes Sortiment! Vorwort
Die Umsatzbedeutung des Zeitschriftensegments RCR im Einzelhandel RCR – Ein starkes Sortiment! Vorwort Der Pressevertrieb will den Dialog mit Ihnen! sofern Sie Fragen haben, stellen Sie diese bitte während der Präsentation! Projektgruppe Romane Comics Rätsel im VDZ 2 RCR – Ein starkes Sortiment! Agenda des heutigen Meetings Präsentation zum Thema RCR » Was ist RCR und welche Verlage / Vertriebe stecken dahinter? » Warum gibt es eine Projektgruppe RCR? » Was sind die Ziele? » Wie groß ist die Umsatzbedeutung des RCR-Segmentes für den Handel? » Was sind Koppelkaufanalysen und welchen Nutzen bringen sie für die tägliche Arbeit? » Wie können Sie im RCR-Segment zusätzliche Umsätze generieren? Präsentation moderner Regalsysteme und Warenträger Gemeinsame Diskussion Projektgruppe Romane Comics Rätsel im VDZ 3 RCR – Ein starkes Sortiment! I Wofür steht der Begriff RCR? • Romane ./;I • Comics - -- _../ ~ ~. -~ ~ ""'"""""=== . • Rätsel -- -- ./ Projektgruppe Romane Comics Rätsel im VDZ 4 RCR – Ein starkes Sortiment! I Welche Verlage / Vertriebe stecken hinter RCR? ••••• BASTEI LrJBBE asv vertriebs gmbh SPECIAL·INTERESTI Ein Unte rne hme n d e r Axe l Springe r AG A.,.. Deutscher Rätselverlag RA MEDIENGRUPPE Zeitschriftenvertrieb ~ KLAMBT Moderner Zeitschriften Vertrieb Projektgruppe Romane Comics Rätsel im VDZ 5 RCR – Ein starkes Sortiment! Warum gibt es eine Projektgruppe RCR? Besonderheiten die nur bei RCR auftreten: • RCR lebt fast nur von Vertriebserlösen • Fast keine Anzeigenerlöse Daraus resultierend: • Notwendigkeit einer optimalen Präsentation -

Zeitschriftenmarkt: WAZ- Derzeit Bilden 1 536 Periodika Das Sortiment Der Weniger IVW- Publikumspresse (Stand: Ende März 2010; Vgl
media perspektiven 6/2010 x296 ................................................................................................................................................................ wie vor gilt: Publikumszeitschriften müssen zuerst Daten zum Markt und zur Konzentration der und aus sich heraus ihre Leser überzeugen. Darauf Publikumspresse in Deutschland im I. Quartal 2010 sind ihre Konzepte auszurichten. U Zeitschriftenmarkt: WAZ- Derzeit bilden 1 536 Periodika das Sortiment der Weniger IVW- Publikumspresse (Stand: Ende März 2010; vgl. Ta- gemeldete Titel, mehr Gruppe schließt zu dominie- belle 2). Titel, die mindestens 14-täglich erscheinen, Sonderpublikationen haben hierunter einen Anteil von knapp 9 Prozent. und Extra-Reihen renden Konzernen auf Diese Zeitschriften sind zu rund 78 Prozent der Von Andreas Vogel* IVW-Auflagenkontrolle gemeldet. Die Zahl der sel- tener erscheinenden Hefte nahm auch in den letz- Publikumspresse Auch im Jahr 16 des öffentlichen WWW zeigt sich ten beiden Jahren weiter zu. Weil aber die Zahl der nach wie vor die deutsche Publikumspresse quicklebendig. Weder IVW-gemeldeten Titel erstmals im Zweijahresver- mit breitem gab es im Sortiment das prognostizierte Massen- gleich stagniert, sinkt ihre Meldequote auf knapp Titelsortiment sterben der Titel – selbst von Bereinigungen im 32 Prozent. Die deutschen Verlage experimentieren Markt kann man nicht ernsthaft sprechen – noch verstärkt mit Sonderheften und Extra-Reihen rund bleiben die Neugründungen aus. Im Gegenteil: Der um ihre Stammobjekte. Die Verkaufsauflagen die- Trend zum immer breiteren Angebot hält unver- ser Publikationen können durch die IVW generell mindert an. Einige Fachbeobachter sehen 2010 gar nicht erfasst werden. Insofern leidet die Transpa- eine Renaissance der Zeitschriftengründungen. Doch renz des Gesamtmarktes im Jahr 2010 doppelt: das trifft nicht zu – seit 1990 finden jedes Jahr unter der rückläufigen Bereitschaft zur IVW-An- durchschnittlich 130 neue Periodika den Weg an meldung und unter der Flut von nichtperiodischen die Kioske. -

Women's Magazines in Germany a Market Overview
Women’s magazines in Germany A market overview A service of Gruner + Jahr AG & Co August 2003 Women’s magazines in Germany Presentation outline ● Market segmentation ● Selected key facts of the quality magazine market ● Detailed illustration of the magazine categories G+J International Ad Sales 22.08.2003 2 Market segmentation Identification of different magazine categories The publishers of Germany’s women’s magazines Market shares Market overview: obviously a highly competitive field. Segmentation by frequency Total market 2002*: 51 women´s magazines with over 100,000 copies sold weeklies (31 titles) Neue Woche Frau mit Herz Schöne Woche Gala Freizeit Revue Tina Glücks Revue Welt der Frau Avanti Heim und Welt Woche der Frau Bella Laura Vida Bild der Frau Burda Moden Lea Viel Spaß Das Goldene Blatt Frau im Leben Lisa 7 Tage Das Neue Cosmopolitan Maxi Mach mal Pause Das Neue Blatt Elle Ratgeber Frau u. Fam. Mini Die Aktuelle Madame Neue Post Die Neue Frau Marie Claire Neue Welt Echo der Frau Petra InStyle Frau aktuell Vogue Glamour*** Frau im Spiegel Brigitte Allegra Freundin Amica Für Sie Joy Journal Young Miss (Woman)** monthlies (16 titles) ***Glamour is now fortnightly fortnightlies (since April 2003) (5 titles) ** WOMAN launched 10/2002, in 2002 not yet IVW audited *All women‘s titles with circulation audited by IVW AND larger than 100,000 copies sold AND listed in ACNielsen 2002; bold = G+J-magazines G+J International Ad Sales 22.08.2003 4 Second market overview: broad editorial categories still do not help much. Segmentation by frequency and editorial characteristics Segmentation Key Facts Illustration Weekly Monthly Fortnightly (31 titles) (16 titles) (5 titles) Entertaining/advisory Advisory Established Young Classics Avanti Lisa Burda Mode Cosmopolitan Allegra Brigitte Bella Mach mal P. -

Dear Subscriber, We Trust This Letter Finds You Well During These
Dear Subscriber, We trust this letter finds you well during these challenging times. With restrictions slowly starting to lift across the country we can now start to get outside and enjoy the nice weather! As always, we want to thank you for subscribing to your favorite magazine or newspaper through us. As we have communicated before, our flights from Germany remain uninterrupted and our facilities are open to process your subscriptions and induct into the Buffalo, NY Post Office. If there is any change we will communicate directly through our websites and newsletters. We also have good news for all our subscribers. We are pleased to announce the following: 1. While the air cargo rates have dramatically increased due to the COVID-19 pandemic we have decided to hold our subscription rates through 2020 for all renewals. We appreciate your loyalty and understand these are difficult times for everyone. 2. We are now offering 1st Class and/or Priority Mail subscriptions for all of our magazines and newspapers. This may be of interest to those that subscribe to our collection of weekly titles. Please see our list of titles and prices below along with USPS estimated delivery times. 3. On-line Invoice Payment – Our subscription management partner Roltek International Inc. is also pleased to announce you can now conveniently pay for your subscription directly on-line at www.roltek.com/checkout with either Visa or MasterCard. We thank you for your understanding during this challenging time. Please stay safe and healthy. Sincerely, The Teams at Cover-All, Data Media and Roltek. -

Bestellformular Kleine Wunschmappe
Im Engelfeld 16, D-87509 Immenstadt Tel. +49 (0)8323/6068, Fax +49 (0)8323/8610 E-Mail: [email protected] www.schweizer-lesezirkel.ch Zeitschriften mieten statt kaufen! 5 Zeitschriften für nur CHF 14,50 Sie wählen aus unserem Angebot: fünf Wochenzeitschriften und eine Monatszeitschrift oder vier Wochenzeitschriften zwei 14-tägige Titel und eine Monatszeitschrift Sämtliche Hefte sind aktuell und ungelesen. Ihre Vorteile auf einen Blick: ➢ neue Zeitschriften ➢ hohe Kostenersparnis ➢ freie Auswahl ➢ Sortiment kann jederzeit geändert werden ➢ inkl. Zustellkosten ➢ Preisgarantie für 24 Monate ➢ Lesevergnügen für jedes Alter Schweizer Lesezirkel, Im Engelfeld 16, D-87509 Immenstadt Telefon +49 (0)8323/6068 – Fax +49 (0)8323/8610 www.schweizer-lesezirkel.ch - [email protected] Alle Zeitschriften im Überblick Stand 03/20 wöchentlich: Auto Bild Focus Money IN – das Starmagazin Bild der Frau Frau Aktuell Laura Bunte Frau im Spiegel Lea Das neue Blatt Frau im Trend Lisa Der Spiegel Freizeit-Revue Neue Post Die Aktuelle Gala Neue Welt Echo der Frau Grazia Sport Bild Focus Hörzu Stern alle 14 Tage: auto-motor-sport Freundin Micky Maus Auto-Zeitung Für Sie nachstehende Zeitschrift wünsche ich mir 1 x monatlich: Alpin Fit for Fun National Geographic Bild der Wissenschaft GEO Ökotest Brigitte Woman GEOlino (13 x jährl.) Petra (10 x jährl.) Capital GEO Saison Playboy CHIP (ohne DVD) GQ Schöner Wohnen CHIP Foto-Video (ohne DVD) InStyle Spektrum d. Wissenschaft Cosmopolitan LandIDEE (6 x jährl.) Sport Auto ELLE Living at Home Vital (11 x jährl.) Eltern Madame Vogue Eltern Family Mein schöner Garten Winnie Puuh (10 x jährl.) Essen & Trinken Men’s Health (10 x jährl.) Wohnen & Garten Feinschmecker Mountainbike Zuhause Wohnen (11 x jährl.) Die Bestellung gilt ab _______________. -

Bachelorarbeit Laura Sold 2015.Pdf
BACHELORARBEIT Frau Laura Sold Interkultureller Vergleich von japanischen und deutschen Modemagazinen 2014 Fakultät: Medien BACHELORARBEIT Interkultureller Vergleich von japanischen und deutschen Modemagazinen Autor/in: Frau Laura Sold Studiengang: Angewandte Medien Seminargruppe: AM11wK1-B Erstprüfer: Prof. Dr. Volker J. Kreyher Zweitprüfer: Dr. Eckehard Krah Einreichung: Mannheim, 21. Januar 2015 Faculty of Media BACHELOR THESIS Intercultural comparison be- tween Japanese and German fashion magazines author: Ms. Laura Sold course of studies: Applied Media seminar group: AM11wK1-B first examiner: Prof. Dr. Volker J. Kreyher second examiner: Dr. Eckehard Krah submission: Mannheim, January 21, 2015 Bibliografische Angaben Sold, Laura: Interkultureller Vergleich von japanischen und deutschen Modemagazinen Intercultural comparison between Japanese and German fashion magazines 44 Seiten, Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences, Fakultät Medien, Bachelorarbeit, 2014 Abstract Diese wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit dem Vergleich von japanischen und deutschen Modezeitschriften. Ziel der Arbeit ist es, Erkenntnisse aus dem Vergleich zu ziehen und zu beobachten, wie sich der Trend der Schönheitsideale und der Modema- gazine in Zukunft verändern wird. Mit einer theoretischen Einleitung, einem Praxisbei- spiel und Expertenbefragungen wird die wissenschaftliche Frage dieser Arbeit beantwortet werden. Inhaltsverzeichnis V Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis ..................................................................................................... -

Titelliste Sharemagazines App Stand: Juni 2019
Titelliste sharemagazines App Stand: Juni 2019 Titel 1 11 Freunde 2 5! 3 20 Private Wohnträume 4 A la Carte 5 Abenteuer und reisen 6 AD Russia 7 aerokurier 8 Ahoi! Norderney 9 AJOURE Men 10 AJOURE Women 11 Aktiv Radfahren 12 Aller-Zeitung 13 Alles für die Frau 14 Amateur Photographer 15 Art 16 Art & Décoration 17 ARTE MAGAZIN 18 Astrowoche 19 AUDIO 20 AUDIO TEST 21 AUDIO VIDEO FOTO BILD 22 Australian House & Garden 23 Auszeit 24 Auto Bild 25 Auto motor und sport 26 AUTO Straßenverkehr 27 Auto Zeitung 28 Auto Zeitung Classic Cars 29 AUTOKAUF 30 Automobile 31 Autorevue 32 Avanti 33 B-EAT 34 Backpacker 35 Bad Oeynhousener Kurier 36 Bahn extra 37 Bella 38 Bergische Morgenpost 39 Bergsteiger 40 Bergwelten 41 Berliner Morgenpost 42 Berner Zeitung 43 Bersenbrücker Kreisblatt 44 Better Homes and Gardens Seite 1 von 10 45 Bielefelder Tageblatt Dornberg-Werther Bielefelder Tageblatt mit Oerlinghausen- 46 Leopoldshöhe 47 Bielefelder Tageblatt Ost 48 Bielefelder Tagesblatt Süd 49 Bielefelder Tageblatt West 50 Bikesport 51 BILD der Frau 52 BILD der Frau gut Kochen und Backen 53 Bild der Frau Richtig abnehmen 54 BILD der Frau Schlank und Fit 55 BLONDE 56 Blu-Ray Magazin 57 BOA 58 Bonamea 59 BÖRSE ONLINE 60 Bramscher Nachrichten 61 Bravo 62 Bravo Girl 63 Bravo Sport 64 Bremen Spezial – Bauen & Wohnen & Leben 65 Brigitte 66 Brigitte Wir 67 Brigitte Woman 68 buchLIVE 69 Business Punk 70 Bünder Tagesblatt 71 Capital 72 CAR & HIFI 73 CARAVINING 74 CAVALLO 75 Chefinfo 76 Chefkoch 77 CLEVER CAMPEN 78 Closer 79 COLORFOTO 80 Computer Bild 81 Computer Bild Spiele -

Frauenbilder Und Frauenkonzepte in Den Bulgarischen Frauenzeitschriften
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Frauenbilder und Frauenkonzepte in den bulgarischen Frauenzeitschriften Verfasserin Milena Kohl angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 2013 Studienkennzahl lt. Studienblatt A 243 372 Studienrichtung lt. Studienblatt: Diplomstudium Slawistik / Bulgarisch Betreuerin: Prof. Dr. Ljubka Lipčeva-Prandževa INHALTSVERZEICHNIS 1. Einleitung…………………………………………………………………………………… 4 2. Gender und Medien………………………………………………………………………… 6 3. Frauenzeitschriften………………………………………………………………………… 7 3.1 Auftreten des Begriffs Frauenzeitschrift………………………………………………… 7 3.2 Geschichte und Entwicklung der Frauenzeitschriften – Österreich und Deutschland….. 9 3.3 Geschichte und Entwicklung der Frauenzeitschriften – Bulgarien……………………… 16 3.4 Spezifikation der Frauenzeitschriften……………………………………………………. 21 4. Inhaltsanalyse im Vergleich – „Eva“, „Žurnal za ženata“ und „Bljasăk“……………... 28 4.1 Beschreibung…………………………………………………………………………….. 28 4.2 Titelblatt…………………………………………………………………………………. 30 4.3 Selbstdarstellung ………………………………………………………………………... 34 4.4 Layout……………………………………………………………………………………. 35 4.5 Werbung…………………………………………………………………………………. 37 4.6 Inhalt und Rubriken……………………………………………………………………… 40 4.7 Information und Entertainment………………………………………………………….. 46 4.8 Sprache und Stil………………………………………………………………………….. 48 4.9 Vergleich der vermittelten Frauenbilder………………………………………………… 51 5. Umfrage……………………………………………………………………………………... 54 5.1 Konstruktion und Weise der Durchführung……………………………………………... 54 5.2 Resultate…………………………………………………………………………………. -

Julkaisupohja YTKK
EUROPEAN PUBLISHING MONITOR GERMANY MEDIA GROUP TURKU SCHOOL OF ECONOMICS MARCH 2007 TABLE OF CONTENTS 1 INTRODUCTION.................................................................................... 1 2 EXECUTIVE SUMMARY ...................................................................... 3 3 NEWSPAPER PUBLISHING.................................................................. 7 3.1 Market analysis................................................................................ 7 3.1.1 Definition of the sector ....................................................... 7 3.1.2 Circulation related measures ............................................... 8 3.1.3 Number of titles published ................................................ 14 3.1.4 Revenue related measures ................................................. 19 3.2 Industry structure analysis ............................................................. 24 3.2.1 Number of companies ....................................................... 24 3.2.2 Biggest newspaper publishers ........................................... 24 3.2.3 Employment related measures........................................... 27 3.2.4 Financial measures............................................................ 28 4 MAGAZINE AND PERIODICAL PUBLISHING................................. 35 4.1 Market analysis.............................................................................. 35 4.1.1 Definition of the sector ..................................................... 35 4.1.2 Circulation related measures