Gesellschaftliche Aussteiger Bei Genazino, Kleist Und Kafka
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Frankfurt Dersleri1
Diyalog 2020/ 2: 448-452 (Book Review) Edebiyat Kuramı İçin Vazgeçilmez Kaynak Metinler: Frankfurt Dersleri1 Davut Dağabakan , Ağrı Bir ulusun, bir milletin gelişmesinde fen bilimlerinin olduğu kadar sosyal bilimlerin de önemi büyüktür. Sosyal bilimlere değer vermeyen ülkelerin fen bilimlerinde de gelişim gösteremedikleri görülür. Bu bağlamda sivilize olmuş bir uygarlık, gelişmiş bir toplum düzeyi için edebiyata, felsefeye, sosyolojiye, psikoloji ve antropolojiye değer verilmelidir. Sosyal bilimlerin teorisine, kuramsal çalışmalara, kavram icadına ve anadilde kavram oluşturmaya da dikkat edilmelidir. Söz konusu olan edebiyatsa, sadece şiir yazmaya, edebi ürünler oluşturmaya değil de işin estetik boyutu sayılan poetikaya da değer verilmelidir. Alman edebiyatı Türk edebiyatına binaen edebiyatın ya da başka sosyal bilimlerin estetiğini ve poetikasını şekillendirme bakımından çok erken dönemlerde uyanışını gerçekleştirmiştir. Edebiyat kuramı bakımından durumu değerlendirecek olursak Barok döneminde yaşamış Martin Opitz’in „Das Buch von der Deutschen Poeterey“ adlı şiir kuramı ve poetik metni Türk poetikalarından, daha doğrusu sistematik poetikasından beş yüz sene daha önce yazılmıştır. Bu bilinçlenme, bir uygarlığın sadece edebi eserlerle ilgilenmesini değil de edebi eylemin estetiğini ve poetikasını sistematik bir şekilde gerçekleştirme ahlakını da sunar o millete. Bu da her tür sosyal bilimler alanında derinlikli düşünmeyi sağlar. Sadece edebiyatın bir alt dalı olan şiir kuramı alanında değil, örneğin mimarinin poetikasında ya da bir çayın, kahvenin, bir mekânın poetikasında eşyaya nüfuz ve olgulara derinlikli bakma kudreti de böylelikle bu tür eserlerle sağlanmış olur. Erken başlayan Alman poetikası eylemleri çağlar boyu sistematik poetikalarla devam etmiş son asırda Goethe Üniversitesi, Frankfurt’ta 1959 yılında edebiyata, edebiyatın sorunlarına ve gelişimine ilgi duyacak öğrencilere (öğrenciler indinde aslında herkese) bir imkân sunmak amacıyla Frankfurt Dersleri’ni başlatmıştır. -

Inhaltsverzeichnis
3 Inhaltsverzeichnis Die Lernbereiche des neuen sächsischen Lehrplans und Hiroshima Marie Luise Kaschnitz . 28 ihre Umsetzung in »Unser Lesebuch 10« . 5 Kriegslied Matthias Claudius . 31 Zur Einführung . 7 Über einige Davongekommene Kulturtechnik Lesen als Voraussetzung und Günter Kunert . 31 Ziel eines modernen Literaturunterrichts . 7 Tagesbefehl Robert Gernhardt . 31 Literaturunterricht im fachübergreifenden Verbund . 7 4»Verstehen und verurteilen« Ziele für den Lernbereich: Umgang mit Texten . 8 Erzählte Zeit in der deutschen Nachkriegsprosa . 33 Besonderheiten der Jahrgangsstufe 10 . 8 Das siebte Kreuz Anna Seghers . 33 Zu den Handreichungen . 8 Der Vorleser Bernhard Schlink . 36 An der Brücke Heinrich Böll . 39 1»… lass mich in Ruhe, ich will allein sein …« Die Küchenuhr Wolfgang Borchert . 39 Sich behaupten in einer komplizierten Welt . 9 Landnahme Christoph Hein . 41 Jinx Margaret Wild . 9 Knallhart Gregor Tessnow . 11 5 »Die Wette biet ich! Topp! Und Schlag auf Schlag!« Marsmädchen Tamara Bach . 12 Aus Goethes »Faust«-Dichtung . 43 Supergute Tage Mark Haddon . 13 Prolog im Himmel . 44 Der Tragödie erster Teil . 45 2 »Professor Unrat« oder »Der blaue Engel« Der Tragödie zweiter Teil . 48 Eine spannungsreiche Literaturverfilmung . 15 Professor Unrat oder Das Ende eines 6»Die Hand mit dem Streichholz zuckte …« Tyrannen Heinrich Mann . 16 Bücherschicksale – Schicksalsbücher . 51 Und eines Tages griff der Film nach Balzac und die kleine chinesische einem Roman Victor Mann . 18 Schneiderin Dai Sijie . 52 Der blaue Engel Jerzy Toeplitz . 18 Fahrenheit 451 Ray Bradbury . 53 Film und Roman James Monaco . 18 Verbotenes Lesen Alberto Manguel . 56 Romantext und Film im Vergleich . 19 Bei Verbrennung meiner Bücher Filmsprache: Die Einstellung; Erich Kästner . 56 Einstellungsgrößen Werner Kamp, Manfred Rüsel . -

Michael Roes
Institut für Germanistik und Vergleichende Literaturwissenschaft 37. Paderborner Gastdozentur für Schriftstellerinnen und Schriftsteller im Wintersemester 2018/2019 Michael Roes: Melancholie des Reisens Themen und Termine - montags, 16.15-17.45 Uhr, in Hörsaal G - 03.12.2018 Auftaktlesung: Vom Reisen (Rub’ al-Khali, Haut des Südens, Weg nach Timimoun) 10.12.2018 Erste Vorlesung: Kains Grab. Aden 2009/2010 17.12.2018 Zweite Vorlesung: Hinter den Mauern liegt die Stadt. Kabul 2012 07.01.2019 Dritte Vorlesung: Frühlings Erwachen. Tanger 2013 14.01.2019 Abschlusslesung: Herida Duro (Roman, 2018) Zur Einführung Im Schnittfeld von Kulturtheorie, Ethnographie und ästhetischem Formungswillen erkundet Michael Roes seit den 1990er Jahren in Prosa, Drama und Film auf ganz eigentümliche Weise das Verhältnis von Oberfläche und Tiefe, Wahrnehmbarkeit und Erzählbarkeit. Ausgedehnte Forschungsreisen in auch entlegene Teile der Welt bil- den den Humus eines immensen Werkes, das sich in immer neuen Facetten dem Fremden und anderen Kulturen annähert, ohne dabei einem selbstbezüglichen inter- kulturellen Enthusiasmus in die Falle zu gehen und die Fremde bzw. das Fremde durch die eigene Faszination lediglich zu besetzen. Michael Roes ist ein Grenzgänger im ganz unmittelbaren Sinn, ein Grenzgänger zwi- schen den Sprachen und Kulturen; er ist ein Grenzgänger vor allem auch zwischen den Medien und Gattungen, zwischen Literatur/Drama, Film und Wissenschaft, der sich nicht nur mit Fragen von Rasse, Geschlecht und der Konstruktion des Fremden und Anderen auseinandersetzt, sondern auch mit dem Geltungsanspruch wissen- schaftlicher Literatur. Dabei verwischt Roes immer wieder souverän die Grenzen zwischen Wissenschaft und Literatur und stellt immer wieder aufs Neue die unwider- sprochene Logik und Evidenz unserer Wirklichkeitswahrnehmung und das heißt auch der unwidersprochenen Sprachwerdung der Welt in Frage. -

Informationen Zu Seinen Büchern Und Zur Person (PDF)
KlausKlaus HübnersHübners TetralogieTetralogie KeinKein Twitter,Twitter, keinkein FacebookFacebook VonVon Menschen,Menschen, BüchernBüchern undund BildernBildern Klaus Hübner HIPPIES, PRINZEN UND ANDERE KÜNSTLER Kein Twitter, kein Facebook Von Menschen, Büchern und Bildern Band 1 Außer der Reihe 41 p.machinery, Winnert, März 2020, 264 Seiten Paperback: ISBN 978 3 95765 189 1 EUR 18,90 (DE) Hardcover: ISBN 978 3 95765 190 7 EUR 27,90 (DE) E-Book: ISBN 978 3 95765 897 5 EUR 9,49 (DE) Der erste Band versammelt Arbeiten zur deutsch- Asfa-Wossen Asserate • Zsuzsa Bánk • Artur Be- sprachigen Literatur seit den 1960er-Jahren. cker • Jürgen Becker • Maxim Biller • Marica Bo- Man lernt einen seriösen Hippie kennen, einen drožić • Silvia Bovenschen • Günter de Bruyn • äthiopischen Prinzen, einen masurischen Berser- Hans Christoph Buch • Zehra Çirak • György Da- ker, einen tuwinischen Schamanen, eine bulgari- los • Friedrich Christian Delius • Akos Doma • sche Berlinerin, einen Münchner aus Teheran Hans Magnus Enzensberger • Wilhelm Genazino • und einen wunderbaren Lyriker aus Luxemburg. Nino Haratischwili • Abbas Khider • Hermann Dazu preußische Heimatkunde, Robinson und Kinder • Wulf Kirsten • Gerhard Köpf • Jean Freitag auf Hiddensee, Fallobst aus Schwabing, Krier • Reiner Kunze • Rainer Malkowski • Olga mehrere Windhunde und einiges mehr. Martynova • Terézia Mora • Matthias Nawrat • Selim Özdogan • José F. A. Oliver • Lothar Quin- kenstein • Ralf Rothmann • Eugen Ruge • SAID • Hans Joachim Schädlich • Jochen Schim- mang • Lutz Seiler • Tzveta -

Einführung in Die Empfehlungsliste Für Die Gymnasien
Einführung in die Empfehlungsliste für die Gymnasien Die folgende Lektüreliste knüpft an die allen Schularten gemeinsame Autorenliste an. Die Autorenliste soll die Schülerinnen und Schüler mit Schriftstellerinnen und Schrift- stellern „bekannt" machen, die das kulturelle Gedächtnis der Lesegemeinschaft ausmachen. Dagegen versteht sich die folgende Lektüreliste als eine didaktische Unterstützung für Lehrerinnen und Lehrer und empfiehlt Werke, die im Unterricht gewinnbringend gelesen werden können. Dabei werden die in der Autorenliste ge- nannten Verfasser an vielen Stellen wieder aufgegriffen. Dort, wo es möglich ist, sind die Titel Themenbereichen oder Lebensbereichen zugeordnet. Dies soll den Lehr- kräften die Auswahl erleichtern, intertextuelle Bezüge zwischen Werken herstellen helfen und die Einbettung in thematische Kontexte anregen. Fortfolgend sollen die aufgeführten Werke kommentiert werden. Diese Empfehlungsliste ist offen für Kor- rekturen, Ergänzungen sowie Aktualisierungen, besonders im Bereich der Gegen- wartsliteratur, denn dort sind der literarische Wert und die Anerkennung von Titeln einem schnellen Wandlungsprozess ausgesetzt. Die empfohlenen Werke sind nicht bestimmten Jahrgangsstufen zugeordnet, doch ist bei ihrer Auswahl die Altersangemessenheit zu berücksichtigen. Kriterien für die Aufnahme eines Werks in das Lektüreverzeichnis sind einerseits die literarische Qualität und andererseits die didaktische Eignung, hier insbesondere die Lesbarkeit, die Thematik und die Förderung der Lesemotivation. Allzu komplexe und umfangreiche Werke kommen ebenso wenig in Frage wie solche, die eine geringe Anschlussmöglichkeit an die Erfahrungswelt der Schülerinnen und Schüler bieten. Mit dieser Lektüreliste sind zwei wesentliche Ziele verbunden: Zum einen sollen die Schülerinnen und Schüler im Lauf ihrer Schulzeit solide literarische Kenntnisse über wichtige Autorinnen und Autoren erwerben, zum anderen sollen sie sich kompetent mit „klassischer“ wie aktueller Literatur auseinander setzen können. -

Berg Literature Festival Committee) Alexandra Eberhard Project Coordinator/Point Person Prof
HEIDELBERG UNESCO CITY OF LITERATURE English HEIDEL BERG CITY OF LITERATURE “… and as Carola brought him to the car she surprised him with a passionate kiss before hugging him, then leaning on him and saying: ‘You know how really, really fond I am of you, and I know that you are a great guy, but you do have one little fault: you travel too often to Heidelberg.’” Heinrich Böll Du fährst zu oft nach Heidelberg in Werke. Kölner Ausgabe, vol. 20, 1977–1979, ed. Ralf Schell and Jochen Schubert et. al., Kiepenheuer & Witsch Verlag, Cologne, 2009 “One thinks Heidelberg by day—with its surroundings—is the last possibility of the beautiful; but when he sees Heidelberg by night, a fallen Milky Way, with that glittering railway constellation pinned to the border, he requires time to consider upon the verdict.” Mark Twain A Tramp Abroad Following the Equator, Other Travels, Literary Classics of the United States, Inc., New York, 2010 “The banks of the Neckar with its chiseled elevations became for us the brightest stretch of land there is, and for quite some time we couldn’t imagine anything else.” Zsuzsa Bánk Die hellen Tage S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2011 HEIDEL BERG CITY OF LITERATURE FIG. 01 (pp. 1, 3) Heidelberg City of Literature FIG. 02 Books from Heidelberg pp. 4–15 HEIDELBERG CITY OF LITERATURE A A HEIDELBERG CITY OF LITERATURE The City of Magical Thinking An essay by Jagoda Marinic´ 5 I think I came to Heidelberg in order to become a writer. I can only assume so, in retro spect, because when I arrived I hadn’t a clue that this was what I wanted to be. -
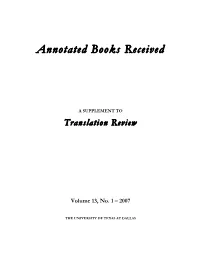
Annotated Books Received
Annotated Books Received A SUPPLEMENT TO Translation Review Volume 13, No. 1 – 2007 THE UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS CONTRIBUTORS Rainer Schulte Christopher Speck DESIGNER Michelle Long All correspondence and inquiries should be directed to: Translation Review The University of Texas at Dallas Box 830688 (JO 51) Richardson TX 75083-0688 Telephone: 972-883-2092 or 2093 Fax: 972-883-6303 E-mail: [email protected] Annotated Books Received, published twice a year, is a supplement of Translation Review, a joint publication of the American Literary Translators Association and The Center for Translation Studies at The University of Texas at Dallas. ISSN 0737-4836 Copyright © 2007 by American Literary Translators Association and The University of Texas at Dallas The University of Texas at Dallas is an equal opportunity/affirmative action employer. ANNOTATED BOOKS RECEIVED 13.1 TABLE OF CONTENTS Arabic .................................................................................................................... 1 Bulgarian................................................................................................................ 5 Chinese .................................................................................................................. 5 Czech ..................................................................................................................... 8 Danish.................................................................................................................... 9 Dutch .................................................................................................................... -

Einführung in Die Empfehlungsliste Für Die Gymnasien
Einführung in die Empfehlungsliste für die Gymnasien Die folgende Lektüreliste knüpft an die allen Schularten gemeinsame Autorenliste an. Die Autorenliste soll die Schülerinnen und Schüler mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern „bekannt" machen, die das kulturelle Gedächtnis der Lesegemeinschaft ausmachen. Dagegen versteht sich die folgende Lektüreliste als eine didaktische Unterstützung für Lehrerinnen und Lehrer und empfiehlt Werke, die im Unterricht gewinnbringend gelesen werden können. Dabei werden die in der Autorenliste genannten Verfasser an vielen Stellen wieder aufgegriffen. Dort, wo es möglich ist, sind die Titel Themenbereichen oder Lebensbereichen zugeordnet. Dies soll den Lehrkräften die Auswahl erleichtern, intertextuelle Bezüge zwischen Werken herstellen helfen und die Einbettung in thematische Kontexte anregen. Fortfolgend sollen die aufgeführten Werke kommentiert werden. Diese Empfehlungsliste ist offen für Korrekturen, Ergänzungen sowie Aktualisierungen, besonders im Bereich der Gegenwartsliteratur, denn dort sind der literarische Wert und die Anerkennung von Titeln einem schnellen Wandlungsprozess ausgesetzt. Die empfohlenen Werke sind nicht bestimmten Jahrgangsstufen zugeordnet, doch ist bei ihrer Auswahl die Altersangemessenheit zu berücksichtigen. Kriterien für die Aufnahme eines Werks in das Lektüreverzeichnis sind einerseits die literarische Qualität und andererseits die didaktische Eignung, hier insbesondere die Lesbarkeit, die Thematik und die Förderung der Lesemotivation. Allzu komplexe und umfangreiche -

Leseprobe 9783442716951.Pdf
Franz Hohler liebt kurze Erzählungen, auch er gilt als »Meister der kleinen Form«. Seit Jahren sammelt er Geschichten, von denen keine länger als eine Seite ist. Seine Sammlung reicht von Epiktet bis Alexander Kluge, von Kurt Schwitters bis Anne Weber, von Thomas Bernhard bis Christine Nöstlinger. Traurige, lustige, anrührende, grotesk zugespitzte und mit viel Hintersinn erzählte Geschichten, denen nicht nur die miniaturhafte Kürze gemeinsam ist. Jede von ihnen entfaltet auf knappstem Raum einen Kosmos, der den Alltag und das gewohnte Leben rasch verblassen lässt und eine viel reichere Welt der Phantasie, des Unwahrscheinlichen und kaum für möglich Gehaltenen zum Vorschein bringt. 113 einseitige Geschichten hat Franz Hohler in diesem Band versammelt – 113 Seiten überraschender und immer wieder von Neuem bezwingender Lesegenuss. Franz Hohler wurde 1943 in Biel, Schweiz, geboren, er lebt heute in Zürich und gilt als einer der bedeutendsten Erzähler seines Landes. Franz Hohler ist mit vielen Preisen ausgezeichnet worden, u.a. erhielt er 2002 den Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor, 2005 den Kunstpreis der Stadt Zürich, 2013 den Solothurner Literaturpreis, 2014 den Alice-Salomon-Preis und den Johann-Peter-Hebel-Preis. 113 einseitige Geschichten herausgegeben von Franz Hohler Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Verlagsgruppe Random -

Autumn 2014 Foreign Rights
FOREIGN RIGHTS AUTU M N 2014 REPRESENTATIVES China (mainland) Hercules Business & Culture GmbH, Niederdorfelden phone: +49-6101-407921, fax: +49-6101-407922 e-mail: [email protected] Hungary Balla-Sztojkov Literary Agency, Budapest phone: +36-1-456 03 11, fax: +36-1-215 44 20 e-mail: [email protected] Israel The Deborah Harris Agency, Jerusalem phone: +972-2-5633237, fax: +972-2-5618711 e-mail: [email protected] Italy Marco Vigevani, Agenzia Letteraria, Milano phone: +39-02-86 99 65 53, fax: +39-02-86 98 23 09 e-mail: [email protected] Japan Meike Marx Literary Agency, Hokkaido phone: +81-164-25 1466, fax: +81-164-26 38 44 e-mail: [email protected] Korea MOMO Agency, Seoul phone: +82-2-337-8606, fax: +82-2-337-8702 e-mail: [email protected] Netherlands LiTrans, Tino Köhler, Amsterdam phone: +31-20- 685 53 80, fax: +31-20- 685 53 80 e-mail: [email protected] Poland Graal Literary Agency, Warszawa phone: +48-22-895 2000, fax: +48-22-895 2001 e-mail: [email protected] Romania Simona Kessler, International Copyright Ageny, Ltd., Bucharest phone: +402-2-231 81 50, fax: +402-2-231 45 22 e-mail: [email protected] Scandinavia Leonhardt & Høier Literary Agency aps, Kopenhagen phone: +45-33 13 25 23, fax: +45-33 13 49 92 e-mail: [email protected] Spain, Portugal A.C.E.R., Agencia Literaria, Madrid and Latin America phone: +34-91-369 2061, fax: +34-91-369 2052 e-mail: [email protected] Stock/Corbis Umschlagmotiv: © Kirn Vintage Foreign Rights Service translated by Ruth Feuchtwanger, -

Heinrich Detering Verleiht Den Kleist-Preis 2015 an Monika Rinck
Universität zu Köln T: 0221 470-1292 (Sekr.) Internationales Kolleg T: 0170-3151010 (priv.) Morphomata (BMBF) [email protected] Albertus-Magnus-Platz 50923 Köln, Deutschland www.heinrich-von-kleist.org DER PRÄSIDENT Prof. Dr. Günter Blamberger Köln, 30.4.2015 PRESSEMITTEILUNG KLEIST-PREIS 2015 Sehr geehrte Damen und Herren, darf ich Sie bitten, folgende Meldung zu verbreiten: Heinrich Detering verleiht den Kleist-Preis 2015 an Monika Rinck Der Kleist-Preis des Jahres 2015 geht an die Berliner Autorin Monika Rinck. Bekannt geworden ist sie durch Lyrik, Prosa und Essays, durch interdisziplinäre wie intermediale Grenzüberschreitungen, die sie als Meisterin aller Tonlagen zeigen. Rincks Registerreichtum ist so stupend wie ihr Witz. Ihre Texte können alles zugleich sein: virtuos und gelehrsam, berührend und pointenreich, humorvoll und melancholisch. Bekannt geworden ist sie durch Lyrikbände wie „zum fernbleiben der umarmung“ (2007), „Helle Verwirrung“ (2009) und „Honigprotokolle“ (2012). Im März 2015 erschien ihre Essaysammlung „Risiko und Idiotie. Streitschriften“, wiederum bei Kookbooks in Berlin. Monika Rincks Werk wurde mehrfach bereits ausgezeichnet, u.a. mit dem Ernst-Meister-Preis 2008, dem Georg-K.- Glaser-Preis 2010, dem Berliner Kunstpreis-Literatur 2012 und dem Peter-Huchel-Preis 2013. Der Kleist-Preis wird Monika Rinck am 22. November 2015 in Berlin während einer Matinée im Berliner Ensemble übergeben, die Claus Peymann inszenieren wird. Die Laudatio hält Heinrich Detering, der Präsident der Deutschen Akademie für -

Doron Rabinovici
30. Paderborner Gastdozentur für Schriftstellerinnen und Schriftsteller im Wintersemester 2011/12 Doron Rabinovici: Manche Menschen kenne ich von später – oder: Was fällt mir eigentlich ein? Schreiben als Erinnerung, Vorstellung und Eigensinn Themen und Termine: (jew. montags, 16.15-17.45 Uhr in Hörsaal G) 05.12.2011 Diesseits und Jenseits von Ohnehin. Auftaktlesung 09.01.2012 Nach Wilna. Oder: Schreiben und Erinnerung 16.01.2012 Das Unerhörte zur Sprache bringen 23.01.2012 Wahrheit oder Pflicht. Schreiben zwischen Lust, Last und Notwendigkeit 30.01.2012 Texte aus Andernorts. Abschlusslesung Mit Witz und Ironie setzt Doron Rabinovici dings weist dabei in Rabinovicis Literatur sich in seinem literarischen Werk immer wie- stets hinaus auf Probleme des Zusammenle- der aufs Neue mit der Dialektik von Erinnern bens in den multiethnischen Industriegesell- und Vergessen, mit der Konstruktion von Ge- schaften. So sind Rabinovicis Figuren – zu- schichte und Vergangenheit, nationaler (Ös- mal in den Romanen Ohnehin (2004) und terreich) und kultureller (jüdischer) Identität Andernorts (2010) – immer auch Repräsen- auseinander. Die Wurzeln von Rabinovicis tanten einer hybriden ‚Migrationsmelange’, ebenso artifiziellem wie unterhaltsamem Er- die Trennendes mischt. Das ‚jüdische‘ The- zählen reichen dabei einerseits zurück bis zu ma, so beschreibt Rabinovici selbst den ‚Ort‘ Leo Perutz und Alfred Kubin, weit in die Tra- seiner Literatur, „berührt die Fragen aller ditionen des Phantastischen und Surrealen Minderheiten überhaupt in unserer multikul-