Volker Hage Letzte Tänze, Erste Schritte
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

UC Davis E-Research
UC Davis E-Research Title Literaturmagazin (Rowohlt): An Index Permalink https://escholarship.org/uc/item/3c32v2rd Author Siegel, Adam P Publication Date 2018-05-16 eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California Literaturmagazin (Rowohlt): An Index Adam Siegel Copyright © 2017 by Adam Siegel Literaturmagazin (Rowohlt) Index / 1 Introduction Am Anfang das Manifesto, a stance that the most conflicted and complex publishing house in West Germany could take without risk of irony: "Für eine neue Literatur - gegen den spätbürgerlichen Literaturbetrieb." Rowohlt Verlag, pioneer of the German paperback, the Manny Farber termite of West German publishing (Suhrkamp, of course, the white elephant). Literaturbetrieb -- typical German summation. Previously, the German Literaturbetrieb had been dominated by Gruppe 47. After the suspension of Gruppe 47, after 1968, the field lay open. Rowohlt's commitment to "die neue Literatur," both in the Literaturmagazin and the companion series Das neue Buch can be read in retrospect as a cultural history of West Germany during the seventies (which we might demarcate as having taken place between the 1972 Munich Olympics and the fall of Helmut Schmidt's government). The Seventies: “Atmosphäre muss gereinigt werden von allen (rechten und linken) Spielarten des Obskurantismus und Opportunismus, von dem Pfaffentum, das heute die marxistische Lehre verwaltet, ebenso wie von der bürgerlichen Feuilletonmafia.”1 Of course Rowohlt continued to publish Literaturmagazin until 2001. As the eighties progressed, the contents remained engagé, but more international. Which is to say, less German. Verlagsprogramme als Geschichte. Let the index serve as narrative. 1 Rundbrief zum Projekt "Literaturmagazin", mit Randbemerkungen von Peter O. -

Frankfurt Dersleri1
Diyalog 2020/ 2: 448-452 (Book Review) Edebiyat Kuramı İçin Vazgeçilmez Kaynak Metinler: Frankfurt Dersleri1 Davut Dağabakan , Ağrı Bir ulusun, bir milletin gelişmesinde fen bilimlerinin olduğu kadar sosyal bilimlerin de önemi büyüktür. Sosyal bilimlere değer vermeyen ülkelerin fen bilimlerinde de gelişim gösteremedikleri görülür. Bu bağlamda sivilize olmuş bir uygarlık, gelişmiş bir toplum düzeyi için edebiyata, felsefeye, sosyolojiye, psikoloji ve antropolojiye değer verilmelidir. Sosyal bilimlerin teorisine, kuramsal çalışmalara, kavram icadına ve anadilde kavram oluşturmaya da dikkat edilmelidir. Söz konusu olan edebiyatsa, sadece şiir yazmaya, edebi ürünler oluşturmaya değil de işin estetik boyutu sayılan poetikaya da değer verilmelidir. Alman edebiyatı Türk edebiyatına binaen edebiyatın ya da başka sosyal bilimlerin estetiğini ve poetikasını şekillendirme bakımından çok erken dönemlerde uyanışını gerçekleştirmiştir. Edebiyat kuramı bakımından durumu değerlendirecek olursak Barok döneminde yaşamış Martin Opitz’in „Das Buch von der Deutschen Poeterey“ adlı şiir kuramı ve poetik metni Türk poetikalarından, daha doğrusu sistematik poetikasından beş yüz sene daha önce yazılmıştır. Bu bilinçlenme, bir uygarlığın sadece edebi eserlerle ilgilenmesini değil de edebi eylemin estetiğini ve poetikasını sistematik bir şekilde gerçekleştirme ahlakını da sunar o millete. Bu da her tür sosyal bilimler alanında derinlikli düşünmeyi sağlar. Sadece edebiyatın bir alt dalı olan şiir kuramı alanında değil, örneğin mimarinin poetikasında ya da bir çayın, kahvenin, bir mekânın poetikasında eşyaya nüfuz ve olgulara derinlikli bakma kudreti de böylelikle bu tür eserlerle sağlanmış olur. Erken başlayan Alman poetikası eylemleri çağlar boyu sistematik poetikalarla devam etmiş son asırda Goethe Üniversitesi, Frankfurt’ta 1959 yılında edebiyata, edebiyatın sorunlarına ve gelişimine ilgi duyacak öğrencilere (öğrenciler indinde aslında herkese) bir imkân sunmak amacıyla Frankfurt Dersleri’ni başlatmıştır. -

Inhaltsverzeichnis
3 Inhaltsverzeichnis Die Lernbereiche des neuen sächsischen Lehrplans und Hiroshima Marie Luise Kaschnitz . 28 ihre Umsetzung in »Unser Lesebuch 10« . 5 Kriegslied Matthias Claudius . 31 Zur Einführung . 7 Über einige Davongekommene Kulturtechnik Lesen als Voraussetzung und Günter Kunert . 31 Ziel eines modernen Literaturunterrichts . 7 Tagesbefehl Robert Gernhardt . 31 Literaturunterricht im fachübergreifenden Verbund . 7 4»Verstehen und verurteilen« Ziele für den Lernbereich: Umgang mit Texten . 8 Erzählte Zeit in der deutschen Nachkriegsprosa . 33 Besonderheiten der Jahrgangsstufe 10 . 8 Das siebte Kreuz Anna Seghers . 33 Zu den Handreichungen . 8 Der Vorleser Bernhard Schlink . 36 An der Brücke Heinrich Böll . 39 1»… lass mich in Ruhe, ich will allein sein …« Die Küchenuhr Wolfgang Borchert . 39 Sich behaupten in einer komplizierten Welt . 9 Landnahme Christoph Hein . 41 Jinx Margaret Wild . 9 Knallhart Gregor Tessnow . 11 5 »Die Wette biet ich! Topp! Und Schlag auf Schlag!« Marsmädchen Tamara Bach . 12 Aus Goethes »Faust«-Dichtung . 43 Supergute Tage Mark Haddon . 13 Prolog im Himmel . 44 Der Tragödie erster Teil . 45 2 »Professor Unrat« oder »Der blaue Engel« Der Tragödie zweiter Teil . 48 Eine spannungsreiche Literaturverfilmung . 15 Professor Unrat oder Das Ende eines 6»Die Hand mit dem Streichholz zuckte …« Tyrannen Heinrich Mann . 16 Bücherschicksale – Schicksalsbücher . 51 Und eines Tages griff der Film nach Balzac und die kleine chinesische einem Roman Victor Mann . 18 Schneiderin Dai Sijie . 52 Der blaue Engel Jerzy Toeplitz . 18 Fahrenheit 451 Ray Bradbury . 53 Film und Roman James Monaco . 18 Verbotenes Lesen Alberto Manguel . 56 Romantext und Film im Vergleich . 19 Bei Verbrennung meiner Bücher Filmsprache: Die Einstellung; Erich Kästner . 56 Einstellungsgrößen Werner Kamp, Manfred Rüsel . -

Michael Roes
Institut für Germanistik und Vergleichende Literaturwissenschaft 37. Paderborner Gastdozentur für Schriftstellerinnen und Schriftsteller im Wintersemester 2018/2019 Michael Roes: Melancholie des Reisens Themen und Termine - montags, 16.15-17.45 Uhr, in Hörsaal G - 03.12.2018 Auftaktlesung: Vom Reisen (Rub’ al-Khali, Haut des Südens, Weg nach Timimoun) 10.12.2018 Erste Vorlesung: Kains Grab. Aden 2009/2010 17.12.2018 Zweite Vorlesung: Hinter den Mauern liegt die Stadt. Kabul 2012 07.01.2019 Dritte Vorlesung: Frühlings Erwachen. Tanger 2013 14.01.2019 Abschlusslesung: Herida Duro (Roman, 2018) Zur Einführung Im Schnittfeld von Kulturtheorie, Ethnographie und ästhetischem Formungswillen erkundet Michael Roes seit den 1990er Jahren in Prosa, Drama und Film auf ganz eigentümliche Weise das Verhältnis von Oberfläche und Tiefe, Wahrnehmbarkeit und Erzählbarkeit. Ausgedehnte Forschungsreisen in auch entlegene Teile der Welt bil- den den Humus eines immensen Werkes, das sich in immer neuen Facetten dem Fremden und anderen Kulturen annähert, ohne dabei einem selbstbezüglichen inter- kulturellen Enthusiasmus in die Falle zu gehen und die Fremde bzw. das Fremde durch die eigene Faszination lediglich zu besetzen. Michael Roes ist ein Grenzgänger im ganz unmittelbaren Sinn, ein Grenzgänger zwi- schen den Sprachen und Kulturen; er ist ein Grenzgänger vor allem auch zwischen den Medien und Gattungen, zwischen Literatur/Drama, Film und Wissenschaft, der sich nicht nur mit Fragen von Rasse, Geschlecht und der Konstruktion des Fremden und Anderen auseinandersetzt, sondern auch mit dem Geltungsanspruch wissen- schaftlicher Literatur. Dabei verwischt Roes immer wieder souverän die Grenzen zwischen Wissenschaft und Literatur und stellt immer wieder aufs Neue die unwider- sprochene Logik und Evidenz unserer Wirklichkeitswahrnehmung und das heißt auch der unwidersprochenen Sprachwerdung der Welt in Frage. -

Arno Geiger Erhält Den Joseph-Breitbach-Preis 2018
akademie der wissenschaften und der literatur mainz Pressemitteilung – 26. April 2018 Arno Geiger erhält den Joseph-Breitbach-Preis 2018 Die Stiftung Joseph Breitbach und die Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz verleihen den Joseph-Breitbach-Preis 2018 an den österreichischen Schriftsteller Arno Geiger. Die Jury zeichnet Arno Geiger für sein literarisches Gesamtwerk aus und hebt besonders sein jüngstes Buch ›Unter der Drachenwand‹ hervor. Darin begegnen sich 1944 am Mondsee »als Treibgut des Weltkrieges ein in Russland verwundeter Soldat, eine Wiener Lehrerin mit ihren aufs Land verschickten Mädchen und eine dem Untergang von Darmstadt entgangene junge Mutter mit ihrem Baby und verharren in einer Art Zeitstillstand vor dem Unter- gang der Welt. Ganz auf den Augenblick und seine Erfordernisse konzentriert, könnte es dem Einzelnen wie seiner Umgebung gelingen, in der Katastrophe den jeweils nächsten Moment zu überleben.« Für die Jury hat »Arno Geigers Meisterschaft der Anverwandlung – bewährt schon bei der Rückgewinnung einer ganzen Epoche in ›Es geht uns gut‹ und in der Reflexion des eigenen Bewusstseins über das fremdgewordene in ›Der alte König in seinem Exil‹ – jetzt in dieser seismographischen Nachzeichnung der letzten Phase des Dritten Reichs und seiner Selbstzerstörung einen neuen Höhepunkt erreicht.« Der Preis ist mit 50.000 € dotiert. Die Verleihung findet am 28. September 2018 im Theater Koblenz statt. Die Laudatio hält der Kritiker und Literaturwissenschaftler Prof. Dr. Franz Haas. Für seine Romane wurde Arno Geiger mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Vorarlberger Literaturstipendium (1999), dem Deutschen Buchpreis (2005), dem Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg (2011), dem Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung (2011), dem Literaturpreis der österreichischen Industrie (2012) und dem Alemannischen Literaturpreis (2017). -

Gesellschaftliche Aussteiger Bei Genazino, Kleist Und Kafka
Wider das System: Gesellschaftliche Aussteiger bei Genazino, Kleist und Kafka by Alexander Fischer A thesis presented to the University of Waterloo in fulfilment of the thesis requirement for the degree of Master of Arts in German Waterloo, Ontario, Canada, 2010 © Alexander Fischer 2010 Author’s declaration I hereby declare that I am the sole author of this thesis. This is a true copy of the thesis, including any required final revisions, as accepted by my examiners. I understand that my thesis may be made electronically available to the public. ii Abstract Wider das System: Gesellschaftliche Aussteiger bei Genazino, Kleist und Kafka This thesis deals with the sociological conception of the dropout (Aussteiger) figure in Wilhelm Genazino’s Ein Regenschirm für diesen Tag (2001) and, in terms of the history of ideas, his predecessors in Heinrich von Kleist’s Michael Kohlhaas (1808) and Franz Kafka’s Die Verwandlung (1913). It discusses if and how Genazino’s protagonist represents a new contemporary dropout model, and discusses the extent to which such figures can be read as dropouts, how their individual dropout characteristics are designed and motivated, and which factors connect these central characters to each other. According to Christian Schüle and his “21 Fragmente über die Identität des Aussteigers” no one can better provide a picture of the state of a society than someone who intentionally exits from it. Thus, the essential process of dropping out is described. If someone is dropping out, he is reacting to circumstances; to what extent he reacts is, however, uneven. There is no prototype of a dropout. -

Informationen Zu Seinen Büchern Und Zur Person (PDF)
KlausKlaus HübnersHübners TetralogieTetralogie KeinKein Twitter,Twitter, keinkein FacebookFacebook VonVon Menschen,Menschen, BüchernBüchern undund BildernBildern Klaus Hübner HIPPIES, PRINZEN UND ANDERE KÜNSTLER Kein Twitter, kein Facebook Von Menschen, Büchern und Bildern Band 1 Außer der Reihe 41 p.machinery, Winnert, März 2020, 264 Seiten Paperback: ISBN 978 3 95765 189 1 EUR 18,90 (DE) Hardcover: ISBN 978 3 95765 190 7 EUR 27,90 (DE) E-Book: ISBN 978 3 95765 897 5 EUR 9,49 (DE) Der erste Band versammelt Arbeiten zur deutsch- Asfa-Wossen Asserate • Zsuzsa Bánk • Artur Be- sprachigen Literatur seit den 1960er-Jahren. cker • Jürgen Becker • Maxim Biller • Marica Bo- Man lernt einen seriösen Hippie kennen, einen drožić • Silvia Bovenschen • Günter de Bruyn • äthiopischen Prinzen, einen masurischen Berser- Hans Christoph Buch • Zehra Çirak • György Da- ker, einen tuwinischen Schamanen, eine bulgari- los • Friedrich Christian Delius • Akos Doma • sche Berlinerin, einen Münchner aus Teheran Hans Magnus Enzensberger • Wilhelm Genazino • und einen wunderbaren Lyriker aus Luxemburg. Nino Haratischwili • Abbas Khider • Hermann Dazu preußische Heimatkunde, Robinson und Kinder • Wulf Kirsten • Gerhard Köpf • Jean Freitag auf Hiddensee, Fallobst aus Schwabing, Krier • Reiner Kunze • Rainer Malkowski • Olga mehrere Windhunde und einiges mehr. Martynova • Terézia Mora • Matthias Nawrat • Selim Özdogan • José F. A. Oliver • Lothar Quin- kenstein • Ralf Rothmann • Eugen Ruge • SAID • Hans Joachim Schädlich • Jochen Schim- mang • Lutz Seiler • Tzveta -

Einführung in Die Empfehlungsliste Für Die Gymnasien
Einführung in die Empfehlungsliste für die Gymnasien Die folgende Lektüreliste knüpft an die allen Schularten gemeinsame Autorenliste an. Die Autorenliste soll die Schülerinnen und Schüler mit Schriftstellerinnen und Schrift- stellern „bekannt" machen, die das kulturelle Gedächtnis der Lesegemeinschaft ausmachen. Dagegen versteht sich die folgende Lektüreliste als eine didaktische Unterstützung für Lehrerinnen und Lehrer und empfiehlt Werke, die im Unterricht gewinnbringend gelesen werden können. Dabei werden die in der Autorenliste ge- nannten Verfasser an vielen Stellen wieder aufgegriffen. Dort, wo es möglich ist, sind die Titel Themenbereichen oder Lebensbereichen zugeordnet. Dies soll den Lehr- kräften die Auswahl erleichtern, intertextuelle Bezüge zwischen Werken herstellen helfen und die Einbettung in thematische Kontexte anregen. Fortfolgend sollen die aufgeführten Werke kommentiert werden. Diese Empfehlungsliste ist offen für Kor- rekturen, Ergänzungen sowie Aktualisierungen, besonders im Bereich der Gegen- wartsliteratur, denn dort sind der literarische Wert und die Anerkennung von Titeln einem schnellen Wandlungsprozess ausgesetzt. Die empfohlenen Werke sind nicht bestimmten Jahrgangsstufen zugeordnet, doch ist bei ihrer Auswahl die Altersangemessenheit zu berücksichtigen. Kriterien für die Aufnahme eines Werks in das Lektüreverzeichnis sind einerseits die literarische Qualität und andererseits die didaktische Eignung, hier insbesondere die Lesbarkeit, die Thematik und die Förderung der Lesemotivation. Allzu komplexe und umfangreiche Werke kommen ebenso wenig in Frage wie solche, die eine geringe Anschlussmöglichkeit an die Erfahrungswelt der Schülerinnen und Schüler bieten. Mit dieser Lektüreliste sind zwei wesentliche Ziele verbunden: Zum einen sollen die Schülerinnen und Schüler im Lauf ihrer Schulzeit solide literarische Kenntnisse über wichtige Autorinnen und Autoren erwerben, zum anderen sollen sie sich kompetent mit „klassischer“ wie aktueller Literatur auseinander setzen können. -

Berg Literature Festival Committee) Alexandra Eberhard Project Coordinator/Point Person Prof
HEIDELBERG UNESCO CITY OF LITERATURE English HEIDEL BERG CITY OF LITERATURE “… and as Carola brought him to the car she surprised him with a passionate kiss before hugging him, then leaning on him and saying: ‘You know how really, really fond I am of you, and I know that you are a great guy, but you do have one little fault: you travel too often to Heidelberg.’” Heinrich Böll Du fährst zu oft nach Heidelberg in Werke. Kölner Ausgabe, vol. 20, 1977–1979, ed. Ralf Schell and Jochen Schubert et. al., Kiepenheuer & Witsch Verlag, Cologne, 2009 “One thinks Heidelberg by day—with its surroundings—is the last possibility of the beautiful; but when he sees Heidelberg by night, a fallen Milky Way, with that glittering railway constellation pinned to the border, he requires time to consider upon the verdict.” Mark Twain A Tramp Abroad Following the Equator, Other Travels, Literary Classics of the United States, Inc., New York, 2010 “The banks of the Neckar with its chiseled elevations became for us the brightest stretch of land there is, and for quite some time we couldn’t imagine anything else.” Zsuzsa Bánk Die hellen Tage S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2011 HEIDEL BERG CITY OF LITERATURE FIG. 01 (pp. 1, 3) Heidelberg City of Literature FIG. 02 Books from Heidelberg pp. 4–15 HEIDELBERG CITY OF LITERATURE A A HEIDELBERG CITY OF LITERATURE The City of Magical Thinking An essay by Jagoda Marinic´ 5 I think I came to Heidelberg in order to become a writer. I can only assume so, in retro spect, because when I arrived I hadn’t a clue that this was what I wanted to be. -

Thomas Hettche Erhält Den Joseph-Breitbach-Preis 2019
akademie der wissenschaften und der literatur mainz Pressemitteilung – 3. Mai 2019 Thomas Hettche erhält den Joseph-Breitbach-Preis 2019 Die Stiftung Joseph Breitbach und die Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz verleihen den Joseph- Breitbach-Preis 2019 an den Schriftsteller Thomas Hettche. Mit Thomas Hettche würdigt die Jury »einen eminenten Stilisten, der die gesellschaftlichen Entwicklungen und ästhetischen Debatten der letzten Jahrzehnte in innovativer Form mitgestaltet hat und seit seinem 1989 erschie- nenen Romandebüt ›Ludwig muß sterben‹ zu den heraus ragenden Stimmen der deutschsprachigen Gegenwarts- literatur gehört. Erkenntnistheoretisch stets auf der Höhe der Zeit und thematisch am Puls der Gegenwart, sind Hettches Romane und Essays ein eigenwilliger poetischer Kosmos, in dem sich ein profundes historisches Wissen mit Erfindungsreichtum und stilistischer Finesse paart. Auch in seinen philosophisch versierten und lebensklugen Essays zeigt sich Hettches bestechende Fähigkeit, die Komplexität der Welt in einer nuancierten und federnden Sprache aufleuchten zu lassen. In autobiografisch-essayistischer Form thematisiert er die mediale Transformation unserer Lebenswelt und setzt den ›leeren Herzen‹ der Gegenwart die poetische Daseinserkundung und ein em- phatisches Literaturverständnis entgegen.« Der Preis ist mit 50.000 € dotiert. Die Verleihung findet am 20. September 2019 im Theater Koblenz statt. Die Laudatio hält Christian Döring. Thomas Hettche, 1964 in Treis am Rand des Vogelsbergs geboren, studierte Germanistik, Philosophie und Film- wissenschaft in Frankfurt am Main und lebt heute als freier Schriftsteller in Berlin und in der Schweiz. Seit 2018 ist Thomas Hettche Honorarprofessor am Institut für Philosophie, Literatur-, Wissenschafts- und Technikgeschichte der Technischen Universität Berlin. Er ist Mitglied des Deutschen PEN und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. -
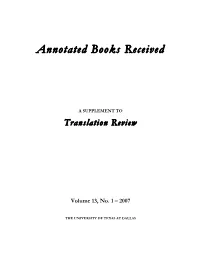
Annotated Books Received
Annotated Books Received A SUPPLEMENT TO Translation Review Volume 13, No. 1 – 2007 THE UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS CONTRIBUTORS Rainer Schulte Christopher Speck DESIGNER Michelle Long All correspondence and inquiries should be directed to: Translation Review The University of Texas at Dallas Box 830688 (JO 51) Richardson TX 75083-0688 Telephone: 972-883-2092 or 2093 Fax: 972-883-6303 E-mail: [email protected] Annotated Books Received, published twice a year, is a supplement of Translation Review, a joint publication of the American Literary Translators Association and The Center for Translation Studies at The University of Texas at Dallas. ISSN 0737-4836 Copyright © 2007 by American Literary Translators Association and The University of Texas at Dallas The University of Texas at Dallas is an equal opportunity/affirmative action employer. ANNOTATED BOOKS RECEIVED 13.1 TABLE OF CONTENTS Arabic .................................................................................................................... 1 Bulgarian................................................................................................................ 5 Chinese .................................................................................................................. 5 Czech ..................................................................................................................... 8 Danish.................................................................................................................... 9 Dutch .................................................................................................................... -

Finden Der Welt
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Das Wieder(er)finden der Welt Das Romantische in Brigitte Kronauers Werk. Am Beispiel Teufelsbrück Verfasserin Maria Szmit angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag.phil.) Wien, März 2013 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 332 Studienrichtung lt. Studienblatt: Deutsche Philologie Betreuer: Univ. Prof. Dr. Roland Innerhofer 1 Es ist, noch einmal, der visionäre Blick, zu dem sie ermuntert, den sie geradezu befiehlt, wenn sie das schaurige Bild einer reduzierten, sich als alleinige Realität aufspielenden Welt andeutet […], die gottlos ist, weil sie ohne Hitze und Kälte, Grausamkeit, Seligkeit, Strahlen und Finsternis ist, eine gleichmäßig erwärmte Welt ohne Wechsel und Überraschung. Man muß die andere erträumen, wiedererfinden, das ist die notwendige Vorleistung der Phantasie, wenn man sie entdecken will.1 1 Brigitte Kronauer über Tania Blixen. In: Kronauer, Brigitte: Aufsätze zur Literatur. Stuttgart: Klett-Cotta 1987, S. 85. 2 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung...................................................................................................... 5 2. Romantik, das Romantische ...................................................................... 9 2.1. Epoche, philosophisches und kunsttheoretisches Paradigma..................9 2.1.1. Orientierung............................................................................................... 9 2.1.2. Sozialgeschichtlicher, politischer Hintergrund und Verlauf......................11 2.1.3. Philosophie, Literaturtheorie