Teil B Sozialstrukturatlas 06.04.09
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Liste Ambulante Pflegedienste Im Landkreis Göppingen
Ambulante Pflegedienste im Landkreis Göppingen Stand Mai 2021/ Angaben ohne Gewähr Gemeinde Pflegedienst Kontakt Einzugsgebiet Bad Boll Diakoniestation Raum Bad Boll Telefon: Aichelberg, Bad Boll, Dürnau, Gammelshausen, Blumhardtweg 30 07164/2041 Hattenhofen, Zell unter Aichelberg. 73087 Bad Boll www.diakoniestation-badboll.de E-Mail: [email protected] Bad Überkingen Pflegedienst Mirjam Care GmbH & Co. Telefon: Bad Ditzenbach und Teilorte, Bad Überkingen KG 07331/951520 und Teilorte, Deggingen mit Reichenbach, Amtswiese 2 Drackenstein, Geislingen und Teilorte, 73337 Bad Überkingen E-Mail: Gruibingen, Hohenstadt, Kuchen, Mühlhausen, www.mirjam-care.de [email protected] Wiesensteig Böhmenkirch Pflegedienst Mirjam Care Böhmenkirch Telefon: Böhmenkirch und Teilorte, Donzdorf und GmbH 07332/9247203 Teilorte, Geislingen und Teilorte, Lauterstein Buchenstraße 44 89558 Böhmenkirch E-Mail: www.mirjam-care-boehmenkirch.de info@mirjam-care- boehmenkirch.de 1 Gemeinde Pflegedienst Kontakt Einzugsgebiet Deggingen Sozialstation Oberes Filstal Telefon: Bad Ditzenbach und Teilorte, Deggingen mit Am Park 9 07334/8989 Reichenbach, Drackenstein, Gruibingen, 73326 Deggingen Hohenstadt, Mühlhausen, Wiesensteig www.sozialstation-deggingen.de E-Mail: sozialstation-deggingen@t- online.de Donzdorf Sozialstation St. Martinus Telefon: Böhmenkirch und Teilorte, Donzdorf und Hauptstraße 60 07162/912230 Teilorte, Lauterstein 73072 Donzdorf www.sozialstation-donzdorf.de E-Mail: [email protected] Ebersbach Dienste für Menschen gGmbH Telefon: -

Oestlicher Schurwald KW 04 ID 75574
14 Birenbach Schurwaldbote . Nr. 04 . Donnerstag, 24. Januar 2013 Donnerstag, 24.01.13 Interessant und aktuell 9:30 Uhr Spielgruppe - Kirchengemeindezentrum Birenbach 20 Uhr CVJM-Posaunenchorprobe - Gemeindehaus Börtlingen Abfallcontainer an der Wallfahrtskirche Freitag, 25.01.13 19:30 Uhr Bibelabend in Hohenstaufen In letzter Zeit wurden die Abfallcontainer an der Wallfahrts- Sonntag, 27.01.13 kirche vermehrt zur Entsorgung privater Haushaltsgegen- 9 Uhr Gottesdienst – Johanneskirche Börtlingen stände verwendet (hier: Einbauküche). 10:10 Uhr Gottesdienst – Kirchengemeindezentrum Birenbach Beide Gottesdienste hält Pfarrer Hennig aus Hohenstaufen 10 Uhr Kinderkirche – Gemeindehaus Börtlingen ab 14:30 Uhr Kaffeenachmittag – Gemeindehaus Börtlingen Dienstag, 29.01.13 9:00 – 10:30 Uhr Spielgruppe - Krabbelmäuse - Gemeindehaus Börtlingen Mittwoch, 30.01.13 14:30 Uhr Abfahrt aller Konfirmanden zum SOS-Kinderdorf in Oberberken - Johanneskirche Börtlingen 17:30 Uhr Jungschar (7-14 Jahre) - Kirchengemeindezentrum Birenbach Donnerstag, 31.01.13 9:30 Uhr Spielgruppe - Kirchengemeindezentrum Birenbach 20 Uhr CVJM-Posaunenchorprobe - Gemeindehaus Börtlingen 20 Uhr Kinderkirchvorbereitung - Gemeindehaus Börtlingen Samstag, 02.02.13 15 Uhr Projektnachmittag der Konfirmanden – Gemeindehaus Börtlingen Sonntag, 03.02.13 Ebenfalls wurde in der vergangenen Woche das Baustellen- 9 Uhr Gottesdienst mit anschließendem Kirchencafé WC umgeworfen. – Kirchengemeindezentrum Birenbach Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass die vor- 10 Uhr Gottesdienst – -

Tour De Kreisle Vom 24
SONDERVERÖFFENTLICHUNG Tour de Kreisle vom 24. bis 28. Juli 2017 Straßdorf Tour de Kreisle 2017 Rattenharz Die verschiedenen Waldstetten Weiler in den Bergen Adelberg Strecken im Überblick Breech Tour 1: Montag, 24. Juli Es heißt wieder kräftig in Wäschenbeuren Börtlingen Rechberg Birenbach Weilerstoffel die Pedale treten Oberwälden Hohenstaufen Krapfenreut Wißgoldingen Lerchenberg Ottenbach Degenfeld Am kommenden Montag startet die 15. Tour de Kreisle. Tour 5: Freitag, 28. Juli Wangen Rechberghausen Eschenbäche Lauterstein Beim Benefizradeln werden Spendengelder für das Ebersbach GÖPPINGEN Weißenstein Uhingen Eislingen/Fils Tour 2: Dienstag, 25. Juli Göppinger Hospiz gesammelt. Von Iris Ruoss Faurndau Albershausen Jebenhausen Salach Sparwiesen Süßen Vor 19 Jahren hat der ehema- Holzheim Böhmenkirch Donzdorf lige Bundestagsabgeordnete Schnittlingen Klaus Riegert eine Fahrrad- Bezgenriet Ursenwang Schlierbach tour quer durch den Land- Hattenhofen Kirchheim unter Teck Heiningen Gingen an der Fils kreis gestartet, er war auf Tour 4: Donnerstag, 27. Juli Stötten Eschenbach Wahl- und Benefiztour. Damit Zell unter Aichelberg Schlat war der Grundstein für die Gammelshausen Tour de Kreisle, die jetzt be- Aichelberg Kuchen Eybach Dürnau Waldhausen reits zum 15. Mal stattfindet, Bad Boll Unterböhringen gelegt. Am Montag geht es Holzmaden Altenstadt Reichenbach Geislingen an der Steige wieder los. „Insgesamt wer- Auendorf im Täle Oberböhringen den wir 350 Kilometer fah- In den vergangenen Jahren war die Tour de Kreisle immer Weilheim an der Teck Hausen an der Fils ren“, erzählt Klaus Riegert, gut befahren. Foto: Tilman Ehrcke Tour 3: Mittwoch, 26. Juli täglich werden zwischen 50 Bad Überkingen Gruibingen Deggingen und 70 Kilometer zurückge- wegs, täglich wird er von 50 bracht. Pünktlich um 9 Uhr Hepsisau Aufhausen Wittingen legt. -

Umzüge Und Arbeitslosengeld II
Angemessene Heizkosten: Im Gegensatz zur Bruttokaltmiete sind die Heizkosten nicht wohnortbezogen sondern für den Landkreis Göppingen ein- heitlich. Hierbei ist lediglich nach der Art des Heizmittels zu unterscheiden. Personen Heizöl Gas Pellets im Haushalt 1 67,91 € 63,79 € 51,41 € 2 90,55 € 85,05 € 68,55 € 3 113,19 € 106,31 € 85,69 € 4 135,83 € 127,58 € 102,83 € 5 158,46 € 148,84 € 119,96 € 6 181,10 € 170,10 € 137,10 € 7 203,74 € 191,36 € 154,24 € 8 226,38 € 212,62 € 171,38 € Personen Strom / Wärme- im Fernwärme pumpe Haushalt 1 84,79 € 84,41 € 2 113,05 € 112,55 € 3 141,31 € 140,69 € Umzüge und 4 169,58 € 168,83 € Arbeitslosengeld II 5 197,84 € 196,96 € 6 226,10 € 225,10 € 7 254,36 € 253,24 € Sie möchten umziehen? In dieser Bro- 8 282,62 € 281,38 € schüre erfahren Sie alles Wichtige. Herausgeber CDDCCA Jobcenter Landkreis Göppingen Wichtiger Hinweis: Mörikestr. 15 73033 Göppingen Sollten Sie ein Anliegen zu einem Umzug haben, nehmen Stand: Januar 2021 Sie bitte zuerst Kontakt zu unserer Service-Hotline unter www.jobcenter-ge.de/Jobcenter/ der 07161/9770-751* (Jobcenter Göppingen) bzw. Goeppingen 07331/9570-66* (Jobcenter Geislingen) auf. Viele Fragen lassen sich so bereits im Vorfeld klären. *Die Telefongebühren richten sich nach Ihrem jeweiligen Anbieter. Landkreis Göppingen Landkreis Göppingen Publication name: Gr01_Flyer Umzug 2021 - 1.0 generated: 2020-11-03T14:31:16+01:00 Was können Sie tun? Miethöchstgrenzen des Mietstufe III: Göppingen (Stadtgebiet) , Eislingen, Süßen, Uhingen Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass Sie vom künftig Landkreises Göppingen für Sie zuständigen Träger eine Zusicherung zu den laufen- Die Miethöchstgrenzen des Landkreises Göppingen setzen Personen Brutto- den Aufwendungen (Gesamtmiete) der neuen Unterkunft sich aus der Summe der angemessenen Bruttokaltmiete (= im kaltmiete einholen. -

Mitteilungsblatt Vom 19.12.2019
Nummer 51/52/1 Donnerstag, 19. Dezember 2019 Jahrgang 2019 Wenn in des Jahres Lauf, dem allzeit gleichen, auf leisen Schwingen sich die Christnacht naht, wenn Erd' und Himmel sich die Hånde reichen, dann schaun wir dich, du græûte Liebestat. Du Heiland Jesus, kamst aus lichten Hæhen, wie unser Bruder tratst Du bei uns ein, wir haben deine Herrlichkeit gesehen, und deinen Wandel, fleckenlos und rein. Tritt ein, du Spender aller Seligkeiten in unser Herz und Haus, in Volk und Land, hilf, dass wir glaubend Dir den Weg bereiten, und mit Dir wandern liebend Hand in Hand. Gib, dass wir hoffend in die Ferne blicken, auf Dich allein, dem wir zu eigen ganz: kein irdisch Ding soll uns das Ziel verrçcken, bis wir Dich schaun in deines Reiches Glanz. Foto: Albert Kosnopfel Hans Brçggemann Liebe Mitbçrgerinnen und Mitbçrger, an den immer kçrzer werdenden Tagen stellen wir fest, dass die Weihnachtsfeiertage und das Jah- resende nicht mehr fern sind.Die Christbåume erhellen unsere Orte und unsere Håuser und çberall kænnen wir festlichen Lichterglanz wahrnehmen. Speziell kurz vor Weihnachten æffnen wir unsere Herzen, machen uns bereit fçr das Weihnachtsfest und sind empfånglich fçr viele schæne Gedanken und Momente.Dabei sollen nicht materielle Din- ge im Vordergrund stehen, sondern die Verbindungen zwischen uns Menschen, fçr die wir in der Hektik des Alltags oftmals keine Zeit haben. Viel zu schnell ist dieses Jahr wieder an uns vorbeigezogen und wir staunen, wie schnell die Zeit vergangen ist.Gemeinsam konnten wir in und fçr unsere Gemeinde wieder viel erreichen und sind dankbar hierfçr. Wir alle freuen uns auf die nun anstehenden Feiertage und auf Zeit mit unseren Familien und Freunden.Genieûen Sie die kommenden ruhigen und besinnlichen Tage, das Staunen der Kinder und deren Vorfreude auf Weihnachten. -
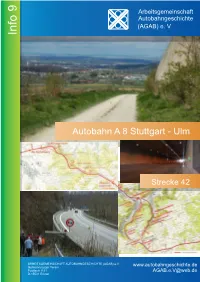
A 8 Stuttgart - Ulm
Arbeitsgemeinschaft Autobahngeschichte (AGAB) e. V Info 9 Autobahn A 8 Stuttgart - Ulm Strecke 42 ARBEITSGEMEINSCHAFT AUTOBAHNGESCHICHTE (AGAB) e.V. Gemeinnütziger Verein www.autobahngeschichte.de Postfach 1151 [email protected] D-15531 Erkner 26. Treffen der Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Autobahngeschichte e.V. Die 26. Mitgliederversammlung des Vereins Das Regierungspräsidium Stuttgart als eines fand am 21.April 2012 in Mühlhausen im Täle der vier Regierungspräsidien des Landes (Baden-Württemberg) statt. Baden-Württemberg steuert und koordiniert Tagungslokal war das Hotel “Höhenblick” sowohl die Finanzplanung als auch die Obere Sommerbergstraße 10 in 73347 technische Planung im Straßen- und Mühlhausen. Brückenbau für die Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen einschließlich des dazu- gehörenden Radwegenetzes. Zu den operativen Tätigkeiten gehören Bau und Ausbau von Bundesautobahnen und Bundes- straßen in Auftragsverwaltung für den Bund und die Bauherrenaufgaben beim Bau und Ausbau der Landesstraßen. Weiterhin gehören die Unterhaltung und ein sicherer Betrieb der Bundesautobahnen, A 6, A 7, A 8, A 81, A 831 zu den Aufgaben. Insgesamt sind fast 600 Mitarbeiterinnen und Das Tagungslokal Hotel Höhenblick Mitarbeiter in Stuttgart, bei den Dienststellen Heilbronn, Ellwangen und Göppingen, den Am Vorabend unserer Versammlung stellte Bauleitungen Bad Mergentheim, Schwäbisch zunächst der Abteilungleiter des Regierungs- Hall und Besigheim sowie bei den Autobahn- präsidiums Stuttgart, Herr Konradin Heyd, meistereien Tauberbischofsheim, Neuen- seinen Verantwortungsbereich vor: die stadt, Kirchberg, Ludwigsburg, Heidenheim Abteilung 4 „Straßenwesen und Verkehr“. und Herrenberg mit Kirchheim u.T. Mit diesen Aufgaben beschäftigt. Außerdem übt das Regierungspräsidium Stuttgart die Fachaufsicht über die 11 Landkreise sowie die Städte Stuttgart und Heilbronn aus, denen der Betrieb und die Unterhaltung von Bundes- und Landes- straßen obliegen. -

Bus Linie 961 Fahrpläne & Karten
Bus Linie 961 Fahrpläne & Netzkarten 961 Deggingen - Hohenstadt Im Website-Modus Anzeigen Die Bus Linie 961 (Deggingen - Hohenstadt) hat 5 Routen (1) Bad Ditzenb. grundschule: 13:10 (2) Deggingen Ave Maria: 06:35 - 13:10 (3) Gosbach Hirsch: 13:58 - 17:35 (4) Hohenstadt Kirche: 06:17 - 17:22 (5) Oberdrackenstein Rathaus: 07:47 Verwende Moovit, um die nächste Station der Bus Linie 961 zu ƒnden und, um zu erfahren wann die nächste Bus Linie 961 kommt. Richtung: Bad Ditzenb. Grundschule Bus Linie 961 Fahrpläne 8 Haltestellen Abfahrzeiten in Richtung Bad Ditzenb. grundschule LINIENPLAN ANZEIGEN Montag Kein Betrieb Dienstag 13:10 Hohenstadt Kirche Am Kindergarten 2, Hohenstadt Mittwoch Kein Betrieb Hohenstadt Abzw. Waltertal Donnerstag Kein Betrieb Oberdrackenstein Rathaus Freitag Kein Betrieb Hauptstraße 25, Germany Samstag Kein Betrieb Drackenst. Untdr-Stein Kirche Sonntag Kein Betrieb Gosbach Einkaufszentrum Drackensteiner Straße, Germany Gosbach Lamm Bus Linie 961 Info Drackensteiner Straße 74, Germany Richtung: Bad Ditzenb. Grundschule Stationen: 8 Gosbach Hirsch Fahrtdauer: 14 Min Unterdorfstraße 2, Germany Linien Informationen: Hohenstadt Kirche, Hohenstadt Abzw. Waltertal, Oberdrackenstein Bad Ditzenb. Grundschule Rathaus, Drackenst. Untdr-Stein Kirche, Gosbach Helfensteinstraße 19, Bad Ditzenbach Einkaufszentrum, Gosbach Lamm, Gosbach Hirsch, Bad Ditzenb. Grundschule Richtung: Deggingen Ave Maria Bus Linie 961 Fahrpläne 13 Haltestellen Abfahrzeiten in Richtung Deggingen Ave Maria LINIENPLAN ANZEIGEN Montag 06:35 - 13:10 Dienstag 06:35 -

Bike Points Der Gemeinden 2
Gastgeber Helfensteiner Land e. V. Bike-Points in den Ortschaften Bad Ditzenbach Tourismusbüro , Frau Gromer, Frau Lüsebrink Helfensteinstraße 20 73342 Bad Ditzenbach Tel. 07334 6911, Fax 07334 920408 E-Mail: [email protected] www.badditzenbach.de Cafe/Restaurant Köhler , Klaus Köhler, Brunnbühlstraße 1 73342 Bad Ditzenbach Mo Ruhetag, So bis 18 Uhr Tel.: 07334 8858, Fax 07334 8553 E-Mail: [email protected] www.cafe-koehler.de Bad Überkingen Kurverwaltung , Herr Straub, Frau Totsche Badstraße 14 Tel. 07331 9619-19/20, Fax 07331 961999 E-Mail: [email protected] www.bad-ueberkingen.de Thermalbad , Herr Duckeck Bahnhofstraße 14 73337 Bad Überkingen Tel. 07331 61087 E-Mail: [email protected] www.therme-bad-ueberkingen.de Böhmenkirch-Steinenkirch Landgasthof/Hotel Rössle , Steinenkirch, Fam. Fahrion Albstraße 9 89558 Böhmenkirch-Steinenkirch Tel. 07332 923900, Fax 07332 9239050 E-Mail: [email protected] www.roessle.steinenkirch.de Gastgeber Helfensteiner Land e. V. Seite 2 Böhmenkirch-Schnittlingen Gasthaus Hirsch, Schnittlingen Familie Brühl Treffelhauser Straße 2 89558 Böhmenkirch-Schnittlingen Tel. 07332 5510, Fax 07332 924199 E-Mail: [email protected] www.hirsch-schnittlingen.de Böhmenkirch-Heidhöfe Café/Gaststätte „Zur Einkehr“, Heidhöfe Familie Krauß Kolomanstraße 3 89558 Böhmenkirch-Heidhöfe Tel. 07332 6226. Donzdorf Hotel Becher, Michael Haug Schloßstraße 7 73072 Donzdorf Tel. 07162 20050, Fax 07162 200555 E-Mail: [email protected] www.hotel-becher.de Geislingen/Steige SAB – Fahrradwerkstätte Geislingen (Staufen Arbeits- u. Beschäftigungsförderung) Herr Kraus, Herr Tielesch Talgraben 40 73312 Geislingen an der Steige Tel. + Fax 07331 62651 Mo. - Fr. 8:00 – 18:00 Uhr Sa. 8:00 – 13:00 Uhr (1. -

Oberer-Fils-Bote KW 14 ID 82177
Nummer 14 Freitag, 4. April 2014 Oberer-Fils-Bote 29 Gemeinde Mühlhausen i.T. Jubilare Sammel- und Abfuhrtermine 2014 Müllabfuhr: Eselhöfe und Mühlhausen i. T.: Geburtstage Freitag, 04. April 2014 Samstag, 19. April 2014 04.04. Maria Wörz, Wiesensteiger Str. 22, 93 Jahre Gelber Sack: Eselhöfe und Mühlhausen i. T.: 04.04. Christa Hübner, Buchstraße 21, 68 Jahre Donnerstag, 10. April 2014 05.04. Ulrich Veit, Schönbachweg 11,66 Jahre Altpapiersammlung: Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen viel Gesundheit Fetzer Papiertonne: Eselhöfe und Mühlhausen i. T. und alles Gute! Freitag, 11. April 2014 Glückwünsche auch an all diejenigen, die hier nicht genannt werden möchten. Grünmassesammlung: Donnerstag, 17. April 2014 Grünmüll: Grüngutplatz in Gosbach (Krähensteige) März - Oktober Amtliche Mitteilungen MO und DO von 14 - 18 Uhr SA von 13 - 18 Uhr November MO und DO 14 - 17 Uhr Öffnungszeiten des Rathauses SA von 13 - 17 Uhr Montag - Freitag 7.30 Uhr - 12.00 Uhr Dezember - Februar Montagnachmittag 14.00 Uhr - 18.00 Uhr SA von 12 - 16 Uhr Problemmüll / mobile Schadstoffsammlung: Dienstag, 27. Mai 2014 Neues am Infostand des Rathauses Schrottabfuhr: Folgende Broschüren liegen auf dem Rathaus am Infostand Mittwoch, 05. November 2014 zur kostenlosen Abholung bereit: Elektrogeräte: 2 Bestellkarten sind auf der Rückseite von - Bahnprojekt Stuttgart - Ulm e. V. - Bezug - Das Projekt- Abfall - ABC. magazin, Weitere "Grüne Karten" sind auf dem Rathaus erhältlich.* April 2014 Sperrmüll: Nur noch auf Anforderung. * Anforderungskarte wurde mit dem Müllgebührenbescheid Die Landeswasserversorgung informiert versandt.* Wasserversorgung Weicheres Trinkwasser im Versorgungsgebiet der Albwasser- Störungen/Notfälle: Bitte rufen Sie den Wassermeister versorgungsgruppe II – Wasserenthärtungsanlagen sollten Uwe Burghardt an unter: 0172 / 7 60 56 88. -

Die Derzeitige Hundesteuer Im Vergleich
Seite 9 Mittwoch, 2. September 2020 Auf Seite 11: Die Alb-Fils-Kliniken und Frisch Auf Göppingen kooperieren bei GEISLINGEN UND KREIS Corona-Tests vor Handballspielen. Im gesamten Banken im VVS-Netz Landkreis unterwegs kooperieren Verkehr Schüler aus dem Senioren Kreissparkasse Landkreis dürfen seit dem und Volksbank bieten 1. September mit dem Serviceleistungen, um Scool-Abo im VVS-Netz ältere Menschen leichter fahren. mit Bargeld zu versorgen. Kreis Göppingen. Seit dem gestri- Kreis Göppingen. Gerade in Coro- gen Dienstag dürfen Schüler mit na-Zeiten kann es für Senioren dem Filsland-Scool-Abo rund um zum Problem werden, wenn sie die Uhr im gesamten VVS-Netz fußläufig kein Bargeld abheben fahren – von Geislingen bis nach können. Der Geislinger Stadtse- Schorndorf oder von Wiesensteig niorenrat (StSRG) hat sich dem bis nach Ludwigsburg. Damit Thema angenommen und ist des- kündige sich ein Vorbote der wegen mit Kreissparkasse und Vollintegration an, schreibt das Volksbank in Kontakt getreten. Landratsamt, denn ab dem 1. Ja- Diese haben ihre Serviceleistun- nuar kommenden Jahres gehört gen ausgeweitet. So betreiben die der Landkreis Göppingen zum beiden Kreditinstitute im Rah- Verkehrs- und Tarifverbund Stutt- men einer Kooperation seit An- gart (VVS). fang Juni viele SB-Filialen im Für Schüler der Klassen 5 bis Landkreis Göppingen gemeinsam. 13 gilt ein monatlicher Eigenan- Dies bedeutet, dass an den dorti- teil von 39,70 Euro, für Erst- bis gen Bankautomaten mit der Viertklässler von 28,60 Euro. EC-Karte der Sparkasse an einem Schüler, die sich das Abo bis jetzt Geldautomaten der Volksbank die noch nicht bestellt haben, können gewünschte Summe an Euro- es sich online über www.filsland. -

Förder- Und Krankenpflegevereine
Abbuchungsermächtigung Ich bin damit einverstanden, dass der jeweilig gültige Jahresbeitrag der ** „Fördergemeinschaft für ambulante Krankenpflege“ / „Krankenpflegeverein Gruibingen e.V.“ von meinem Konto Nr.: ………………… Sozialstation Oberes Filstal IBAN: …………………………...BIC: ……………… Am Park 9 bei der …………………………(BLZ: ……………) 73326 Deggingen abgebucht wird. ………………………………………….. Datum Unterschrift ** nicht zutreffendes bitte streichen Gruibingen, Deggingen, BadDitzenbach,Mühlhausen, Gemeinden: Kooperationspartner: TäT Sozialstation Oberes Filstal Stand: 09/2014 Reinhard Probost Vorsitzender: Arno Braunschmid Geschäftsführung: Ulrich Kausch Pflegedienstleitung: Hohenstadt Mühlhausen, Wiesensteig,Drackenstein, Deggingen Katholische Kirchengemeinde Hl. Kreuz Reichenbach, BadDitzenbach, Gosbach, Katholische Kirchengemeinden: Stadt Wiesensteig r ä ge r : Drackenstein , Hohenstadt , Krankenpflegevereine Oberes Filstal e-mail: [email protected] Sozialstation www.sozialstation-deggingen.de Förder- und 73326 Deggingen ℡ Am Park9 07334 / 8989 07334 / der Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Aufnahmeantrag seit 1981 wirkt die Sozialstation „Oberes Filstal“ für • Beratung vor Begutachtungsterminen des MDK die kranken, alten oder pflegebedürftigen Mitbürger zur Pflegeeinstufung in ihrem Einzugs bere ic h. Zusätzlich Hilfe beim Ausfüllen eines von der Kasse Ich beantrage ab Dieser Bereich umfasst die Gemeinden Deggingen geforderten Pflegetagebuches. mit Teilort Reichenbach, die Gemeinde Bad • Hilfestellung bei der Klärung von bestehen-den ………………………………… -

Verkaufsstellen Für Biobeutel
Verkaufsstellen für Biobeutel Stadt Stadtteil Name Verkaufsstelle Straße Verkaufsstelle Öffnungszeiten Mo+Mi 8:00 bis 12:00 Di 10:00 bis 12:00, 14:00 bis 16:00 Do 10:00 bis 12:00, 16:00 bis 18:00 Adelberg Bürgermeisteramt Adelberg Vordere Hauptstraße 2 Fr 10:00 bis 12:00 Mo-Fr 7:00 bis 12:30, 14:30 bis 18:00 Adelberg Nah und Gut Bäckerei Daiber Schorndorfer Straße 5 Sa 6:45 bis 12:00 Mo+Di+Mi+Fr 9:00 bis 12:00 Aichelberg Bürgermeisteramt Aichelberg Vorderbergstraße 2 Do 9:00 bis 12:00, 14:00 bis 18:00 Mo+Mi 8:00 bis 12:30 Di 8:00 bis 12:30, 15:00 bis 18:00 Do 8:00 bis 12:30, 14:00 bis 16:00 Albershausen Bürgermeisteramt Albershausen Kirchstraße 1 Fr 8:00 bis 11:30 Mo-Fr 6:00 bis 13:00, 14:00 bis 18:00 Albershausen Bäckerei Ulrich Greiner Uhinger Straße 19 Sa 6:00 bis 12:00 Mo+Mi+Sa 8:00 bis 12:30 Bad Boll Blumen Traub Bühlstraße 6 Di+Do+Fr 8:00 bis 12:30, 14:00 bis 18:00 Mo+Di+Do+Fr 8:00 bis 12:30, 14:00 bis 18:00 Bad Boll Blumen Liebler Badstraße 5/1 Mi+Sa 8:00 bis 12:30 Mo+Fr 9:00 bis 12:00, 14:00 bis 17:00 Di+Do 9:00 bis 12:00 Mi 9:00 bis 12:00, 14:00 bis 18:00 Bad Ditzenbach Bürgerbüro im Rathaus Hauptstraße 40 Sa 10:00 bis 12:00 Mo+Mi+Do+Fr 9:00 bis 12:00, 14:00 bis 18:00 Bad Ditzenbach Gosbach Margit's Lädle Drackensteiner Straße 74 Di+Sa 9:00 bis 12:00 Mo-Fr 6:00 bis 13:00 Bad Überkingen Hausen Bäckerei Reichart Rathausplatz 8 Sa 6:00 bis 12:00 Mo+Di+Do+Fr 8:00 bis 11:00, 14:00 bis 18:00 Bad Überkingen Unterböhringen Schreibwaren Braunmiller Reichenbacher Straße 18 Mi+Sa 8:00 bis 11:00 Mo+Mi+Fr 8:30 bis 12:00 Di 8:30 bis 12:00,