Pressestimmen Zum 20
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

3. Claus Schenk Graf Von Stauffenberg Und Operation Walküre
DIPLOMARBEIT „Geschichte des Widerstandes in Film und Fernsehen“ Die Inszenierung der Stauffenberg-Thematik und das tatsächliche Ereignis des 20. Juli 1944 Verfasserin Marlies Bauer angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. Phil.) Wien, Mai 2010 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 317 Studienrichtung lt. Studienblatt: Theater-, Film- und Medienwissenschaft Betreuerin / Betreuer: Doz. Dr. Clemens Stepina FÜR HELGA UND WILHELM BAUER Danksagung Vielen lieben Dank an meine Familie. Ich danke Isabella und meinem Vater Gerhard, meinem Bruder Oliver und meiner Oma Helga. Ein herzliches Dankeschön an Dr. Clemens Stepina für die großartige Betreuung. Danke an all meine lieben Freunde. Besonderen Dank für geduldiges Zuhören und spontanen Einsatz an: Jürgen Millautz, Kathleen Moser, Christian Podlipnig, Sabine Riedl, Davor Tadic, Magdalene Wyszecki und Oliver Zopper. INHALTSVERZEICHNIS 1. Einleitung..................................................................................................... 1 2. Umsturzpläne in der NS-Zeit: Der Weg hin zum Stauffenberg-Attentat....... 5 2.1. Exkurs - Die ersten einsamen Helden des zivilen Widerstandes - Maurice Bavaud und Georg Elser ..........................................................6 2.2. Stimmen aus den eigenen Reihen - der Beginn des militärischen Widerstandes .......................................................................................11 2.2.1. Die letzte Chance? Der Verschwörerkreis um Hans Oster ..........12 2.2.2. Eine Flasche Cognac für das Führerflugzeug..............................16 -

Geschlechtsspezifisches Schreiben Im Journalismus
Geschlechtsspezifisches Schreiben im Journalismus: Wie Reporterinnen und Reporter Wirklichkeit wahrnehmen und darstellen, aufgezeigt am Geschlechterbild in ausgezeichneten Reportagen aus der Zeit von 1977 bis 1999 INAUGURAL-DISSERTATION Zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln Vorgelegt von Petra Zahrt, M.A. aus München Oktober 2001 „Begin at the beginning ... and go on till you come to the end; then stop.“ Lewis Carroll Alice´s Adventures in Wonderland 2 INHALT: 1. Vorwort 6 2. Gegenstand und Zielsetzung der Arbeit 7 3. Das methodische Vorgehen 13 3.1 Das Textkorpus 14 3.1.1 Reportage als Textsorte 16 3.1.2 Journalistenpreise in Deutschland – der Egon Erwin Kisch-Preis 22 3.1.3 Ausgezeichnete Reportagen – Themen und Preisträger 28 3.1.4 Beispielhaftigkeit des Untersuchungskorpus´ 37 3.2 Gliederung und Aufbau der Analyse 38 3.3 Frau und Mann im Mittelpunkt der Reportagen 40 3.3.1 Geschlechterbild-Diskurse 41 3.3.1.1 Feministische Theorie- und Strategierichtungen 41 3.3.1.1.1 Frauenbildforschung und Frauenliteraturgeschichte: Der Gleichberechtigungs-Ansatz 42 3.3.1.1.2 Konstitution von Subjektivität: Der Differenz-Ansatz 46 3.3.1.1.3 Gender-trouble oder: critically queer 51 3.3.1.2 Patriarchale Geschlechterbilder 54 3.3.2 Geschlechterbild-Diskurse und ihre Bedeutung für diese Untersuchung 55 3.4 Sprache und Struktur 56 3.4.1 Die Reportagesituation 57 4. Das Frauenbild der Reporterin 61 4.1 Die Asymmetrie der Positionen 61 4.2 Die triadische Bestimmung der Frau 68 4.2.1 Der Versuch, eine gute Hausfrau zu sein 70 4.2.2 Der Versuch, eine gute Ehefrau zu sein 73 4.2.3 Der Versuch, eine gute Mutter zu sein 74 4.3 Die Reporterin 77 4.3.1 Stimme für die „andere“: die Sprachrohr-Funktion der Reporterin 78 4.3.2 Die erlebende Ich-Reporterin 86 3 4.3.2.1 Frau auf dem Schauplatz 87 4.3.2.2 Frau hinter den Kulissen 93 4.4 Fazit: Das Frauenbild der Reporterin 100 5. -

Die Adaptionen Des Attentats Vom 20. Juli 1944 in Ausgewählten Literarischen Werken Und Filmen
Die Adaptionen des Attentats vom 20. Juli 1944 in ausgewählten literarischen Werken und Filmen Kesić, Ana-Marija Master's thesis / Diplomski rad 2016 Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Humanities and Social Sciences / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet Permanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:142:149677 Rights / Prava: In copyright Download date / Datum preuzimanja: 2021-10-02 Repository / Repozitorij: FFOS-repository - Repository of the Faculty of Humanities and Social Sciences Osijek Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku Filozofski fakultet Osijek Jednopredmetni diplomski studij njemačkog jezika i književnosti nastavničkog usmjerenja Ana-Marija Kesić Adaptacije atentata na Hitlera 20. srpnja 1944. u odabranim književnim djelima i filmovima Diplomski rad Mentor: prof.dr.sc. Željko Uvanović Osijek, 2016 Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku Filozofski fakultet Osijek Odsjek za njemački jezik i književnost Jednopredmetni diplomski studij njemačkog jezika i književnosti nastavničkog usmjerenja Ana-Marija Kesić Adaptacije atentata na Hitlera 20. srpnja 1944. u odabranim književnim djelima i filmovima Diplomski rad Humanističke znanosti, filologija, germanistika Mentor: prof.dr.sc. Željko Uvanović Osijek, 2016 J.-J.-Strossmayer-Universität in Osijek Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften Osijek Diplomstudium der deutschen Sprache und Literatur – Lehramt Ein-Fach-Studium Ana-Marija Kesić Die Adaptionen des Attentats vom 20. Juli 1944 in ausgewählten literarischen Werken und Filmen Diplomarbeit Mentor: prof.dr.sc. Željko Uvanović Osijek, 2016 J.-J.-Strossmayer-Universität in Osijek Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften Osijek Abteilung für deutsche Sprache und Literatur Diplomstudium der deutschen Sprache und Literatur – Lehramt Ein-Fach-Studium Ana-Marija Kesić Die Adaptionen des Attentats vom 20. -

Operation Valkyrie
www.kirkeogfilm.dk Operation Valkyrie Men dog en helt Af Bo Torp Pedersen Stauffenberg-filmen kommer til os med en foromtale, som har rejst tre negative forhold ved den: 1) At det prominente Scientology-medlem Tom Cruise spiller den kristne, tyske modstandshelt mod nazismen. 2) At det historiske stof er blevet forsimplet og forvansket. 3) At filmen med sin turbulente produktionshistorie har fået et dårligt resultat. I Tyskland, hvor man har en mindre naiv opfattelse af Scientology-bevægelsen end den gængse i Danmark, er det en stor kamel at sluge, at en fremtrædende scientolog skal spille én af de få tyske helte fra Anden Verdenskrig. Men principielt vil jeg mene, at Tom Cruise' personlige anskuelser ikke nødvendigvis skader hans skuespil-evner, jfr. John Wayne, hvis skuespilkunst i filmene ikke blev mindre af hans politiske fejltagelser. Det er en stort anlagt amerikansk-international produktion, hvor en stjerne af Cruise-størrelse er naturlig, og selv om han ikke yder nogen stor nuanceret eller dragende præstation, er han OK. Det er siær de engelske skuespiller, der yder det ypperste, f. eks. er Terence Stamp stærkt overbevisende i rollen som den sympatiske General Ludwig Beck (bill. tv.), men Kenneth Branagh er heller ikke dårlig som Major-General Henning von Treschkow (bill. nf.). -1- www.kirkeogfilm.dk Instruktøren Bryan Singer har tidligere lavet bl.a. tegneserie-inspirerede film som ”X-Men” og ”Superman Returns”, men trods beretningerne om filmens vanskelige tilblivelse, er det blevet en hæderligt fortalt underholdningsfilm. Det er naturligvis uhyre svært at skabe spænding i en historie, hvor alle mere eller mindre véd, hvordan det går til sidst, men det lykkes nu for Singer et pænt stykke af vejen. -

Stauffenberg Und Mehr
++ attentat auf hitler +++ Stauffenberg und mehr ++ attentat auf hitler +++ Stauffenberg und mehr Herausgegeben von Linda von Keyserlingk, Gorch Pieken und Matthias Rogg 4 Inhalt 7 Vorwort Katalog Matthias Rogg, Gorch Pieken 66 Aufbau der ausstellung 10 Attentat auf hitler. Stauffenberg und mehr 68 Die frühe Phase 1938/39 Linda von Keyserlingk 74 Hans Oster 84 Ludwig Beck 96 Erwin von Witzleben essays 100 Wolf-Heinrich Graf von Helldorff 103 Carl Friedrich Goerdeler 22 Erinnerungen, erfahrungen 106 Wilhelm Leuschner und erlebnisse im Widerstand 109 Adam von Trott zu Solz Bernhard R. Kroener 112 Helmuth James Graf von Moltke 38 Motive und Ziele – 116 Die Späte Phase 1943/44 geheime Aufzeichnungen 121 Henning von Tresckow von Oberst i.g. Alexis 136 Axel Freiherr von dem Bussche-Streithorst freiherr von roenne 149 Fritz-Dietlof Graf von der Schulenburg Magnus Pahl 152 Claus Schenk Graf von Stauffenberg 155 Margarethe von Oven 48 Petrus Wandrey und 158 Eduard Wagner alfred hrdlicka – 162 Günther von Kluge Zwei Künstler und 166 Walter Cramer der 20. Juli 1944 Linda von Keyserlingk 170 Der ablauf des 20. Juli 1944 176 Die folgen des 20. Juli 1944 186 Die rezeption des 20. Juli 1944 anhang 191 Autorenverzeichnis 191 Bildnachweis 192 Impressum 10 Attentat auf Hitler. Stauffenberg und mehr Linda von Keyserlingk einführung von Bryan Singer »Operation Walküre. Das Stauffenberg Am 20. Juli 1944 detonierte eine Bombe bei einer Lage- Attentat« mit Tom Cruise in der Hauptrolle machte das besprechung im »Führerhauptquartier Wolfschanze« in Thema schließlich auch weltweit einem größeren Publi- Ostpreußen. Der Anschlag galt Adolf Hitler. Wenige kum bekannt. Stunden später kam es zu einem Staatsstreichversuch in Berlin. -

Berlin, 1943. 1938 Wurde Margarethe Von Oven in Budapest Eingesetzt
Berlin, 1943. Während die Wehrmacht an 1938 wurde Margarethe von Oven in Budapest eingesetzt, allen Fronten in die Defensive bis man sie 1940 zum Militärattaché nach Lissabon schickte. geraten ist und die Alliierten Im Sommer 1943 holt sie Oberst Henning von Tresckow als fast täglich Bombenangriffe Sekretärin des Nachk ommandos Heeresgruppe Mitte zurück auf deutsche Großstädte nach Berlin. fliegen, trifft Margarethe von Oven, geborene Hardenberg, in der deutschen Hauptstadt ein. Seit 1925 ist sie Sekretä- rin im Reichswehrministerium. Von 1930 bis 1935 arbeitete sie in Berlin für einige der höchsten Militärs. Dadurch erhielt sie intensive Einblicke hinter die Kulissen der militä- rischen Führung. Henning von Tresckow bereitet seit Längerem einen Staatstreich vor. Schon mehrmals hat er gemeinsam mit anderen Widerstandskämpfern aus den Reihen der Wehrmacht den Versuch unter nommen, Hitler zu töten. Nun will er sich die Unterstützung von Margarethe von Oven sichern. Sie ist seit Kindheitstagen die beste Freundin seiner Frau. Er vertraut ihr blind. 9 20Juli1944.indd 9 06.06.19 17:23 Eines Tages im September 1943. Endlich im Grunewald! Dort ist Henning. Henning von Tresckow stammt aus einer alten preußischen Adelsfamilie, die viele Offiziere hervor- gebracht hat. Nach den Ausschreitungen der sogenannten „Reichskristallnacht“* wurde er zu einem entschlossenen Gegner Hitlers. Bereits vor Beginn des Zweiten Krieges war er überzeugt, dass Hitler beseitigt werden müsse. 1941 wurde er Generalstabsoffizier im Hauptquartier der Heeres- gruppe Mitte und baute dort ein Zentrum des Widerstands auf. Ich halte Hitler nicht nur für den Erzfeind Deutschlands, sondern der ganzen Welt. * vom NS-Regime organisierte gewaltsame Ausschreitungen gegen jüdische Deutsche im November 1938. -

Geschichtsästhetik Und Affektpolitik. Stauffenberg Und Der 20
Repositorium für die Medienwissenschaft Drehli Robnik Geschichtsästhetik und Affektpolitik. Stauffenberg und der 20. Juli im Film 1948 - 2008 2009 https://doi.org/10.25969/mediarep/3736 Veröffentlichungsversion / published version Buch / book Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Robnik, Drehli: Geschichtsästhetik und Affektpolitik. Stauffenberg und der 20. Juli im Film 1948 - 2008. Wien: Turia + Kant 2009. DOI: https://doi.org/10.25969/mediarep/3736. Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer Creative Commons - This document is made available under a creative commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0/ Attribution - Share Alike 4.0/ License. For more information see: Lizenz zur Verfügung gestellt. Nähere Auskünfte zu dieser Lizenz https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ finden Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ GESCHICHTSÄSTHETIK UND AFFEKTPOLITIK Drehli Robnik Historiker und Filmwissenschaftler; Studium in Wien und Amsterdam; Forschungstätigkeit am Ludwig Boltzmann-Institut für Geschichte und Gesellschaft, Wien; Lehrtätigkeit an der Universität Wien, an der Masaryk University, Brno und der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt/M. Gelegentlich Disk-Jockey und Edutainer. »Lebt« in Wien-Erdberg. DREHLI ROBNIK Geschichtsästhetik und Affektpolitik Stauffenberg und der 20. Juli im Film 1948 - 2008 VERLAG TURIA + KANT WIEN Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; -

Die Adaptionen Des Attentats Vom 20. Juli 1944 in Ausgewählten Literarischen Werken Und Filmen
Die Adaptionen des Attentats vom 20. Juli 1944 in ausgewählten literarischen Werken und Filmen Kesić, Ana-Marija Master's thesis / Diplomski rad 2016 Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Humanities and Social Sciences / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet Permanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:142:149677 Rights / Prava: In copyright Download date / Datum preuzimanja: 2021-09-27 Repository / Repozitorij: FFOS-repository - Repository of the Faculty of Humanities and Social Sciences Osijek Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku Filozofski fakultet Osijek Jednopredmetni diplomski studij njemačkog jezika i književnosti nastavničkog usmjerenja Ana-Marija Kesić Adaptacije atentata na Hitlera 20. srpnja 1944. u odabranim književnim djelima i filmovima Diplomski rad Mentor: prof.dr.sc. Željko Uvanović Osijek, 2016 Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku Filozofski fakultet Osijek Odsjek za njemački jezik i književnost Jednopredmetni diplomski studij njemačkog jezika i književnosti nastavničkog usmjerenja Ana-Marija Kesić Adaptacije atentata na Hitlera 20. srpnja 1944. u odabranim književnim djelima i filmovima Diplomski rad Humanističke znanosti, filologija, germanistika Mentor: prof.dr.sc. Željko Uvanović Osijek, 2016 J.-J.-Strossmayer-Universität in Osijek Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften Osijek Diplomstudium der deutschen Sprache und Literatur – Lehramt Ein-Fach-Studium Ana-Marija Kesić Die Adaptionen des Attentats vom 20. Juli 1944 in ausgewählten literarischen Werken und Filmen Diplomarbeit Mentor: prof.dr.sc. Željko Uvanović Osijek, 2016 J.-J.-Strossmayer-Universität in Osijek Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften Osijek Abteilung für deutsche Sprache und Literatur Diplomstudium der deutschen Sprache und Literatur – Lehramt Ein-Fach-Studium Ana-Marija Kesić Die Adaptionen des Attentats vom 20. -

En Tysk Sk?Bne | Kristeligt Dagblad Page 1 of 5
En tysk sk?bne | Kristeligt Dagblad Page 1 of 5 DANMARK En tysk sk?bne 07. maj 2005 DOBBELTAGENT: Hans Georg Klamroth var ikke bare succesfuld forretnings-mand, preusser, officer og nazist, der endte med at vende sig mod Hitler. Han talte flydende dansk og var gift med danske Else Podeus. Klamroth havde desuden en bred kreds af danske venner -- og var dobbeltagent i Danmark i Hans Georg Klamroths forbindelser til Danmark og disses voksende skepsis over for nazismen var udslagsgivende for, at han endte med at blive meddeler til den n?stkommanderende i den milit?re danske efterretningstjeneste, ritmester Hans Lunding. Her ses Hans Georg Klamroth under et af sine ophold i Danmark. Af Frank Esmann Hans Georg Klamroth. N?ppe et navn, som vil forekomme s?rlig mange l? sere bekendt. Kendere af Anden Verdenskrigs historie, og specielt den tyske del af den, husker m?ske hans navn som et af dem, som st?r trykt p? en lille tavle i Berlins Kammergericht, en statelig gammel bygning i den tyske hovedstads centrum, hvor der i dag f?res retssager efter de principper, som g?lder i en demokratisk retsstat, men som for godt 60 ?r siden var s?de for nazisternes Volksgerichthof. En slags standret, hvor der aldrig var tvivl om resultatet, og hvor afh?ringerne blev filmet og vist i biografer landet over, indtil det ogs? blev for meget for selv garvede nazister. Hans Georg Klamroth var en af dem, det gik ud over. Her d?mte den berygtede "dommer" Roland Freisler ham til d?den som http://kd.develop.fyens.dk/artikel/77638?highlight=podeus 22 -07 -2007 En tysk sk?bne | Kristeligt Dagblad Page 2 of 5 medsammensvoren i det mislykkede komplot mod Adolf Hitler den 20. -

Die Brüder Stauffenberg Und Der Dichter Stefan George © Bei Dem Autor Und Der Gedenkstätte Deutscher Widerstand 2010
Gedenkstätte Deutscher Widerstand Beiträge zum Widerstand 1933 – 1945 Wolfgang „Kommt wort vor tat Graf Vitzthum kommt tat vor wort?“ Die Brüder Stauffenberg und der Dichter Stefan George © bei dem Autor und der Gedenkstätte Deutscher Widerstand 2010 Redaktion Petra Behrens Grundlayout Atelier Prof. Hans Peter Hoch, Baltmannsweiler Layout Karl-Heinz Lehmann, Birkenwerder Herstellung allprint media GmbH, Berlin Das Titelbild zeigt Stefan George mit Claus und Berthold Schenk Grafen von Stauffenberg im November 1924. Alle Rechte vorbehalten Printed in Germany 2010 ISSN 0935 – 9702 2 Wolfgang Graf Vitzthum „Kommt wort vor tat kommt tat vor wort?“ Die Brüder Stauffenberg und der Dichter Stefan George 1. Aus den „Sprüchen an die Toten“ die Tat? Margarethe von Oven war aufgewühlt.1 Für die lebensgefährliche geheime Arbeit, für die Generalmajor Henning von Tresckow die junge Frau neben Ehrengard Gräfin von der Schulenburg geworben hatte, hatte sie verabredungsgemäß lediglich eine geliehene Schreibmaschine benutzt und stets nur zu Hause und nur mit Handschuhen getippt. Nun aber hatte sie einen Aufruf geschrieben, der mit den Worten begann: „Der Führer Adolf Hitler ist tot.“ Offenbar ging es um Proklamationen anlässlich eines Staatsstreichs, um Hochverrat, um die Tötung des Staatsoberhaupts! Gemeinsam mit seinem Bruder Berthold, einem 38-jährigen, zum Oberkommando der Marine einberufenen Völkerrechtler, bearbeitete Claus Schenk Graf von Stauffenberg diese Aufrufe seit Mitte September 1943.2 Der Oberstleutnant im Generalstab, gläubiger Katholik, sachlich und den Widerschein eines inneren Feuers ausstrahlend, erklärte Margarethe von Oven den Grund für die Verschwörung. Während Tresckow den Mord an den Juden anprangerte, sprach Stauffenberg von der totalen Unmenschlichkeit der nationalsozialistischen Diktatur, von der rasse-ideologisch ausgerichteten Vernichtungspolitik auf dem östlichen Kriegsschauplatz und von der Misshandlung von Kriegsgefangenen. -

Gender, Resistance and National Socialism in Contemporary Film
University of Calgary PRISM: University of Calgary's Digital Repository Graduate Studies Legacy Theses 2012 Gender, Resistance and National Socialism in Contemporary Film Fell, Hannelore E. Fell, H. E. (2012). Gender, Resistance and National Socialism in Contemporary Film (Unpublished master's thesis). University of Calgary, Calgary, AB. doi:10.11575/PRISM/13369 http://hdl.handle.net/1880/50001 master thesis University of Calgary graduate students retain copyright ownership and moral rights for their thesis. You may use this material in any way that is permitted by the Copyright Act or through licensing that has been assigned to the document. For uses that are not allowable under copyright legislation or licensing, you are required to seek permission. Downloaded from PRISM: https://prism.ucalgary.ca UNIVERSITY OF CALGARY Gender, Resistance and National Socialism in Contemporary Film by Hannelore E. Fell A THESIS SUBMITTED TO THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS DEPARTMENT OF GERMANIC, SLAVIC AND EAST ASIAN STUDIES CALGARY, ALBERTA SEPTEMBER, 2012 © Hannelore E. Fell 2012 The author of this thesis has granted the University of Calgary a non-exclusive license to reproduce and distribute copies of this thesis to users of the University of Calgary Archives. Copyright remains with the author. Theses and dissertations available in the University of Calgary Institutional Repository are solely for the purpose of private study and research. They may not be copied or reproduced, except as permitted by copyright laws, without written authority of the copyright owner. Any commercial use or re-publication is strictly prohibited. -
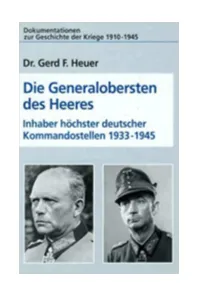
Die Generalobersten.Pdf
Copyright © by Autor und Verlag Arthur Moewig GmbH, Rastatt Alle Rechte vorbehalten Redaktion: Bertold K. Jochim Umschlagentwurf und -gestaltung: Werbeagentur Zeuner, Ettlingen Verkaufspreis inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer Printed in Germany 1988 ISBN 3-8118-1049-9 (Kassette) Eingescannt mit OCR-Software ABBYY Fine Reader Einführung 56 Generale des deutschen Heeres erreichten während der Jahre 1933-1945 den hohen Rang eines Generalobersten, was dem heutigen «Vier-Sterne-General» der Bundeswehr entspricht. 19 von ihnen sind im Verlauf des II. Weltkrieges noch zu Generalfeldmarschällen aufgestiegen. Die im vorliegenden Buch zusammengefassten Biographien dieser hochrangigen Offiziere aus der Zeit zwischen 1933 und 1945 wurden keineswegs etwa nur für Wissenschaftler und Militärhistoriker geschaffen. Sie wenden sich bewusst an einen möglichst breiten Leserkreis, um ihm die Lebenswege dieser in zwei Weltkriegen bewährten Soldaten nahezubringen. Dabei wurden immer wieder die Querverbin- dungen zwischen den einzelnen Persönlichkeiten ebenso auf gezeigt wie ihre Einbet- tung in die wehrgeschichtlichen Entwicklungen, an denen sie teilhatten. Nicht zuletzt aber ging es mir darum, neben einer möglichst objektiven Würdigung dieser Männer ihre tragische Verstrickung in die Geschehnisse einer unheilvollen Zeit aus- zuleuchten. Der Verteidiger des ehemaligen Generalstabschefs, Generaloberst Franz Hal- der, der selbst die Zustände in einem Konzentrationslager ebenso am eigenen Leib erlebte wie nach dem Krieg die alliierte Gefangenschaft, wies in seinem