Nachtwächterstaat“ Oder „Praktisches Christenthum“?
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Im Spannungsfeld Von Katholizismus, Welfentum Und Preußisch-Bismarckschem Machtstreben
Im Spannungsfeld von Katholizismus, Welfentum und preußisch-bismarckschem Machtstreben. Die Entwicklung Ludwig Windthorsts zum Gegenspieler Bismarcks vor dem Hintergrund des Aufstiegs Preußens zur Großmacht bis zum Beginn des Kulturkampfes Inaugural-Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Philosophie (Dr. phil.) durch die Philosophische Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Vorgelegt von Georg Arnold aus Mönchengladbach Erstgutachter: Prof. em. Dr. Karl-Egon Lönne Zweitgutachter: Prof. Dr. Hans Hecker Drittgutachter: Prof. Dr. Gerd Krumeich Tag der Disputation: 24. Januar 2006 D 61 Düsseldorfer Philosophische Dissertation 2 Danksagung und zugleich Widmung Es ist mir eine angenehme Pflicht, an dieser Stelle jenen Menschen zu danken, die mich und diese Arbeit begleitet und in vielfältiger Weise unterstützt haben. Mein besonders tief empfundener Dank gilt meinem Doktorvater Herrn Prof. em. Dr. Karl-Egon Lönne, der mir nicht nur bei fachlichen Problemen sehr geholfen hat, sondern mir durch seine persönliche Begleitung eine wertvolle Stütze war. Leider ist Herr Prof. Lönne kurz vor meiner Disputation erkrankt. Ich danke Herrn Prof. Dr. Hans Hecker, dass er an seiner Stelle die Prüfung geleitet hat. Danken möchte ich denjenigen Mitarbeitern in den Bibliotheken und Archiven, die mich freundlich aufgenommen haben und mir mit Rat und Tat zur Seite standen. Namentlich hervorheben möchte ich Herrn Krischanitz aus dem Hauptstaatsarchiv Hannover. Bedanken möchte ich mich ferner bei SKH Prinz Ernst August von Hannover für die Erlaubnis, im privaten Hausarchiv der Welfenfamilie zu arbeiten, und bei Generaloberin Schwester Wiltrudis für den Zugang zum Klosterarchiv des Augustinerinnenklosters in Neuss. Gerne würde ich an dieser Stelle alle erwähnen, die mir in der zurückliegenden Zeit halfen, aber diese Liste wäre zu lang. -

Plauen 1945 Bis 1949 – Vom Dritten Reich Zum Sozialismus
Plauen 1945 bis 1949 – vom Dritten Reich zum Sozialismus Entnazifizierung und personell-struktureller Umbau in kommunaler Verwaltung, Wirtschaft und Bildungswesen Promotion zur Erlangung des akademischen Grades Dr. phil. der Philosophischen Fakultät der Technischen Universität Chemnitz eingereicht von Dipl.-Lehrer Andreas Krone geboren am 26. Februar 1957 in Plauen angefertigt an der Technischen Universität Chemnitz-Zwickau Fachbereich Regionalgeschichte Sachsen betreut von: Dr. sc. phil. Reiner Groß Professor für Regionalgeschichte Sachsen Beschluß über die Verleihung des akademischen Grades Doktor eines Wissenschaftszweiges vom 31. Januar 2001 1 Inhaltsverzeichnis Seite 0. Einleitung 4 1. Die Stadt Plauen am Ende des 2. Weltkrieges - eine Bilanz 9 2. Zwischenspiel - die Amerikaner in Plauen (April 1945 - Juni 1945) 16 2.1. Stadtverwaltung und antifaschistischer Blockausschuß 16 2.2. Besatzungspolitik in der Übergangsphase 24 2.3. Anschluß an die amerikanische Zone? 35 2.4. Resümee 36 3. Das erste Nachkriegsjahr unter sowjetischer Besatzung 38 (Juli 1945 - August 1946) 3.1. Entnazifizierung unter der Bevölkerung bis Ende 1945 38 3.2. Stadtverwaltung 53 3.2.1. Personalreform im Stadtrat 53 3.2.2. Strukturelle Veränderungen im Verwaltungsapparat 66 3.2.3. Verwaltung des Mangels 69 a) Ernährungsamt 69 b) Wohnungsamt 72 c) Wohlfahrtsamt 75 3.2.4. Eingesetzte Ausschüsse statt gewähltes Parlament 78 3.2.5. Abhängigkeit der Stadtverwaltung von der Besatzungsmacht 82 3.2.6. Exkurs: Überwachung durch „antifaschistische“ Hauswarte 90 3.3. Wirtschaft 93 3.3.1. Erste personelle Maßnahmen zur Bereinigung der Wirtschaft 93 3.3.2. Kontrolle und Reglementierung der Unternehmen 96 3.3.3. Entnazifizierung in einer neuen Dimension 98 a) Die Befehle Nr. -

Religion in China BKGA 85 Religion Inchina and Bernhard Scheid Edited by Max Deeg Major Concepts and Minority Positions MAX DEEG, BERNHARD SCHEID (EDS.)
Religions of foreign origin have shaped Chinese cultural history much stronger than generally assumed and continue to have impact on Chinese society in varying regional degrees. The essays collected in the present volume put a special emphasis on these “foreign” and less familiar aspects of Chinese religion. Apart from an introductory article on Daoism (the BKGA 85 BKGA Religion in China prototypical autochthonous religion of China), the volume reflects China’s encounter with religions of the so-called Western Regions, starting from the adoption of Indian Buddhism to early settlements of religious minorities from the Near East (Islam, Christianity, and Judaism) and the early modern debates between Confucians and Christian missionaries. Contemporary Major Concepts and religious minorities, their specific social problems, and their regional diversities are discussed in the cases of Abrahamitic traditions in China. The volume therefore contributes to our understanding of most recent and Minority Positions potentially violent religio-political phenomena such as, for instance, Islamist movements in the People’s Republic of China. Religion in China Religion ∙ Max DEEG is Professor of Buddhist Studies at the University of Cardiff. His research interests include in particular Buddhist narratives and their roles for the construction of identity in premodern Buddhist communities. Bernhard SCHEID is a senior research fellow at the Austrian Academy of Sciences. His research focuses on the history of Japanese religions and the interaction of Buddhism with local religions, in particular with Japanese Shintō. Max Deeg, Bernhard Scheid (eds.) Deeg, Max Bernhard ISBN 978-3-7001-7759-3 Edited by Max Deeg and Bernhard Scheid Printed and bound in the EU SBph 862 MAX DEEG, BERNHARD SCHEID (EDS.) RELIGION IN CHINA: MAJOR CONCEPTS AND MINORITY POSITIONS ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN PHILOSOPHISCH-HISTORISCHE KLASSE SITZUNGSBERICHTE, 862. -

The Ecumenical Movement and the Origins of the League Of
IN SEARCH OF A GLOBAL, GODLY ORDER: THE ECUMENICAL MOVEMENT AND THE ORIGINS OF THE LEAGUE OF NATIONS, 1908-1918 A Dissertation Submitted to the Graduate School of the University of Notre Dame in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy by James M. Donahue __________________________ Mark A. Noll, Director Graduate Program in History Notre Dame, Indiana April 2015 © Copyright 2015 James M. Donahue IN SEARCH OF A GLOBAL, GODLY ORDER: THE ECUMENICAL MOVEMENT AND THE ORIGINS OF THE LEAGUE OF NATIONS, 1908-1918 Abstract by James M. Donahue This dissertation traces the origins of the League of Nations movement during the First World War to a coalescent international network of ecumenical figures and Protestant politicians. Its primary focus rests on the World Alliance for International Friendship Through the Churches, an organization that drew Protestant social activists and ecumenical leaders from Europe and North America. The World Alliance officially began on August 1, 1914 in southern Germany to the sounds of the first shots of the war. Within the next three months, World Alliance members began League of Nations societies in Holland, Switzerland, Germany, Great Britain and the United States. The World Alliance then enlisted other Christian institutions in its campaign, such as the International Missionary Council, the Y.M.C.A., the Y.W.C.A., the Blue Cross and the Student Volunteer Movement. Key figures include John Mott, Charles Macfarland, Adolf Deissmann, W. H. Dickinson, James Allen Baker, Nathan Söderblom, Andrew James M. Donahue Carnegie, Wilfred Monod, Prince Max von Baden and Lord Robert Cecil. -

KARL MARX Peter Harrington London Peter Harrington London
KARL MARX Peter Harrington london Peter Harrington london mayfair chelsea Peter Harrington Peter Harrington 43 dover street 100 FulHam road london w1s 4FF london sw3 6Hs uk 020 3763 3220 uk 020 7591 0220 eu 00 44 20 3763 3220 eu 00 44 20 7591 0220 usa 011 44 20 3763 3220 www.peterharrington.co.uk usa 011 44 20 7591 0220 Peter Harrington london KARL MARX remarkable First editions, Presentation coPies, and autograPH researcH notes ian smitH, senior sPecialist in economics, Politics and PHilosoPHy [email protected] Marx: then and now We present a remarkable assembly of first editions and presentation copies of the works of “The history of the twentieth Karl Marx (1818–1883), including groundbreaking books composed in collaboration with century is Marx’s legacy. Stalin, Mao, Che, Castro … have all Friedrich Engels (1820–1895), early articles and announcements written for the journals presented themselves as his heirs. Deutsch-Französische Jahrbücher and Der Vorbote, and scathing critical responses to the views of Whether he would recognise his contemporaries Bauer, Proudhon, and Vogt. them as such is quite another matter … Nevertheless, within one Among this selection of highlights are inscribed copies of Das Kapital (Capital) and hundred years of his death half Manifest der Kommunistischen Partei (Communist Manifesto), the latter being the only copy of the the world’s population was ruled Manifesto inscribed by Marx known to scholarship; an autograph manuscript leaf from his by governments that professed Marxism to be their guiding faith. years spent researching his theory of capital at the British Museum; a first edition of the His ideas have transformed the study account of the First International’s 1866 Geneva congress which published Marx’s eleven of economics, history, geography, “instructions”; and translations of his works into Russian, Italian, Spanish, and English, sociology and literature.” which begin to show the impact that his revolutionary ideas had both before and shortly (Francis Wheen, Karl Marx, 1999) after his death. -

University of New South Wales 2005 UNIVERSITY of NEW SOUTH WALES Thesis/Project Report Sheet
BÜRGERTUM OHNE RAUM: German Liberalism and Imperialism, 1848-1884, 1918-1943. Matthew P Fitzpatrick A thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy University of New South Wales 2005 UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES Thesis/Project Report Sheet Surname or Family name: Fitzpatrick First name: Matthew Other name/s: Peter Abbreviation for degree as given in the University calendar: PhD. School: History Faculty: Arts Title: Bürgertum Ohne Raum: German Liberalism and Imperialism 1848-1884, 1918-1943. Abstract This thesis situates the emergence of German imperialist theory and praxis during the nineteenth century within the context of the ascendancy of German liberalism. It also contends that imperialism was an integral part of a liberal sense of German national identity. It is divided into an introduction, four parts and a set of conclusions. The introduction is a methodological and theoretical orientation. It offers an historiographical overview and places the thesis within the broader historiographical context. It also discusses the utility of post-colonial theory and various theories of nationalism and nation-building. Part One examines the emergence of expansionism within liberal circles prior to and during the period of 1848/ 49. It examines the consolidation of expansionist theory and political practice, particularly as exemplified in the Frankfurt National Assembly and the works of Friedrich List. Part Two examines the persistence of imperialist theorising and praxis in the post-revolutionary era. It scrutinises the role of liberal associations, civil society, the press and the private sector in maintaining expansionist energies up until the 1884 decision to establish state-protected colonies. Part Three focuses on the cultural transmission of imperialist values through the sciences, media and fiction. -

A Study of Early Anabaptism As Minority Religion in German Fiction
Heresy or Ideal Society? A Study of Early Anabaptism as Minority Religion in German Fiction DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Ursula Berit Jany Graduate Program in Germanic Languages and Literatures The Ohio State University 2013 Dissertation Committee: Professor Barbara Becker-Cantarino, Advisor Professor Katra A. Byram Professor Anna Grotans Copyright by Ursula Berit Jany 2013 Abstract Anabaptism, a radical reform movement originating during the sixteenth-century European Reformation, sought to attain discipleship to Christ by a separation from the religious and worldly powers of early modern society. In my critical reading of the movement’s representations in German fiction dating from the seventeenth to the twentieth century, I explore how authors have fictionalized the religious minority, its commitment to particular theological and ethical aspects, its separation from society, and its experience of persecution. As part of my analysis, I trace the early historical development of the group and take inventory of its chief characteristics to observe which of these aspects are selected for portrayal in fictional texts. Within this research framework, my study investigates which social and religious principles drawn from historical accounts and sources influence the minority’s image as an ideal society, on the one hand, and its stigmatization as a heretical and seditious sect, on the other. As a result of this analysis, my study reveals authors’ underlying programmatic aims and ideological convictions cloaked by their literary articulations of conflict-laden encounters between society and the religious minority. -

ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS Skrifter Utgivna Av Statsvetenskapliga Föreningen I Uppsala 196
ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala 196 Svante Nycander The History of Western Liberalism Front cover portraits: Thomas Jefferson, Baruch de Spinoza, Adam Smith, Alexis de Tocqueville, Oliver Wendell Holmes, Joseph Schumpeter, Woodrow Wilson, Niccoló Machiavelli, Karl Staaff, John Stuart Mill, François-Marie Arouet dit Voltaire, Mary Wollstonecraft, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Ludwig Joseph Brentano, John Dewey, Wilhelm von Humboldt, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Ayn Rand © Svante Nycander 2016 English translation: Peter Mayers Published in Swedish as Liberalismens idéhistoria. Frihet och modernitet © Svante Nycander and SNS Förlag 2009 Second edition 2013 © Svante Nycander and Studentlitteratur ISSN 0346-7538 ISBN 978-91-554-9569-5 Printed in Sweden by TMG Tabergs AB, 2016 Contents Preface ....................................................................................................... 11 1. Concepts of Freedom before the French Revolution .............. 13 Rights and Liberties under Feudalism and Absolutism ......................... 14 New Ways of Thinking in the Renaissance ........................................... 16 Calvinism and Civil Society .................................................................. 18 Reason as a Gift from God .................................................................... 21 The First Philosopher to Be Both Liberal and Democratic ................... 23 Political Models during the Enlightenment .......................................... -

Karl Marx's Changing Picture of the End of Capitalism
Journal of the British Academy, 6, 187–206. DOI https://doi.org/10.5871/jba/006.187 Posted 30 July 2018. © The British Academy 2018 Karl Marx’s changing picture of the end of capitalism Master-Mind Lecture read 21 November 2017 GARETH STEDMAN JONES Fellow of the Academy Abstract: This essay examines three successive attempts Marx made to theorise his conception of the ‘value form’ or the capitalist mode of production. The first in the 1840s ascribed the destruction of an original human sociability to the institution of private property and looked forward to its destruction and transcendence in the coming revolution. This vision was shattered by the disenchanting failure of the 1848 revolutions. The second attempt, belonging to the 1850s and outlined in the Grundrisse, attempted to chart the rise, global triumph, and the ultimate destruction of what Marx called the ‘value form’. Its model of global triumph and final disintegration was inspired by Hegel’s Logic. But the global economic crisis of 1857–8 did not lead to the return of revolution. Marx’s disturbed reaction to this failure was seen in his paranoia about the failure of his Critique of Political Economy (1859). Marx’s third attempt to formulate his critique in Das Kapital in 1867 was much more successful. It was accompanied by a new conception of revolution as a transi tional process rather than an event and was stimulated by his participation in the International Working Men’s Association and the accompanying growth of cooper atives, trade unions, and a political reform movement culminating in the Reform Bill of 1867. -
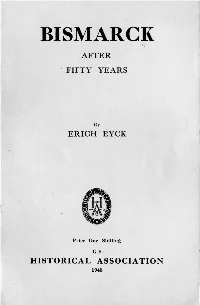
Bismarck After Fifty Years
BISMARCK AFTER FIFTY YEARS By ERICH EYCK Price One Shilling G8 HISTORICAL ASSOCIATION 1948 GENERAL SERIES: G 8 BISMARCK AFTER FIFTY YEARS BY ERICH EYGK Price One Shilling Members may obtain extra copies at Id, each (post free) from the Hon. Secretary of the Association, 21, Bedford Square, London, W.C.I PUBLISHED FOR THE HISTORICAL ASSOCIATION BY GEORGE PHILIP & SON, LTD., LONDON, E.C.4. 1948 THIS notable essay by Dr. Erich Eyck, the most distinguished Bismarckian scholar of our day, was written on the invitation of BISMARCK the Historical Association to commemorate the fiftieth anniversary of Bismarck's death. Dr. Eyck, a German Liberal of the school AFTER FIFTY YEARS of Ludwig Bamberger, found his way to England in the early years of the Nazi government, and his massive three-volume Life of Bismarck, published in Switzerland between 1941 and 1944, ' THAT world history has to be re-written from time to time, was written mainly in this country. It will no doubt remain the about that there remains no doubt in our day. This necessity standard biography of Bismarck for many years to come, but, as exists, not because much about what has passed has been dis- publishing difficulties make the early appearance of an English covered since, but because new points of view arise, because the translation unlikely, this short reassessment of Bismarck's career contemporary of an advanced age is led into a position from which and summary of Dr. Eyck's conclusions is particularly welcome. the past can be surveyed and assessed anew.' Thus wrote Goethe one and a half centuries ago. -

The Historicity of Jesus the University Op Chicago Pbess Chicago, Illinois
C33 CORNELL UNIVERSITY LIBRARY GIFT OF Alfred C. Barnes Date Due JAN 4 The original of tliis book is in tine Cornell University Library. There are no known copyright restrictions in the United States on the use of the text. http://www.archive.org/details/cu31924029312075 THE HISTORICITY OF JESUS THE UNIVERSITY OP CHICAGO PBESS CHICAGO, ILLINOIS Bgente THE BAKER & TAYLOR COMPANY NEW YORK THE CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS LONDON AND EDINBUBGH THE HISTORICITY OF JESUS A CRITICISM OF THE CONTENTION THAT JESUS NEVER LIVED, A STATEMENT OF THE EVIDENCE FOR HIS EXISTENCE, AN ESTIMATE OF HIS RELATION TO CHRISTIANITY By SHIRLEY JACKSON CASE of the Department of Neiv Testament Literature and Interpretation in the University of Chicago THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS CHICAGO, ILLINOIS Copyright 1912 By The University of Chicago All Rights Reserved Published March igi2 'i.<x- \^-J^i, ;, ^ 11. tc_ k_^- x>3 Composed and Printed By The University of Chicago Press Chicago, Illinois. U.S.A. PREFACE The main purpose of the present volume is to set forth the evidence for believing in the his- torical reality of Jesus' existence upon earth. By way of approach, the characteristic features of more recent opinion regarding the historical Jesus have been surveyed, and, on the other hand, the views of those who deny his existence have been examined in detail. The negative arguments have been carefuUy analyzed in order accurately to comprehend the problem. In presenting the evidence for Jesus' historicity, an effort has been made both to meet oppo- nents' objections and at the same time to give a fairly complete collection of the historical data upon which belief in his existence rests. -

Die Burgkellerbibliothek Oder Progreßbibliothek Der
Die „Burgkeller-“ oder „Progreßbibliothek“ der Burschenschaft Arminia auf dem Burgkeller-Jena im Bundesarchiv Koblenz, Bestd. DB 9: Deutsche Burschenschaft Gesellschaft für burschenschaftliche Geschichtsforschung e. V. Archiv und Bücherei zusammengestellt und bearbeitet von Peter Kaupp und Harald Lönnecker Frankfurt am Main 2002 Dateiabruf unter: www.burschenschaft.de Die „Burgkeller-“ oder „Progreßbibliothek“ der Burschenschaft Arminia auf dem Burgkeller-Jena im Bundesarchiv Koblenz, Bestd. DB 9: Deutsche Burschenschaft Gesellschaft für burschenschaftliche Geschichtsforschung e. V. Archiv und Bücherei zusammengestellt und bearbeitet von Peter Kaupp und Harald Lönnecker Die „Burgkellerbibliothek“ oder „Progreßbibliothek“ der Burschenschaft Arminia auf dem Burgkeller-Jena entstand in den dreißiger, vierziger und fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts und wurde bis etwa 1930 fortlaufend ergänzt. Die Bibliothek ist die einzig erhaltene einer Burschenschaft aus der Zeit des Vormärz. Die Bibliothek befand sich bis in die 1930er Jahre im „Burgkeller“, einer Gastwirtschaft, in der die Burschenschaft tagte und die sie später kaufte. Während sich ein Großteil des Bestandes seit etwa 1870 durch die Bombardierung Jenas 1945 nicht erhalten hat, wurde der älteste Teil durch die Abgabe an Archiv und Bücherei gerettet. Erleichtert wurde die Trennung dadurch, daß die Bibliothek im numerus currens geordnet war. Dies wurde beibehalten. Die nachstehenden beiden Auflistungen wurden im Juni und Juli 2002 anhand des numerischen Zettelkatologs (zwei Kästen: DBz 1–500 und DBz 501–981), den der Leiter des Archivs und der Bücherei, Dr. Harald Lönnecker, erarbeitete und mir leihweise überließ, erstellt. Die Abschrift erfolgte ohne Format-Angaben. Trotz einiger Sorgfalt sind Fehler nicht ganz auszuschließen. Die Auflistung ist in zwei Teile gegliedert: A. Bestand der Progreßbibliothek der Burschenschaft Arminia auf dem Burgkeller- Jena in numerischer Folge; B.