Babenbergrische OSTMARK
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ein Historisches Ereignis Von Europäischer Dimension
Tobias Appl Ein historisches Ereignis von europäischer Dimension Auf der Barbinger Wiese wurde im September 1156 die Markgrafschaft Österreich von Bayern abgetrennt und zum Herzogtum erhoben Im September 2006 jährte sich die Erhebung der bis dahin zu Bayern gehörigen Markgrafschaft Österreich zu einem eigen- ständigen Herzogtum zum 850. Mal1. Dieses herausragende historische Ereignis ist nicht nur für die bayerische, öster- reichische, ja sogar europäische Geschichte von erheblicher Bedeutung, sondern hat für Stadt und Landkreis Regensburg darüber hinaus auch eine regionalgeschichtliche Dimension2. Denn diese Erhebung Österreichs wurde im Rahmen eines Regensburg kaiserlichen Hoftages in Regensburg beschlossen und durch- geführt. Die feierliche lehensrechtliche Zeremonie hierbei fand in prato Barbingin, also auf der Barbinger Wiese statt. Passau Neben der Darstellung der Ereignisse, die zu diesem Regens- Wien burger Hoftag 1156 führten, sowie der Schilderung desselben Freising Enns soll im Folgenden die Frage nach einer genaueren Lokalisie- rung des Geschehens im Mittelpunkt stehen. Salzburg Vorgeschichte Brixen Bei seinem Tod am 15. Februar 1152 hinterließ König Kon- rad III. aus der Familie der Staufer seinem Nachfolger einen Konflikt, der diesem diplomatisches Fingerspitzengefühl und politisches Durchsetzungsvermögen abverlangen sollte. Es ging um nichts weniger als die Zukunft des Herzogtums Bay- Abb. 1: Das Herzogtum Bayern vor und nach 1156. 23 Regensburger Land . Band 1 . 2008 ern und um einen damit verbundenen Ausgleich zwischen den bruder Markgraf Leopold aus dem Geschlecht der Babenber- sich gegenüberstehenden Familien der Welfen und der Baben- ger. Neben Leopold band der neue König auch dessen älteren berger. Bruder Heinrich Jasomirgott sowie die jüngeren Geschwister Denn nachdem Konrad am 13. März 1138 überraschend Otto und Konrad, welche beide in der Reichskirche Karriere zum König gewählt worden war, hatte er umgehend dafür machen sollten, eng an sich3. -
A Concise History of Austria Steven Beller Index More Information
Cambridge University Press 978-0-521-47886-1 - A Concise History of Austria Steven Beller Index More information INDEX Aachen (Aix-la-Chapelle) 45, 114 army (Habsburg, Austrian) 71, 74, 88, Abraham a Sancta Clara (Johann Ulrich 91, 110, 116, 126, 131, 134, 138, Megerle) 69 145, 146, 165–6, 186–90, 273, 293 Adler, Alfred 171, 213 Austrians in the German army Adler, Friedrich 188, 204 (Wehrmacht and SS) 241–3, 259, Adler, Max 158, 206, 214 291, 300 Adler, Victor 154, 158, 188 Aspern-Essling 111 Admont 95 Augarten 94 Aehrenthal, Baron Lexa von Augsburg 13, 47, 48, 53 180–2 Austerlitz 108, 111 Albania, Albanians 71, 183 Austrian People’s Party (OVP)¨ (see also Albrecht I 27, 28 Christian Socials) 254–5, 263, Albrecht II 28, 29–30 270–1, 273, 274, 275, 279, 284, Alemanii 11, 14, 17, 29 287, 290, 295–6, 299, 300, 302–5 Allgemeines Krankenhaus (general ‘Austro-Keynesianism’ 274, 282, 283 hospital) 98, 285 Austro-Marxism 171, 174, 206, 214 Alliance for the Future of Austria Avars 12–13, 15 (BZO)¨ 306 Alpbach 268 Babenberg dynasty 13, 15–23, 26, 27, Alsace, Alsace-Lorraine 27, 31, 62, 63, 30, 191, 201, 224 190 Bach, Alexander 131–2 Alt Aussee 245 Bach, David Josef 206, 214 Altranstadt¨ 74 Badeni, Count Casimir; Badeni Anderl of Rinn 286 Ordinances 161–2, 163, 165, 169 Andrassy,´ Count Gyula 149–51 Bad Leonfelden 22, 61, 63, 77, 98, 118, Andrian, Leopold von 214 119, 163, 173, 240, 249, 250, 257, Andrian-Werburg, Viktor von 269–70, 274, 280 118 Baroque 64, 66–9, 75–7, 81, 87, 91, Androsch, Hannes 273–4, 283 95, 163, 175, 176, 201, 217, 219 anti-Semitism -

Hamburg: an Imperial City at the Imperial Diet of 1640-'41 a New Diplomatic
Hamburg: an Imperial City at the Imperial Diet of 1640-‘41 a New Diplomatic History Master thesis F.A. Quartero, BA S1075438 Houtstraat 3 2311 TE Leiden Supervisor: Dr. M.A. Ebben Doelensteeg 16 2311 VL Leiden Room number 2.62b 23.082 words 2 Table of contents Introduction 4 Chapter I: The Empire, Hamburg and the Duke of Holstein 12 Hamburg’s government 13 ‘Streitiger Elbsachen’: Hamburg and the Duke of Holstein 19 The Empire: Hamburg’s far friend 22 Chapter II: Hamburg’s political ambitions and diplomatic means 26 Goals 27 1. Commerce 27 2. Territory 31 3. Contributions 32 Means 33 1. Gratification 33 2. Publicising 36 3. Diplomatic support 38 4. Law enforcement 40 Hamburg’s diplomacy 43 Chapter III: Much to declare: Barthold Moller’s Regensburg accounts 45 Revenue 47 Expenses 51 1. Representation 51 2. NeGotiation 54 3. Information 54 4. Affiliation 60 Hamburg’s Imperial politics 69 Conclusion 72 Bibliography 76 3 Figure 1: ‘Niedersachsen and Bremen, 1580’, at: Martin Knauer, Sven Tode (ed.), Der Krieg vor den Toren: Hamburg im Dreißigjährigen Krieg 1618-1648, (HamburG 2000), 150-151. 4 Hamburg An Imperial City at the Imperial Diet of 1640-‘41 Over time, the Holy Roman Empire has been subjected to many revaluations. Nineteenth century historians considered it a weak state, after the German aGGressions of the First and Second World War scholars sought clues for a ‘Sonderweg’ in history that had lead the German proto-nation away from democratic principles and towards totalitarianism, followed by a reappraisal of the Imperial institutions -

"Germans" and "Austrians" in World War II: Military History and National Identity
"Germans" and "Austrians" in World War II: Military History and National Identity Peter Thaler Department of History University of Minnesota September 1999 Working Paper 99-1 ©1999 by the Center for Austrian Studies (CAS). Permission to reproduce must generally be obtained from CAS. Copying is permitted in accordance with the fair use guidelines of the U.S. Copyright Act of 1976. CAS permits the following additional educational uses without permission or payment of fees: academic libraries may place copies of CAS Working Papers on reserve (in multiple photocopied or electronically retrievable form) for students enrolled in specific courses; teachers may reproduce or have reproduced multiple copies (in photocopied or electronic form) for students in their courses. Those wishing to reproduce CAS Working Papers for any other purpose (general distribution, advertising or promotion, creating new collective works, resale, etc.) must obtain permission from the Center for Austrian Studies, University of Minnesota, 314 Social Sciences Building, 267 19th Avenue S., Minneapolis MN 55455. Tel: 612-624-9811; fax: 612-626-9004; e-mail: [email protected] The concept of Austrian nationhood played a central role in the public discourse of postwar Austria. Unlike its interwar predecessor, which was characterized by doubts about its purpose and viability and by persistent calls for closer affiliation with Germany, Austria’s Second Republic rested in itself and emphasized its distinction from its northwestern neighbor. Increasingly, this distinction was -

Schnell Ý Steiner
Peter Schmid " Heinrich Wanderwitz (Hrsg. ) DIE GEBURT ÖSTERREICHS 850 Jahre Privilegium minus SCHNELLý STEINER Roman Deutizzgez" Das Privilegium minus, Otto von Freising und der Verfassungswandel des 12. Jahrhunderts Die Urkunde, die Kaiser Friedrich Barbarossa am 17. September 1156 über die Vereinbarungen des vorangegangenen Regensburger Reichstags ausstellte, und der Bericht, den Otto von Freising zwei Jahre später in seinen Gesta Friderici über diese Vorgänge niederschrieb, bilden Österreichs für uns die beiden wichtigsten Quellen über die Erhebung zum Herzogtum. Beide Texte bergen eine Fülle von Interpretationsproblemen; soweit sie rein quellenkritischer Natur sind, werden sie in anderen Beiträgen dieses Bandes behandelt. Im folgenden sollen vielmehr die verfassungsgeschichtlichen Deutungsschwierigkeiten in den Blick genommen werden, die Privilegium minus und Gesta Friderici aufiverfen. Dabei werden drei Problemkreise im Zentrum der Betrachtung stehen: zuerst die lehnrechtliche Bedeutung des Gesamtvorgangs (I); dann die Bedeutung der einzelnen durch die Urkunde verbrieften Privilegien für die tatsäch- lichen Verfassungszustände des 12. Jahrhunderts (II); die Frage den zuletzt nach drei Grafschaften", die Ottos Bericht her" Mark Österreich nun zufolge von alters zur gehörten und zusammen mit dieser das neugeschaffene Herzogtum bildeten (III). Alle drei Problemkreise sol- len jeweils vor dem Hintergrund des allgemeinen Verfassungswandels im 12. Jahrhundert ver- ortet werden, wobei diese Perspektive nicht nur das Verständnis für diese Fragen verbessern kann, sondern gleichzeitig umgekehrt das rechte Verständnis der beiden Texte auch helfen kann, diesen allgemeinen Verfassungswandel besser zu begreifen. Angesichts des Umstandes, dass beide Quellen, ihrer Bedeutung entsprechend, schon vielfach Gegenstand gelehrter Bemühungen gewesen sind, kann es dabei weniger um die Präsentation von umwälzenden Entdeckungen oder Neuerkenntnissen gehen als vielmehr um die kritische Auseinandersetzung mit bisherigen Deutungen. -

European Elites and Ideas of Empire, 1917…1957
EUROPEAN ELITES AND IDEAS OF EMPIRE, 1917–1957 Who thought of Europe as a community before its economic integra- tion in 1957? Dina Gusejnova illustrates how a supranational European mentality was forged from depleted imperial identities. In the revolutions of 1917–1920, the power of the Hohenzollern, Habsburg, and Romanoff dynasties over their subjects expired. Even though Germany lost its credit as a world power twice in that century, in the global cultural memory, the old Germanic families remained associated with the idea of Europe in areas reaching from Mexico to the Baltic region and India. Gusejnova’s book sheds light on a group of German-speaking intellectuals of aristocratic origin who became pioneers of Europe’s future regeneration. In the minds of transnational elites, the continent’s future horizons retained the con- tours of phantom empires. This title is available as Open Access at 10.1017/9781316343050. dina gusejnova is Lecturer in Modern History at the University of Sheffield. new studies in european history Edited by peter baldwin, University of California, Los Angeles christopher clark, University of Cambridge james b. collins, Georgetown University mia rodriguez-salgado, London School of Economics and Political Science lyndal roper, University of Oxford timothy snyder, Yale University The aim of this series in early modern and modern European history is to publish outstanding works of research, addressed to important themes across a wide geographical range, from southern and central Europe, to Scandinavia and Russia, from the time of the Renaissance to the present. As it develops, the series will comprise focused works of wide contextual range and intellectual ambition. -
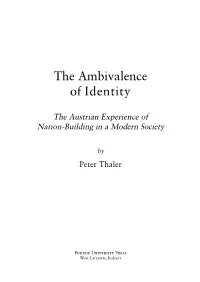
The Ambivalence of Identity
The Ambivalence of Identity The Austrian Experience of Nation-Building in a Modern Society by Peter Thaler Purdue University Press West Lafayette, Indiana 2 Catalyst or Precondition The Socioeconomic Environment of Austrian Nation-Building or much of the postwar era, the scholarly interpretation of contemporary Austrian history centered on the concept of an FAustrian nation that had ¤nally found its destiny, guided by political leaders who had overcome their former disagreements for the good of the country.1 The differences between the interwar and the postwar developments gained particular attention; Austria’s second republic was demarcated from its ¤rst. The modest Alpine republic with the historic name that had arisen from the ashes of the Habsburg Monarchy had been described as the “the involuntary state,” as re¶ected in the title of Reinhard Lorenz’s study, and “the state that no one wanted,” as Hellmut Andics named his popular book.2 Drawing on the latter title, the reemerged republic of the postwar era would widely be characterized as “the state that everyone wanted.”3 Leading foreign analysts of Austrian nation-building also respected these interpretative perimeters.4 William Bluhm’s classic Building an Austrian Nation introduced valuable tools of analysis into the Austrian debate; indeed, its contribution is greatest from a methodological point of view. The American political scientist utilized polls for the broader picture of Austrian public opinion but also conducted individual inter- views with members of the political elites. He examined the structural dynamics of postwar Austrian society and contrasted them with earlier time periods. Ultimately, however, he remained bound to an analytical 26 The Ambivalence of Identity approach that juxtaposes a successful postwar integration with a previ- ous history of disintegration and does not probe the contractual con- sensus model that informs it. -
Silver Pfennigs and Small Silver Coins of Europe in the Middle Ages
Silver Pfennigs and Small Silver Coins of Europe in the Middle Ages David P. Ruckser and Lincon Rodrigues AUSTRIA *In the section entitled “AUSTRIA” are included coins from Vienna, Vienna Neustadt , Krems, some non-ecclesiatic Friesach and Enns mints.... Especially the “Wiener Pfennigs”. Other issues are listed under the various cities , bishoprics or provinces. The March of Austria was first formed in 976 out of the lands that had once been the March of Pannonia in Carolingian times. In 1156, the Privilegium Minus elevated the march to a Duchy independent of the Duchy of Bavaria. LEOPOLD I - 976-994 Leopold I, also Luitpold or Liutpold (died 994) was the first Margrave of Austria from the Babenberg dynasty. Leopold was a count in the Bavarian Danube district and first appears in documents from the 960s as a faithful follower of Emperor Otto I the Great. After the insurgence by Henry II the Wrangler of Bavaria in 976 against Emperor Otto II, he was appointed as "margrave in the East", the core territory of modern Austria, instead of a Burkhard. His residence was proba- bly at Pöchlarn, but maybe already Melk, where his successors resided. The territory, which originally had only coincided with the modern Wachau, was enlarged in the east at least as far as the Wienerwald. He died at Würzburg. The millennial anniversary of his appointment as margrave was celebrated as Thousand years of Austria in 1976. Celebrations under the same title were held twenty years later at the anniversary of the famous Ostarrîchi document first mentioning the Old German name of Austria. -

An Analysis of 12Th-Century Hungarian-German Diplomatic Relations
Sociology and Anthropology 4(8): 738-746, 2016 http://www.hrpub.org DOI: 10.13189/sa.2016.040808 Characteristic Features of Medieval Geopolitical Considerations: An Analysis of 12th-Century Hungarian-German Diplomatic Relations Máté Kavecsánszki MTA-DE Ethnology Research Group, Hungary Copyright©2016 by authors, all rights reserved. Authors agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 international License. Abstract The objective of this research project is to to the Christian faith, the ensuing change of lifestyle, the present a significant time period in the system of diplomatic settlement in the Carpathian Basin, the adoption of West relations between the Kingdom of Hungary and the Holy European political, economic, and social patterns, and the Roman Empire in the 12th century. My intention has been to establishment of contacts with the neighboring states (such focus on the effects of the rule of the Hohenstaufen dynasty as the Holy Roman Empire, the Byzantine Empire, and on Hungarian foreign policy. I have examined this issue as Poland) are all periods of Hungarian history which have been embedded in a broad international system of relations, thoroughly investigated and explored even by historians in including Hungarian-Polish, Hungarian-Czech, Europe (see, e.g. Berend, Urbanczyk, Wiszewski 2013 [3]; German-Polish, German-Czech, and German-Hungarian Jaritz, Szende 2016 [14]; Kristó 1992 [16 p128-133]; Kristó connections. I have also investigated the Hungarian foreign 1993 [18]; Kristó 1996 [19]; Kristó 2002 [20 p39-47]; Szabó policy relevance of the conflict between the Hohenstaufen 2012 [33 p9-21]; Zsoldos 2001 [38]). -

The Creation of the Postwar Austrian Nation Dissertation
The creation of the postwar Austrian nation Dissertation to obtain the doctoral degree at the Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences University of Rostock submitted by mgr Piotr Andrzejewski Supervisors: Prof. Piotr Madajczyk Prof. Stefan Creuzberger Supporting supervisor: Dr Paweł Popieliński 2019 1 2 Author’s declaration I declare that this thesis was composed by the candidate, Piotr Andrzejewski, and has not been accepted in any previous application for a degree. The research for this thesis was undertaken by the candidate. All quotations have been distinguished by quotation marks or indentation and the sources of information used for my research have all been specifically acknowledged. SIGNED…………………………………….. DATE…………………… 3 Table of Contents Introduction ......................................................................................................................................... 5 1. Methods and theories ..................................................................................................................... 8 1.1 State of the art – the Austrian nation .......................................................................................... 8 1.2 Methodology ............................................................................................................................... 11 1.3 Basic terminology ........................................................................................................................ 13 1.4. Not so basic terminology - the significance of nation ............................................................... -

Analytical Investigation of the Inks and Dyes Used in the Privilegium Maius
Preprints (www.preprints.org) | NOT PEER-REVIEWED | Posted: 31 May 2019 doi:10.20944/preprints201905.0376.v1 Peer-reviewed version available at Molecules 2019, 24, 2197; doi:10.3390/molecules24122197 Article It’s only a part of the story: analytical investigation of the inks and dyes used in the Privilegium maius Elisa Calà 1, Fabio Gosetti 1, Monica Gulmini 2, Ilaria Serafini 3, Alessandro Ciccola 3, Roberta Curini 3, Annalisa Salis 4, Gianluca Damonte 4, Kathrin Kininger 5, Thomas Just 5 and Maurizio Aceto 1,* 1 Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, Università degli Studi del Piemonte Orientale, viale T. Michel, 11 - 15121 Alessandria, Italy; [email protected] 2 Dipartimento di Chimica, Università degli Studi di Torino, via P. Giuria, 7 - 10125 Torino, Italy; [email protected] 3 Dipartimento di Chimica, Università di Roma “La Sapienza”, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma, Italy; [email protected] 4 Centre of Excellence for Biomedical Research (CEBR), Università degli Studi di Genova, viale Benedetto XV, 5 - 16132 Genova, Italy; [email protected] 5 Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Minoritenplatz 1 - 1010 Wien, Austria; [email protected]; [email protected] * Correspondence: [email protected]; Tel.: +39-0131-360-265 Abstract: The Privilegium maius is one of the most famous and spectacular forgeries in medieval Europe. It is a set of charters made in 14th century upon commitment by duke Rudolf IV, a member of the Habsburg family, to elevate the rank and the prestige of his family. These five charters, now kept at the Österreichisches Staatsarchiv in Vienna, have been subjected to a thorough interdisciplinary study in order to shed light on its controversial story. -

Europa Und Welt Europe and the World Europa Und
696 739 774 798 811 860 907 987 996 Um | ca. 1010 1072 1077 1106–1147 1136 1167 1177–1183 1216–1228 1287 1297 1328 1342 1348/49 1365–1396 1403 1404 1431 1452 1465–1480 1490 1495–1519 1519 Im Auftrag des bayerischen Herzogs Salzburg wird durch den hl. Bonifatius Bischof Virgil weiht den Bischof Arn (785–821) wird erster Kaiser Karl der Große legt die Drau König Ludwig der Deutsche stattet Der Salzburger Erzbischof Theotmar Erzbischof Friedrich I. (958–991) Kaiser Otto III. verleiht der Erweiterung des Salzburger Doms Erzbischof Gebhard I. (1060–1088) Beginn des Festungsbaus in Der Salzburger Erzbischof Baubeginn des Almkanals Im Streit zwischen Papsttum und Kaiser- Erzbischof Konrad III. von Wittelsbach Erzbischof Eberhard II. (1200–1246) Erzbischof Rudolf von Hoheneck Erzbischof Konrad IV. (1291–1312) Erzbischof Friedrich III. von Leibnitz Erzbischof Heinrich von Pirnbrunn In Salzburg bricht die Pest aus, Das Erzstift Salzburg erreicht seine Im so genannten Igelbund schließen Verbrennung und Vertreibung von In den Benediktinerklöstern in der Der Salzburger Erzbischof Sigmund I. Erweiterung der Salzburger Salzburg verliert an der Seite des Erzbischof Leonhard von Keutschach Kardinal Matthäus Lang, zuvor Kanzler gründet der hl. Rupert Salzburg auf im Auftrag des Papstes zu einem der ersten Salzburger Dom Erzbischof von Salzburg und damit als Grenze des Salzburger Missions- die Salzburger Kirche in Karantanien (874–907) fällt in der Schlacht bei trennt die bisher in Personalunion Stadt Salzburg das Markt-, unter Erzbischof Hartwig (991–1023)