Habsburg Hofrat Heuriger
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Reshaping a Tradition. Founding the Habsburg-Lorraine Dynastic State in the 18Th Century
Исторические исследования www.historystudies.msu.ru _____________________________________________________________________________ Лебо К. Reshaping a tradition. Founding the Habsburg-Lorraine dynastic state in the 18th century Аннотация: В статье исследуются компоненты власти в композитарной монархии Габсбургов и конструирование политической легитимности посредством управленческих практик, сочинений, речей и изображений. Монархия Габсбургов в XVIII в. не представляла собой однородного целого, объединяя территории с различной степенью интеграции. Выборность корон и их переходы от одной ветви рода к другой создавали сложную ситуацию, в которой Габсбургам удавалось утвердить свое господство, сочетая следование традиции и изменения. Административные реформы поддерживались символическим дискурсом. Династический дискурс пришел на смену истории правящего дома и стал способом утвердить принцип государственного интереса. Власть династии была основана на доминировании над территорией. Новые вертикальные связи исходили от Марии Терезии, распространяя ее господство за пределы владений Австрийского дома. На своих более чем двухстах портретах Мария Терезия всегда изображалась с регалиями, вид которых варьировался в зависимости от места, где картина должна была находиться, с тем, чтобы подчеркнуть своеобразие каждой территории и единство монархии, связь между правителем и подвластной территорией. Ключевые слова: династическое государство, дом Габсбургов, империя, институциональные реформы, композитарная монархия, наследственная монархия, символический -

Ein Historisches Ereignis Von Europäischer Dimension
Tobias Appl Ein historisches Ereignis von europäischer Dimension Auf der Barbinger Wiese wurde im September 1156 die Markgrafschaft Österreich von Bayern abgetrennt und zum Herzogtum erhoben Im September 2006 jährte sich die Erhebung der bis dahin zu Bayern gehörigen Markgrafschaft Österreich zu einem eigen- ständigen Herzogtum zum 850. Mal1. Dieses herausragende historische Ereignis ist nicht nur für die bayerische, öster- reichische, ja sogar europäische Geschichte von erheblicher Bedeutung, sondern hat für Stadt und Landkreis Regensburg darüber hinaus auch eine regionalgeschichtliche Dimension2. Denn diese Erhebung Österreichs wurde im Rahmen eines Regensburg kaiserlichen Hoftages in Regensburg beschlossen und durch- geführt. Die feierliche lehensrechtliche Zeremonie hierbei fand in prato Barbingin, also auf der Barbinger Wiese statt. Passau Neben der Darstellung der Ereignisse, die zu diesem Regens- Wien burger Hoftag 1156 führten, sowie der Schilderung desselben Freising Enns soll im Folgenden die Frage nach einer genaueren Lokalisie- rung des Geschehens im Mittelpunkt stehen. Salzburg Vorgeschichte Brixen Bei seinem Tod am 15. Februar 1152 hinterließ König Kon- rad III. aus der Familie der Staufer seinem Nachfolger einen Konflikt, der diesem diplomatisches Fingerspitzengefühl und politisches Durchsetzungsvermögen abverlangen sollte. Es ging um nichts weniger als die Zukunft des Herzogtums Bay- Abb. 1: Das Herzogtum Bayern vor und nach 1156. 23 Regensburger Land . Band 1 . 2008 ern und um einen damit verbundenen Ausgleich zwischen den bruder Markgraf Leopold aus dem Geschlecht der Babenber- sich gegenüberstehenden Familien der Welfen und der Baben- ger. Neben Leopold band der neue König auch dessen älteren berger. Bruder Heinrich Jasomirgott sowie die jüngeren Geschwister Denn nachdem Konrad am 13. März 1138 überraschend Otto und Konrad, welche beide in der Reichskirche Karriere zum König gewählt worden war, hatte er umgehend dafür machen sollten, eng an sich3. -

Babenbergrische OSTMARK
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich Jahr/Year: 1903 Band/Volume: 2 Autor(en)/Author(s): Lampel Joseph Artikel/Article: Die Babenbergische Ostmark 1-76 ©Verein für Landeskunde von Niederösterreich;download http://www.noe.gv.at/noe/LandeskundlicheForschung/Verein_Landeskunde.html DIE BABENBERGrISCHE OSTMARK UND IHRE »TRES COMITATUS«. V on DR. JOSEF LAMPEL. Jahrbuch d. V. f. Landeskunde. 1903. 1 ©Verein für Landeskunde von Niederösterreich;download http://www.noe.gv.at/noe/LandeskundlicheForschung/Verein_Landeskunde.html ©Verein für Landeskunde von Niederösterreich;download http://www.noe.gv.at/noe/LandeskundlicheForschung/Verein_Landeskunde.html § 1. Ein Gedanke, 4er schon in jenem ersten, der Topo graphie der Gerichtsverwaltung unserer deutschen Donauländer gewidmeten Artikel vorgewaltet hat, die D reiteilung der Mark in gerichtlicher Beziehung, beziehungsweise die Frage nach der Art dieser Dreiteilung, wird auch in den nun folgenden Erör terungen sehr stark in den Vordergrund treten. Denn wie bekannt, hat man die drei Grafschaften der karolingischen Ostmark, welche den Gegenstand der ersten Betrachtung gebildet haben, mit den drei Grafschaften, von denen Bischof Otto von Freising spricht, pnd diese wieder mit den drei Dingstätten und den vermeintlich damit verknüpften drei großen Gerichtsbezirken des späteren Öster reich in Verbindung gebracht. Soweit diese eben in den Mahlstätten zu Mautern, Tulln und Korneuburg ihre Mittelpunkte hatten und durch sie zum Ausdruck kamen, boten sie einer bestimmten Rich tung der »Tres comitatus«-Forschung willkommenen Anhaltspunkt, ältere Einrichtung in späteren wiederzufinden. Aufgabe der folgen den Untersuchung wird es qun sein, diese Anschauungen auf ihre Berechtigung zu prüfen. Es wird dabei wohl auch, und zwar zu nächst das rechtsgeschichtliche, aber doch hauptsächlich das topo graphische Moment zur Geltung gelangen. -
A Concise History of Austria Steven Beller Index More Information
Cambridge University Press 978-0-521-47886-1 - A Concise History of Austria Steven Beller Index More information INDEX Aachen (Aix-la-Chapelle) 45, 114 army (Habsburg, Austrian) 71, 74, 88, Abraham a Sancta Clara (Johann Ulrich 91, 110, 116, 126, 131, 134, 138, Megerle) 69 145, 146, 165–6, 186–90, 273, 293 Adler, Alfred 171, 213 Austrians in the German army Adler, Friedrich 188, 204 (Wehrmacht and SS) 241–3, 259, Adler, Max 158, 206, 214 291, 300 Adler, Victor 154, 158, 188 Aspern-Essling 111 Admont 95 Augarten 94 Aehrenthal, Baron Lexa von Augsburg 13, 47, 48, 53 180–2 Austerlitz 108, 111 Albania, Albanians 71, 183 Austrian People’s Party (OVP)¨ (see also Albrecht I 27, 28 Christian Socials) 254–5, 263, Albrecht II 28, 29–30 270–1, 273, 274, 275, 279, 284, Alemanii 11, 14, 17, 29 287, 290, 295–6, 299, 300, 302–5 Allgemeines Krankenhaus (general ‘Austro-Keynesianism’ 274, 282, 283 hospital) 98, 285 Austro-Marxism 171, 174, 206, 214 Alliance for the Future of Austria Avars 12–13, 15 (BZO)¨ 306 Alpbach 268 Babenberg dynasty 13, 15–23, 26, 27, Alsace, Alsace-Lorraine 27, 31, 62, 63, 30, 191, 201, 224 190 Bach, Alexander 131–2 Alt Aussee 245 Bach, David Josef 206, 214 Altranstadt¨ 74 Badeni, Count Casimir; Badeni Anderl of Rinn 286 Ordinances 161–2, 163, 165, 169 Andrassy,´ Count Gyula 149–51 Bad Leonfelden 22, 61, 63, 77, 98, 118, Andrian, Leopold von 214 119, 163, 173, 240, 249, 250, 257, Andrian-Werburg, Viktor von 269–70, 274, 280 118 Baroque 64, 66–9, 75–7, 81, 87, 91, Androsch, Hannes 273–4, 283 95, 163, 175, 176, 201, 217, 219 anti-Semitism -

The Austrian Great Privilege
Volume 1. From the Reformation to the Thirty Years’ War, 1500-1648 Forgery in Favor of Territorial Sovereignty – Privilegium Maius (1358/59) This notorious Austrian forgery dates from the fourteenth century, when the practical devolution of royal authority to the princes was in full swing. Commissioned by Duke Rudolf IV of Austria, it illustrates the degree of independence to which the great princely dynasties of the Empire aspired, but did not yet possess. The forged document purports to be a charter issued by Emperor Frederick I Barbarossa in 1156, and it aims to improve the position of the House of Austria within the Empire, among other things. It describes an event that never took place, the transformation of an Imperial fief into a hereditary principality through the devolution of regalian (royal) rights to the archdukes of Austria. Emperor Charles IV (1316-1378) did not confirm the Privilegium Maius since he doubted its authenticity; it was eventually confirmed by the Habsburg Emperor Frederick III (1415-93) in 1453, however. The document wasn’t officially proven to be forgery until 1852, at which time the Holy Roman Empire no longer existed. Privilegium Maius In the name of the holy and indivisible Trinity, Frederick, by the power of God's grace Roman Emperor and ever Conserver of the Empire. Although a mutation of things can gain legality through personal intervention, and although that which was originally legal cannot be overturned by any objection, yet, so that no doubt attaches to an act undertaken, Our Imperial authority -

Hamburg: an Imperial City at the Imperial Diet of 1640-'41 a New Diplomatic
Hamburg: an Imperial City at the Imperial Diet of 1640-‘41 a New Diplomatic History Master thesis F.A. Quartero, BA S1075438 Houtstraat 3 2311 TE Leiden Supervisor: Dr. M.A. Ebben Doelensteeg 16 2311 VL Leiden Room number 2.62b 23.082 words 2 Table of contents Introduction 4 Chapter I: The Empire, Hamburg and the Duke of Holstein 12 Hamburg’s government 13 ‘Streitiger Elbsachen’: Hamburg and the Duke of Holstein 19 The Empire: Hamburg’s far friend 22 Chapter II: Hamburg’s political ambitions and diplomatic means 26 Goals 27 1. Commerce 27 2. Territory 31 3. Contributions 32 Means 33 1. Gratification 33 2. Publicising 36 3. Diplomatic support 38 4. Law enforcement 40 Hamburg’s diplomacy 43 Chapter III: Much to declare: Barthold Moller’s Regensburg accounts 45 Revenue 47 Expenses 51 1. Representation 51 2. NeGotiation 54 3. Information 54 4. Affiliation 60 Hamburg’s Imperial politics 69 Conclusion 72 Bibliography 76 3 Figure 1: ‘Niedersachsen and Bremen, 1580’, at: Martin Knauer, Sven Tode (ed.), Der Krieg vor den Toren: Hamburg im Dreißigjährigen Krieg 1618-1648, (HamburG 2000), 150-151. 4 Hamburg An Imperial City at the Imperial Diet of 1640-‘41 Over time, the Holy Roman Empire has been subjected to many revaluations. Nineteenth century historians considered it a weak state, after the German aGGressions of the First and Second World War scholars sought clues for a ‘Sonderweg’ in history that had lead the German proto-nation away from democratic principles and towards totalitarianism, followed by a reappraisal of the Imperial institutions -

Medieval Majesty Gothic Masterpieces from St
SPECIAL EXHIBITION MEDIEVAL MAJESTY GOTHIC MASTERPIECES FROM ST. STEPHEN'S CATHEDRAL Palace Stables, Lower Belvedere from 14 May, 2019 Herzog Rudolf IV. der Stifter Photo: Johannes Stoll © Belvedere, Vienna IN-SIGHT: MEDIEVAL MAJESTY GOTHIC MASTERPIECES FROM ST. STEPHEN'S CATHEDRAL Palace Stables, Lower Belvedere from 14 May, 2019 St. Stephen’s Cathedral in the heart of Vienna is the city’s most famous landmark. It is adorned with works of medieval stonemasonry reflecting an exceptional quality. Six of the most impressive sculptures, the famous figures of rulers from the west façade and High Tower, are currently on display in the Palace Stables. They number among the masterpieces from the collection of Wien Museum and, while this is being renovated, are on show at the Belvedere. “The Belvedere’s collection of medieval art in the Palace Stables comprises a multitude of precious works from this era, ranging from a Romanesque crucifix to Gothic panel paintings and sculptures, to winged altarpieces from the Early Modern period. The famous ‘Fürstenfiguren’ (figures of rulers) from St. Stephen’s Cathedral are presented here in a fitting setting and are sure to enrich visitors’ experience of the museum,” said CEO Stella Rollig. The famous “Fürstenfiguren” from Vienna’s St. Stephen’s Cathedral belong to the very best among Austria’s cultural assets. They were created in the course of the cathedral’s extension under Duke Rudolf IV, the Founder, who power-consciously presented himself with his wife, the Emperor’s daughter Catherine of Bohemia, and both his and her parents in this monumental sculptural ensemble. Curator Veronika Pirker-Aurenhammer: “More than any of the Austrian rulers before him, the young, ambitious duke knew how to use the arts for self-display. -

"Germans" and "Austrians" in World War II: Military History and National Identity
"Germans" and "Austrians" in World War II: Military History and National Identity Peter Thaler Department of History University of Minnesota September 1999 Working Paper 99-1 ©1999 by the Center for Austrian Studies (CAS). Permission to reproduce must generally be obtained from CAS. Copying is permitted in accordance with the fair use guidelines of the U.S. Copyright Act of 1976. CAS permits the following additional educational uses without permission or payment of fees: academic libraries may place copies of CAS Working Papers on reserve (in multiple photocopied or electronically retrievable form) for students enrolled in specific courses; teachers may reproduce or have reproduced multiple copies (in photocopied or electronic form) for students in their courses. Those wishing to reproduce CAS Working Papers for any other purpose (general distribution, advertising or promotion, creating new collective works, resale, etc.) must obtain permission from the Center for Austrian Studies, University of Minnesota, 314 Social Sciences Building, 267 19th Avenue S., Minneapolis MN 55455. Tel: 612-624-9811; fax: 612-626-9004; e-mail: [email protected] The concept of Austrian nationhood played a central role in the public discourse of postwar Austria. Unlike its interwar predecessor, which was characterized by doubts about its purpose and viability and by persistent calls for closer affiliation with Germany, Austria’s Second Republic rested in itself and emphasized its distinction from its northwestern neighbor. Increasingly, this distinction was -

Schnell Ý Steiner
Peter Schmid " Heinrich Wanderwitz (Hrsg. ) DIE GEBURT ÖSTERREICHS 850 Jahre Privilegium minus SCHNELLý STEINER Roman Deutizzgez" Das Privilegium minus, Otto von Freising und der Verfassungswandel des 12. Jahrhunderts Die Urkunde, die Kaiser Friedrich Barbarossa am 17. September 1156 über die Vereinbarungen des vorangegangenen Regensburger Reichstags ausstellte, und der Bericht, den Otto von Freising zwei Jahre später in seinen Gesta Friderici über diese Vorgänge niederschrieb, bilden Österreichs für uns die beiden wichtigsten Quellen über die Erhebung zum Herzogtum. Beide Texte bergen eine Fülle von Interpretationsproblemen; soweit sie rein quellenkritischer Natur sind, werden sie in anderen Beiträgen dieses Bandes behandelt. Im folgenden sollen vielmehr die verfassungsgeschichtlichen Deutungsschwierigkeiten in den Blick genommen werden, die Privilegium minus und Gesta Friderici aufiverfen. Dabei werden drei Problemkreise im Zentrum der Betrachtung stehen: zuerst die lehnrechtliche Bedeutung des Gesamtvorgangs (I); dann die Bedeutung der einzelnen durch die Urkunde verbrieften Privilegien für die tatsäch- lichen Verfassungszustände des 12. Jahrhunderts (II); die Frage den zuletzt nach drei Grafschaften", die Ottos Bericht her" Mark Österreich nun zufolge von alters zur gehörten und zusammen mit dieser das neugeschaffene Herzogtum bildeten (III). Alle drei Problemkreise sol- len jeweils vor dem Hintergrund des allgemeinen Verfassungswandels im 12. Jahrhundert ver- ortet werden, wobei diese Perspektive nicht nur das Verständnis für diese Fragen verbessern kann, sondern gleichzeitig umgekehrt das rechte Verständnis der beiden Texte auch helfen kann, diesen allgemeinen Verfassungswandel besser zu begreifen. Angesichts des Umstandes, dass beide Quellen, ihrer Bedeutung entsprechend, schon vielfach Gegenstand gelehrter Bemühungen gewesen sind, kann es dabei weniger um die Präsentation von umwälzenden Entdeckungen oder Neuerkenntnissen gehen als vielmehr um die kritische Auseinandersetzung mit bisherigen Deutungen. -

European Elites and Ideas of Empire, 1917…1957
EUROPEAN ELITES AND IDEAS OF EMPIRE, 1917–1957 Who thought of Europe as a community before its economic integra- tion in 1957? Dina Gusejnova illustrates how a supranational European mentality was forged from depleted imperial identities. In the revolutions of 1917–1920, the power of the Hohenzollern, Habsburg, and Romanoff dynasties over their subjects expired. Even though Germany lost its credit as a world power twice in that century, in the global cultural memory, the old Germanic families remained associated with the idea of Europe in areas reaching from Mexico to the Baltic region and India. Gusejnova’s book sheds light on a group of German-speaking intellectuals of aristocratic origin who became pioneers of Europe’s future regeneration. In the minds of transnational elites, the continent’s future horizons retained the con- tours of phantom empires. This title is available as Open Access at 10.1017/9781316343050. dina gusejnova is Lecturer in Modern History at the University of Sheffield. new studies in european history Edited by peter baldwin, University of California, Los Angeles christopher clark, University of Cambridge james b. collins, Georgetown University mia rodriguez-salgado, London School of Economics and Political Science lyndal roper, University of Oxford timothy snyder, Yale University The aim of this series in early modern and modern European history is to publish outstanding works of research, addressed to important themes across a wide geographical range, from southern and central Europe, to Scandinavia and Russia, from the time of the Renaissance to the present. As it develops, the series will comprise focused works of wide contextual range and intellectual ambition. -
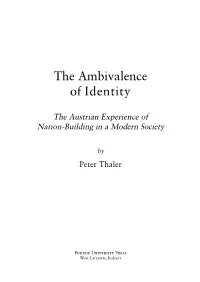
The Ambivalence of Identity
The Ambivalence of Identity The Austrian Experience of Nation-Building in a Modern Society by Peter Thaler Purdue University Press West Lafayette, Indiana 2 Catalyst or Precondition The Socioeconomic Environment of Austrian Nation-Building or much of the postwar era, the scholarly interpretation of contemporary Austrian history centered on the concept of an FAustrian nation that had ¤nally found its destiny, guided by political leaders who had overcome their former disagreements for the good of the country.1 The differences between the interwar and the postwar developments gained particular attention; Austria’s second republic was demarcated from its ¤rst. The modest Alpine republic with the historic name that had arisen from the ashes of the Habsburg Monarchy had been described as the “the involuntary state,” as re¶ected in the title of Reinhard Lorenz’s study, and “the state that no one wanted,” as Hellmut Andics named his popular book.2 Drawing on the latter title, the reemerged republic of the postwar era would widely be characterized as “the state that everyone wanted.”3 Leading foreign analysts of Austrian nation-building also respected these interpretative perimeters.4 William Bluhm’s classic Building an Austrian Nation introduced valuable tools of analysis into the Austrian debate; indeed, its contribution is greatest from a methodological point of view. The American political scientist utilized polls for the broader picture of Austrian public opinion but also conducted individual inter- views with members of the political elites. He examined the structural dynamics of postwar Austrian society and contrasted them with earlier time periods. Ultimately, however, he remained bound to an analytical 26 The Ambivalence of Identity approach that juxtaposes a successful postwar integration with a previ- ous history of disintegration and does not probe the contractual con- sensus model that informs it. -

Notes and References
Notes and References Introduction 1. Hans Sturmberger, Aufstand in Bbhmen. Der Beginn des dreifUgjahrigen Krieges (Munich/Vienna: R. Oldenbourg Verlag, 1959). 2. ]. V. Polisensky and Frederic Snider, War and Society in Europe, 1618-1648 (Cambridge University Press, 1978), p. 55; see also Polisensky's The Thirty Years' War, trans. Robert Evans (London: Batsford, 1971). 3. Prominent among these is ]aroslav Panek, 'The Religious Question and the Political System of Bohemia before and after the Battle of the White Mountain', in R. ] . W. Evans and T. V. Thomas (eds), Crown, Church and Estates. Central European Politics in the Sixteenth and Seventeenth Centuries (New York: St. Martin's Press, 1991), pp . 129-48. We still lack a recent monograph of the Bohemian side of the conflict. However, Christine van Eickels has made the Silesian participation in the Bohemian Confederation the topic of her book Schlesien im biihmischen Stiindestaat. Voraussetzung und Verlauf der bah mischen Revolution von 1618 in Schlesien (Colonge: Bohlau Verlag, 1994); see also Josef Valka, 'Moravia and the Crisis of the Estates' System in the Lands of the Bohemian Crown', in Evans and Thomas, Crown, Church and Estates, pp . 149-57; Karolina Adamova, 'K otazce cesko-rakouskeho a cesko-uherskeho konfederacniho hnuti v letech 1619-1620' [The Question of the Bohemian-Austrian and Bohemian-Hungarian Confederation Movement of 1619-1620] .Pravnehistoricke studie, 29 (1989), pp. 79-90; and Vac lav Buzek, 'NiB i slechta v predbelohorskych cechach (Prameny, metody, stav a perspek tivy badani)', [The Lower Nobility of Bohemia at the time before the Battle of the White Mountain (Sources, Methods, State and Perspectives of Research)], Cesky casopis historicky, 1 (1993), pp.