Äpfel Und Birnen Aus Luxemburg
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
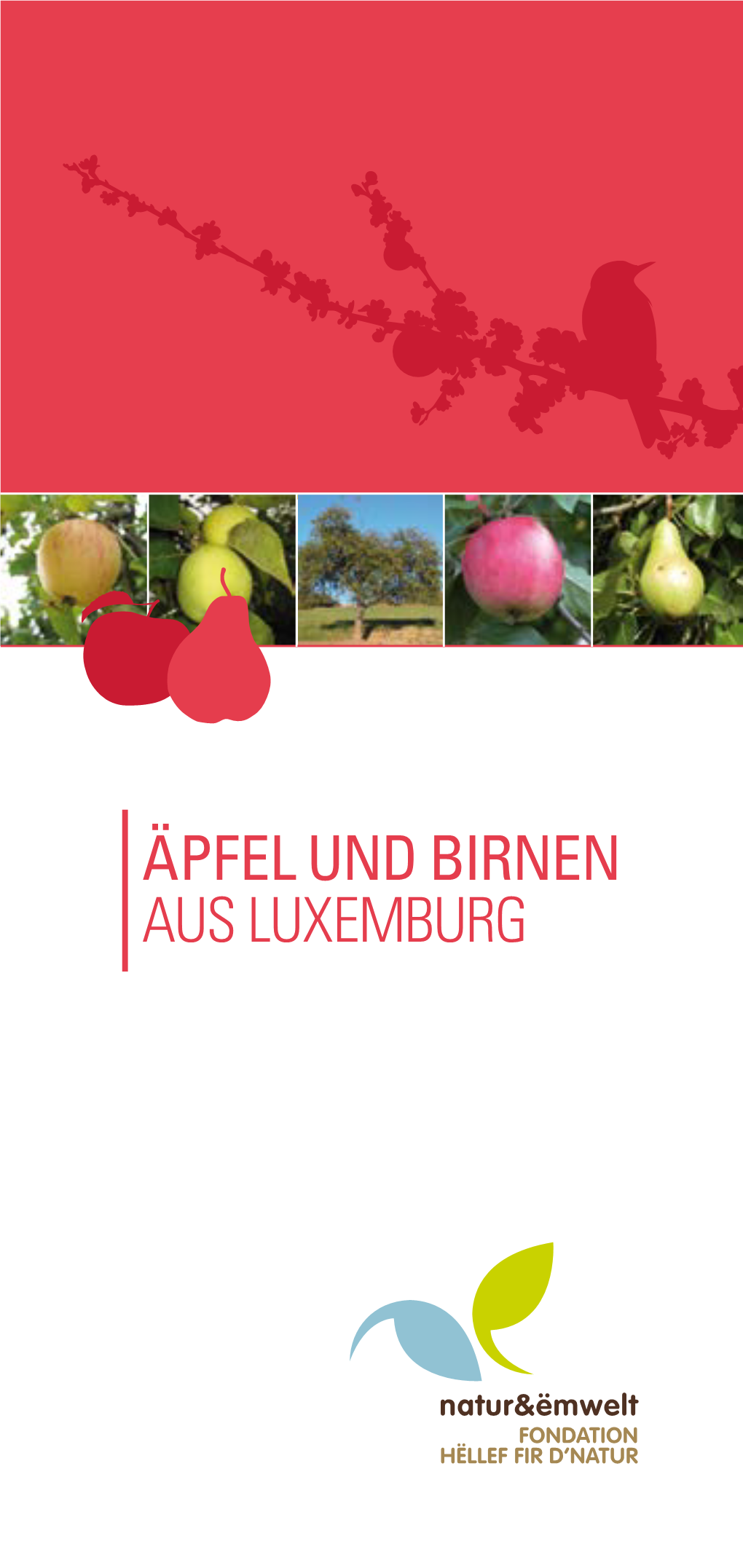
Load more
Recommended publications
-

The 9Th Annual Great Lakes International Cider & Perry
The 9th Annual Great Lakes International Cider & Perry Competition March 23, 2014 St. Johns, Michigan Results Analysis Eric West Competition Registrar GLINTCAP 2014 Medalists A-Z Noncommercial Division Alan Pearlstein - Michigan Apple Anti-Freeze New England Cider Silver Commerce Township Table Cider Common Cider Silver Andrew Rademacher - Michigan Tin Man Hard Cider Specialty Cider & Perry Bronze Andrew Schaefer - Michigan Rome Crab Common Cider Silver Spy Turley Common Cider Silver Crab Common Cider Bronze Bill Grogan - Wisconsin Northern Dragon Wood Aged Cider & Perry Bronze C. Thomas - Pennsylvania Gilbert + Hale Common Cider Bronze Charlie Nichols - Michigan Black Moon Raspberry Mead Other Fruit Melomel Bronze Char Squared Raspberry Hard Apple Cider Fruit Cider Bronze Staghorn Moon Spiced Hard Apple Cider Specialty Cider & Perry Bronze Charlie Nichols & Joanne Charron - Michigan Staghorn Moon Raspberry Hard Apple Cider Fruit Cider Bronze Chris McGowan - Massachusetts Applewine Applewine Bronze Cherry Cider Specialty Cider & Perry Bronze Rum Barrel Cider New England Cider Bronze Christopher Gottschalk - Michigan Leo Hard Cider Specialty Cider & Perry Bronze Claude Jolicoeur - Quebec Cidre de Glace Intensified (Ice Cider) Silver Colin Post - Minnesota Deer Lake - SM Common Cider Silver Deer Lake - Lalvin Common Cider Bronze Deer Lake - WL/Wy Mix Common Cider Bronze Great Lakes Cider & Perry Association Page 2 www.greatlakescider.com GLINTCAP 2014 Medalists A-Z Noncommercial Division David Catherman & Jeff Biegert - Colorado Red Hawk -

Cider and Fruit Wine
Dosage Product Description Application (g or mL per 100 kg/L) Dry selected pure yeast for clean Oenoferm® Cider, German Apfelwein 20 – 30 Cider fermentation Oenoferm® Bio Organic pure yeast Cider, mead, red fruit wines 20 – 40 Oenoferm® Yeast Fast-fermenting Bayanus yeast Cider/Perry 20 – 30 Freddo and fruit Oenoferm® Fast-fermenting hybrid yeast Cider, mead, fruit wine 20 – 30 X-treme ® See product VitaDrive F3 Yeast activator Rehydration data sheet Vitamon® Liquid Liquid yeast nutrition Continuous dosage during fermentation Up to 200 wine Vitamon® Plus Nutrition complex Cider fermentation 20 – 100 VitaFerm® Ultra F3 Multi-nutrition complex Difficult to ferment media 30 – 40 Yeast nutrition VitaFerm® Bio Deactivated organic yeast Yeast nutrition for organic fruit wine 30 – 40 Kadifit Potassium metabisulphite, powder Oxidation prevention and microbiological stabilisation 5 – 25 Solution Sulfureuse P15 Liquid SO2, 15% SO2 Oxidation prevention and microbiological stabilisation 5.5 – 55 Blancobent UF Special bentonite, no particles Fining, in-line stabilisation in crossflow filter systems 5 – 200 FloraClair®/LittoFresh® Vegetable fining protein Tannin adsorption, fining 10 – 40 Tannivin® Galléol Fully hydrolysable tannin from oak galls Beverage fining and flavour enhancement 3 – 20 Tannivin® Structure Oenological tannin from quebracho Improved structure and oxidation prevention 3 – 20 Granucol® GE Granulated activated plant charcoal Adsorption of bitter notes 30 – 150 Ercarbon SH Powdered plant charcoal Odour and flavour harmonisation 30 -

Welcome, Dear Guests!
Welcome, dear guests! For more than 100 years, the Homburger Hof has been an Apfelwein-pub and as such we would like to take it to the future. In extraordinary times, creative solutions and a mindful cooperation are required. Through various activities we try to offer you and ourselves the best possible protection: For example with a mobile air filter system in all rooms or plexiglass dividers. In the end, we can only master the current challenge together. My team and I wish to experience the Frankfurt way of life with you by offe- ring traditional cuisine and a largeselection of Apfelwein-types. It is all about combining the well-proven old and the promising new. That is why our cuisine includes seasonal and regionalproducts that simply taste great. Should you have questions regarding allergens, we will be happy to help and prepare a dish according to your wishes. I grew up living in Hattersheim. After my education as a hotel specialist, I gained lots of gastronomic experience in many places all over the world. After having fallen in love with Apfelwein and all that comes along, I started looking for my own gastronomic business. So here I am and together with my team I am looking forward to beautiful days and cosy evenings with you. Be our guest and enjoy the Bembelkultur in the middle of Eckenheim! Welcome! Andreas Kimmel and team bembelkultur.de homburger_hof Seasonal Menu soup pumpkin cream soup 1,2 with croutons and pumpkin seed oil 5,90 € salad Salad plate with goat cheese thaler 5 and caramelized pumpkin wedges 14,90 € vegetarian -
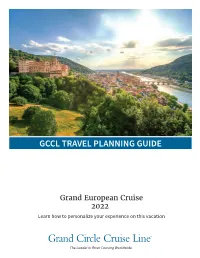
To View Online Click Here
GCCL TRAVEL PLANNING GUIDE Grand European Cruise 2022 Learn how to personalize your experience on this vacation Grand Circle Cruise Line® The Leader in River Cruising Worldwide 1 Grand Circle Cruise Line ® 347 Congress Street, Boston, MA 02210 Dear Traveler, At last, the world is opening up again for curious travel lovers like you and me. Soon, you’ll once again be discovering the places you’ve dreamed of. In the meantime, the enclosed Grand Circle Cruise Line Travel Planning Guide should help you keep those dreams vividly alive. Before you start dreaming, please let me reassure you that your health and safety is our number one priority. As such, we’re requiring that all Grand Circle Cruise Line travelers, ship crew, Program Directors, and coach drivers must be fully vaccinated against COVID-19 at least 14 days prior to departure. Our new, updated health and safety protocols are described inside. The journey you’ve expressed interest in, Grand European Cruise River Cruise Tour, will be an excellent way to resume your discoveries. It takes you into the true heart of Europe, thanks to our groups of 38-45 travelers. Plus, our European Program Director will reveal their country’s secret treasures as only an insider can. You can also rely on the seasoned team at our regional office in Bratislava, who are ready to help 24/7 in case any unexpected circumstances arise. Throughout your explorations, you’ll meet local people and gain an intimate understanding of the regional culture. Enter the home of a local family in Wertheim for a Home-Hosted Kaffeeklatsch where you will share coffee and cake, and experience what life is like for a typical German family; and chat with a member of Serbia’s Roma community to gain insight into the stigma facing this culture in Europe—and how they are paving the way for a new future for their people. -
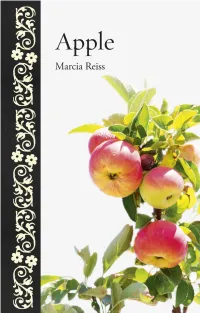
Apple, Reaktion Books
apple Reaktion’s Botanical series is the first of its kind, integrating horticultural and botanical writing with a broader account of the cultural and social impact of trees, plants and flowers. Already published Apple Marcia Reiss Bamboo Susanne Lucas Cannabis Chris Duvall Geranium Kasia Boddy Grasses Stephen A. Harris Lily Marcia Reiss Oak Peter Young Pine Laura Mason Willow Alison Syme |ew Fred Hageneder APPLE Y Marcia Reiss reaktion books Published by reaktion books ltd 33 Great Sutton Street London ec1v 0dx, uk www.reaktionbooks.co.uk First published 2015 Copyright © Marcia Reiss 2015 All rights reserved No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publishers Printed and bound in China by 1010 Printing International Ltd A catalogue record for this book is available from the British Library isbn 978 1 78023 340 6 Contents Y Introduction: Backyard Apples 7 one Out of the Wild: An Ode and a Lament 15 two A Rose is a Rose is a Rose . is an Apple 19 three The Search for Sweetness 43 four Cider Chronicles 59 five The American Apple 77 six Apple Adulation 101 seven Good Apples 123 eight Bad Apples 137 nine Misplaced Apples 157 ten The Politics of Pomology 169 eleven Apples Today and Tomorrow 185 Apple Varieties 203 Timeline 230 References 234 Select Bibliography 245 Associations and Websites 246 Acknowledgements 248 Photo Acknowledgements 250 Index 252 Introduction: Backyard Apples Y hree old apple trees, the survivors of an unknown orchard, still grow around my mid-nineteenth-century home in ∏ upstate New York. -

Open Finnish Championship in Food Craftsmanship 2018 Raseborg 21–23 March 2018
Open Finnish Championship in Food Craftsmanship 2018 Raseborg 21–23 March 2018 Do you manufacture food products from local produce, and without synthetic flavours, preservatives or colouring? Would you like to get feedback on your product’s taste and other characteristics? Check the competition classes and regulations for the Open Finnish Championship in Food Craftsmanship 2018 and register your product for the competition by 18 February 2018! COMPETITION RULES The Open Finnish Championship in Food Craftsmanship preserve the concept of food craftsmanship and the val- 2018 is to be held from 21-23 March 2018 in Raseborg on ues that the term represents. Food artisans are motivated Finland’s south coast. The competition is organized by No- in their work and inspired to develop their businesses and via University of Applied Sciences through the Food of the their products. Consumer awareness increases through the Coast project. The judging of products takes place in Ek- competition and the winning products. In the future this will enäs on March 22 and the awards ceremony will take place lead to increased awareness and sales. on March 23. During the competition, seminars, field trips and other programs that attract and unite enthusiasts in The competition aims to preserve and develop local food food craftsmanship will be organised. cultures through increased visibility, knowledge, product development, sales and jobs. Information and registration: www.novia.fi/mathantverkfm/en n CONTEST RULES The Open Finnish Championship in Food Craftsmanship Through food craftsmanship unique products are created 2018 is open to producers from Finland, other Nordic coun- containing rich flavours and distinct identities, where their tries and the Baltic States. -

Apples Apple Foundation for Science, Culture & Education
$ 30 It’s not just about growing apples apple Foundation for Science, Culture & Education Apple ‘‘It’s not just about growing apples’’ It’s not just about growing apples 2nd Edition: 25th January 2016 CANTEK On behalf of Cantek Foundation for Science, Culture & Education: BOOKS & DOCUMENTARIES Fo undatio Mr. Can Hakan Karaca n for Science, Culture & Education Scientific Adviser: Prf. Dr. Rahmi Türk Editor: Mr. A. Kadir Bozkurt Foundation for Science, Culture & Education Author: Mr. Tamer Utku 2nd Edition Photos: Mr. Attila Özçay We can produce Redactor: Mrs. Mine Akça üretmek yetmiyor Graphic design: Mrs. Semiha Idil However; storing in high quality the products untill consumption became more important. Producer who can not deliver good quality product, does not earn any Money. Address: Antalya Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Therefore; Wrongly stored product does not benet to its producer. 21. Cadde No.1 Antalya _ Türkiye Tel: +90 242 258 17 00 (pbx) Fax: +90 242 258 17 09 The World oldest “cold storage technologies” represent the vital road from production and www.cantekgroup.com, e-mail: [email protected] consumption. Bilgi ve kültür yayınları CANTEK Foundation for Science, Culture and Education, carries on elaborating books and Printing and Binding: Metro Matbaacılık Ltd. Şti. - metro-print.com documentaries to inform the World about the most advanced “Storage and Treatment Technologies” ISBN: 978-605-66106-1-5 Certificate No: 32788 All rights belong to CANTEK Foundation for Science, Culture & Education. Complete or partial reproduction, copy, reedition are not authorised except written authorization. Special Thanks... for scientific search and supports to; Prof. -

Apfel, Birne & Quitte
Apfel, Birne & Quitte Apfel (Malus), Birne (Pyrus) und Quitte (Cydonia) gehören zu den Kernobstgewächsen (Pyrinae) in der Familie der Rosengewächse und stehen seit tausenden Jahren als Obst in Kultur. Kernobst, besonders der Apfel, stellt eine sehr wichtige Tracht für Bienen im Frühjahr dar und es ist das Obst schlechthin. Aus Kernobst werden Säfte, Mus, Trockenobst (Apfelchips, getrocknete Birnen = Kletzen), Konserven, Kompott, Kuchenbelag, Most (Obstwein), Cider und Obstbrände hergestellt. Ein Dicksaft aus Birnen wird Birnenkraut oder Birnenhonig genannt. Die Quitte ist zudem indirekt Namensgeber für das Wort Marmelade von portugiesisch marmelo für Quitte und griechisch melimelon Honigapfel. Aus Quitten werden zudem noch Gelee (Quittenkäs), Likör und Perlwein hergestellt, da die Quitte zwar festfleischig und schwierig zu verarbeiten aber ausgesprochen aromatisch ist. Auch ein Konfekt mit dem Namen Quittenbrot aus Quittenmus und Gelierzucker ist sehr beliebt. Plinius erwähnte bereits Birnenwein. England und die Normandie lieben ihren Apfelwein (Cider). Spätestens seit der Besiedelung des Westens feiert Amerika Johnny Appleseed. Dieser brachte Apfelsamen aus der Alten Welt mit und begann während seiner Reise durch den Westen Apfelbäume zu pflanzen, damit sich die Siedler selbst mit Apfelwein versorgen konnten. Obstwein aus Äpfeln nennt man Cider, aus Birnen Perry und aus Quitten Querry. In der Normandie wird Cider aus verschiedensten Apfelsorten gekeltert, die auf Streuobstwiesen wachsen. Aus Apfelwein wird auch Calvados gebrannt. Fügt man frischen, gärenden Apfelwein und Apfelbrand zusammen, erhält man den in der Normandie und Bretagne bekannten Pommeau, der als Aperitif getrunken wird. Eigentlich ein nach der Portweinmethode hergestellter Apfeldessertwein. Die Hauptmenge an Obstwein, die heutzutage getrunken wird, wird aus Äpfeln bzw. Kernobst hergestellt. -

Cider and Fruit Wine
Cider and fruit wine • Fermentation • Enzymation • Clarification and stabilisation • Processing diagram FermentationFermentation Cider and fruit wines are dependent on alcohol, acids, All Erbslöh yeasts ferment to at least 15-16% ABV in glycerine, carbon dioxide from fermentation and appropriate fermentation conditions. High-perfor- secondary aromatics from fermentation. Provided that mance yeasts, such as Oenoferm® X-treme can gene- the products concerned are not flavoured, fermenta- rate 17% ABV if there is a good nutrient supply. tion is the most important component in determining the finished beverage’s flavour and aroma, in addition Different yeast strains vary with regard to formation of to the substrate to be fermented. fermentation by-products (volatile alcohols, esters), how they behave during fermentation and tolerance • Greatest possible alcohol yield to adverse external conditions (low temperatures, poor • Retention of fruit aroma, “clean” fermentation nutrient supply). Bayanus-type yeasts need fewer nutri- ents and are more alcohol-tolerant than other yeasts. • Suppression of secondary flora (bacteria, wild yeasts) This is why these are particularly suitable for fermenting high-alcohol bases and restarting stuck fermentation. As a rule, pure yeasts for alcoholic fermentation are selected from wine yeasts and habituated to higher alcohol contents through targeted adaptation. CharacteristicsCharacteristics of yeasts Oenoferm® Oenoferm® Bio Oenoferm® Freddo Oenoferm® X-treme Oenoferm® CHA (DE-ÖKO-003) Product type Cider, German -

Addition of Endogenous Tannins for Improving the Quality of Fermented Cider and the Development of a Pomace-Derived Tannin Concentrate
ADDITION OF ENDOGENOUS TANNINS FOR IMPROVING THE QUALITY OF FERMENTED CIDER AND THE DEVELOPMENT OF A POMACE-DERIVED TANNIN CONCENTRATE A Thesis Presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science by Micah Alex Martin August 2017 © 2017 Micah Alex Martin ABSTRACT A consumer acceptability study was conducted to determine acceptability of ciders fortified with endogenous and exogenous tannins as availability of high-tannin cider apples is limiting cider market growth. The results indicate positive consumer preferences for cider fortified with tannin from apple and non-apple sources and consumers’ willingness to pay an additional premium for these products. There are no commercially available apple-derived tannins. Apple pomace, rich in tannins, is an unexploited waste product. Optimized extraction and concentration trials were conducted to determine conditions for enhanced phenolic recovery from pomace, yielding 41 °Brix concentrates with 1.3-2.4% tannins. Ciders prepared with a Red Delicious and Dabinett high-tannin concentrate received positive overall liking scores and showed insignificant changes other than phenolic augmentation. Pomace for tannin production should be low in acidity, and moderate-to-high in fermentable sugars. At typical dosage applications, the increased cost to each 750 mL unit of cider would be $0.12-0.24. BIOGRAPHICAL SKETCH Micah Martin received his Bachelor of Science degree in Mathematics from Pepperdine University in 2009. He worked under the mentorship of Kendra Killpatrick researching Gaussian binomial identities. Upon graduating, Micah went on to obtain his teaching certificate and work as a middle school teacher with Teach for America in Baltimore, MD. -
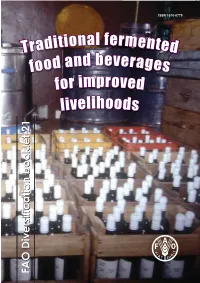
Traditional Fermented Food and Beverages for Improved Livelihoods Traditional the Diversification Booklets Are Not Intended to Be Technical ‘How to Do It’ Guidelines
ISSN 1810-0775 Traditional ferme nted food and beve rages for imp roved livelihoods )$2'LYHUVLÀFDWLRQERRNOHW Diversification booklet number 21 al fe Tradition rmented be food and verages for improved livelihoods Elaine Marshall and Danilo Mejia Rural Infrastructure and Agro-Industries Division Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome 2011 The designations employed and the presentation of material in this information product do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) concerning the legal or development status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The mention of specific companies or products of manufacturers, whether or not these have been patented, does not imply that these have been endorsed or recommended by FAO in preference to others of a similar nature that are not mentioned. The views expressed in this information product are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of FAO. ISBN 978-92-5-107074-1 All rights reserved. FAO encourages reproduction and dissemination of material in this information product. Non-commercial uses will be authorized free of charge, upon request. Reproduction for resale or other commercial purposes, including educational purposes, may incur fees. Applications for permission to reproduce or disseminate FAO copyright materials, and all queries concerning rights and licences, should be addressed by e-mail to [email protected] or to the Chief, Publishing Policy and Support Branch, Office of Knowledge Exchange, Research and Extension, FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy. -

Clarity: Cl Ea CIDER GLOSSARY
● Clarity: cl ea CIDER GLOSSARY ● Acetaldehyde – I s the oxidation of alcohol by alcohol dehydrogenase due to poor storage. Gives off powerful aromas of green apples. ● ACIDS – S ourtasting, or ‘sharp’ substances found in apples. Acids give a refreshing sourness, bright flavor, & a keen, mouthwatering “feel’. To ferment cleanly, raw cider juice needs a strong acid content. ● Apfelwein – Is the German term for cider ● Balance – Is where a cider is in equal harmony with its critical components. Such as: sweetness, acidity, tannin and alcohol ● Bead – Is the streams of bubbles present in a glass of cider once the mousse has dissipated ● Bittersharps – A class of cider apple varieties valued for high tannin content & high acid content. ● Bittersweets – A class of cider apple varieties valued for high tannin content & high sugar content. ● Blending – I s a process where differing ciders of differing characters are skilfully combined to create a perfectly balanced and consistent product ● Brettanomyces – A yeast derived fault smelling like band aids or leather. Poor hygiene, old oak or MLF derived. Can be considered very desirable in farmhouse styles ● Brittany – I s a French Cider region known to produce fruity, low alcoholic, keeved farmhouse ciders. Areas of Cornouaille and Fouesnant are notable apple growing regions ● Brut – I s the French term for dry ● Carbonation – Bubbles in cider by means of bottle fermentation or artificial addition ● Cider Apples – apple varieties that produce superior juice for fermenting. Like wine grapes, cider apples often taste bad. They can be superbitter, supersour, sicklysweet, dry soft or any combination of the above.