200 Jahre Moorburger Schanze
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

THE PORT of HAMBURG FIGURES the Port of Hamburg Is Germany’S Largest Universal Port and a Major Hub for World Trade
FACTS AND THE PORT OF HAMBURG FIGURES The Port of Hamburg is Germany’s largest universal port and a major hub for world trade. Every day, Germa- ny’s imports of goods and services are worth around 3.5 billion euros and its exports are worth around 4.2 billion euros. Foreign trade ensures our prosperity and contributes decisively to economic growth. The Port of Hamburg plays a crucial role: it is the “Gateway to the World” for the economy in Germany and many neigh- boring countries. Around 156,000 jobs depend on the port. It is also Hamburg’s biggest taxpayer, contributing over 910 million euros. Seaborne cargo Seaborne container throughput in 2018 throughput in 2018 How is cargo transported in millions of metric tons in millions of TEU between the Port of Hamburg DID YOU KNOW? Total 135,1 Total 8,7 and the hinterland? • 500 companies from the port services and industry sectors are located in the port Imports 79,7 Loaded containers 7,6 • 212 cruise ships carrying more than 900,000 passengers called at the three cruise terminals in Hamburg in 2018 Exports 55,4 Imports 4,6 48,4% • 2,100 container train connections per week link the Port of Hamburg with all parts of General Cargo 90,9 Exports 4,2 by rail Germany and important regions of Europe Bulk cargo 44,2 • One out of every eight freight trains in Germany has the Port of Hamburg as its destination or origin Only cargo handled between a seagoing vessel and land is counted as 41,4% seaborne cargo. -

URL RECHTS 23.03.1976 LSG Allermöhe
NR INT_GEBIET SCHUTZSTATRECHTSGRUN VERORDNUNG GEBIETSNAM SCHUTZGEBI URL_RECHTS 1 HH-2001 LSG HmbGVBl. 1976, S. 62 23.03.1976 LSG Allermöhe Allermöhe http://www.juris.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-GemAllerLSchTSchVHApP2&doc.part=X&doc. 2 HH-2002 LSG HmbGVBl. 1977, S. 97 19.04.1977 LSG Altengamme Altengamme http://www.juris.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-GemAltenLSchTSchVHApP2&doc.part=X&doc. 3 HH-2003 LSG HmbGVBl. 1962, S. 203 18.12.1962 LSG Altona-Südwest, Ottensen, Othmarschen, Klein Flottbek,Altona-Südwest, Nienstedten, Ottensen, Dockenhuden, Othmarschen, Blankenese, Kleinhttp://www.juris.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-AltonaLSchTSchVHApP2&doc.part=X&doc.origi Flottbek, Rissen Nienstedten, Dockenhuden, Blankenese, Rissen 4 HH-2004 LSG HmbGVBl. 1971, S. 75 13.04.1971 LSG Bahrenfeld Bahrenfeld http://www.juris.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-BahrenLSchTSchVHApP2&doc.part=X&doc.origi 5 HH-2007 LSG HmbBL I 791-s 04.01.1972 LSG Boberg,weitere Boberg,weitere http://www.juris.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-GemBobergwLSchTSchVHArahmen&doc.part=X&do 6 HH-2008 LSG HmbGVBl. 1977, S. 99 19.04.1977 LSG Curslack Curslack http://www.juris.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-GemCursLSchTSchVHApP2&doc.part=X&doc.orig 7 HH-2009 LSG HmbBL I 791-k 19.12.1950 LSG Duvenstedt, Bergstedt, Lemsahl-Mellingstedt, VolksdorfDuvenstedt, und Rahlstedt Bergstedt, Lemsahl-Mellingstedt, Volksdorfhttp://www.juris.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-GemDuvLSchTSchVHAV1P1&doc.part=X&doc.orig und Rahlstedt 8 HH-2010 LSG HmbGVBl. -
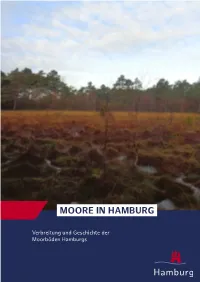
Moore in Hamburg
MOORE IN HAMBURG Verbreitung und Geschichte der Moorböden Hamburgs Impressum Redaktion Dr. Thomas Däumling Gisela Gröger Elisabeth Oechtering Behörde für Umwelt und Energie Projektbearbeitung Dipl.-Geogr. Jan Jelinski Büro für Bodenkartierung und Bodenschutz Unter den Linden7 21465 Reinbek Tel.: 0157 / 38 27 78 59 E-Mail: [email protected] Herausgeber Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Umwelt und Energie Bodenschutz/Altlasten U21 Neuenfelder Straße 19 21109 Hamburg Titelbild: Schnaakenmoor (Rissen) bei Profil 215, Jelinski 28. 12. 2015 Moore in Hamburg Moore in Hamburg Verbreitung und Geschichte der Moorböden Hamburgs Moore in Hamburg Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung . 4 1 .1 . Moortypen und Entstehung . 4 1 .1 .1 Niedermoore . 4 1 .1 .2 Hochmoore und Übergangs- oder Zwischenmoore . 5 1 .2 . Bodenfunktionen von Moorböden und ihre Bewertung . 5 1 .2 .1 Lebensraumfunktion . 5 1 .2 .2 Speicher und Pufferfunktion im Wasserhaushalt . 6 1 .2 .3 Archivfunktion . 6 1 .2 .4 Klimafunktion . 6 2. Maßnahmen für den Moor- und Klimaschutz . 9 3. Die Hamburger Moorkartierung . 10 3 .1 . Vorgehensweise und Datengrundlage . 10 3 .2 . Ergebnisse . 10 3 .2 .1 Hydrogenetische Moortypen . 12 3 .2Naturnahe .2 Moore und degradierte Moortypen . 12 3 .3 . Zusammenfassung . 12 4. Darstellung nach Bezirken . 16 4 .1 . Bezirk Altona . 16 4 .1 .1 Bedeckte Torfe . 16 4 .1 .2 Anstehende Torfe . 17 4 .1 .2 .1 Naturschutzgebiet Schnaakenmoor . 17 4 .1 .2 .2 Rissener- und Sülldorfer Feldmark . 22 4 .2 . Bezirk Eimsbüttel . 25 4 .2 .1 Bedeckte Torfe . 26 4 .2 .2 Anstehende Torfe . 27 4 .2 .2 .1 Ohmoor . 27 4 .2 .2 .2 Vielohmoor . 32 4 .2 .2 .3 Schnelsener Moor . -

Landschaftsschutzgebiete in Hamburg (Alphabetisch Geordnet)
Landschaftsschutzgebiete in Hamburg (alphabetisch geordnet) Datum der Name Link zum Verordnungstext Rechtsgrundlage Verordnung http://www.juris.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr- 1 LSG Allermöhe 23.03.1976 GemAllerLSchTSchVHApP2&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr HmbGVBl. 1976, S. 62 http://www.juris.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr- 2 LSG Altengamme 19.04.1977 GemAltenLSchTSchVHApP2&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr HmbGVBl. 1977, S. 97 http://www.juris.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr- 3 LSG Altona-Südwest, Ottensen, Othmarschen, Klein Flottbek, Nienstedten, Dockenhuden, Blankenese, Rissen 18.12.1962 AltonaLSchTSchVHApP2&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr HmbGVBl. 1962, S. 203 http://www.juris.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr- 4 LSG Bahrenfeld 13.04.1971 BahrenLSchTSchVHApP2&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr HmbGVBl. 1971, S. 75 http://www.juris.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr- 5 LSG Bergedorf/Lohbrügge 08.03.2005 Berged_LohbrLSchGebVHArahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr HmbGVBl. 2005, S. 60 http://www.juris.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr- 6 LSG Boberg 08.03.2005 BobergLSchGebVHArahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr HmbGVBl. 2005, S. 60 http://www.juris.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr- 7 LSG Boberg,weitere 04.01.1972 GemBobergwLSchTSchVHArahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr HmbBL I 791-s http://www.juris.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr- 8 LSG Curslack 19.04.1977 GemCursLSchTSchVHApP2&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr HmbGVBl. -

Qualität Und Präzision. Seit 1873
Qualität und Präzision. Seit 1873. www.augprien.de Hauptsitz Hamburg • Dampfschiffsweg 3 – 9 • 21079 Hamburg • Tel. 040 77125-0 • Fax 040 7658806 Niederlassung Bremen • Richtweg 1 • 28195 Bremen • Tel. 0421 33588-0 • Fax 0421 33588-35 Niederlassung Dortmund • Stockholmer Allee 51 • 44269 Dortmund • Tel. 0231 567609-0 • Fax 0231 567609-99 Niederlassung Frankfurt • Lurgiallee 5 • 60439 Frankfurt am Main • Tel. 069 95412539-0 • Fax 069 95412539-15 Niederlassung Köln • Niehler Straße 102 – 116 • 50733 Köln • Tel. 0221 976538-0 • Fax 0221 976538-38 Niederlassung Sylt • Osetal 5 • 25996 Wenningstedt-Braderup (Sylt) • Tel. 04651 88639-30 • Fax 04651 88639-37 ' . _J,}' ' ' SÜDERELBBRÜCKE 1899 MAIFEIER 1913 HARBURGER RATHAUS 1892 FAMILIE AUGUST PRIEN 1927 Pioniere seit 1873. AUG. PRIEN VERBINDET TRADITION UND FORTSCHRITT Gründerzeit – passender lassen sich Seit Beginn gehört AUG. PRIEN zu den die Jahre um 1870 in Deutschland nicht Pionieren und Entwicklern modernster bezeichnen. Als August Wilhelm Wiegels Bauverfahren. Den strengen Maßstä- 1873 in Hamburg-Harburg das Unterneh- ben August Priens verpflichtet, der ab men gründete, das heute als AUG. PRIEN 1901 das erfolgreiche Unternehmen Bauunternehmung bekannt ist, herrsch- unter eigenem Namen führte, entwi- te Aufbruchstimmung im Lande. Schon ckelte sich die mittelständische Firma nach wenigen Jahren – der begeisterte zu einer festen Größe in Hamburg und Angestellte August Prien war bereits zur dem Hamburger Umland. Mittlerweile ist rechten Hand des Meisters aufgestiegen AUG. PRIEN mit Niederlassungen und – sah die Stadt die ersten soliden Tief-, Tochtergesellschaften in Berlin, Bremen, Wasser- und Brückenbauwerke des jun- Dortmund, Köln und Kühlungsborn in gen Unternehmens in Betrieb. Schnell weiten Teilen des Bundesgebiets aktiv gesellte sich zu diesem Kernbereich der und hat seine Angebotspalette mehr- Hochbau. -

1205 St Georg
November 2008 - Postvertriebsstück C 4571 - Bürgerverein zu St. Georg von 1880 RV - 20099 Hamburg, Lange Reihe 51 10-08 Lange Reihe Danziger Strasse Kirchenallee Steindamm Planung der Verkehrsführung um den Hansaplatz nach der Umgestaltung An den schwarzen Punkten in der Zeichnung soll die Durchfahrt zum Hansaplatz durch absenkbare Poller gesperrt werden. Die Verkehrsführung ist noch nicht endgültig mit den zuständigen Stellen abgestimmt. www.buergerverein-stgeorg.de Gymnastik Koppellas kommen Angebot des Bürgervereins St. Georg zur Adventsfeier Für Frauen ab 60+/... gern auch jünger! Am 7. Dezember 2008, 15:00 Uhr, In unserer Gymnastikgruppe jeden beschwerden (Wirbelsäulen stabilisie- lädt der Bürgerverein ein zur Advents- Montag um 18:00 bis 19:00 Uhr hier rendes Training) und Muskeltraining. feier in das Hotel Alte Wache, im Schorsch-Haus in der kleinen Turn- Machen Sie doch einmal zur Probe mit, Adenauerallee 25. Kaffee und Kuchen halle steht Gymnastik auf dem Pro- rufen Sie mich an: für 10,00 EUR und dazu ein tolles Pro- gramm für fit und körperlich beweg- Übungsleiterin Frau Schlüter: gramm: Das ist unser Weihnachtsge- lich sein. Tel. : 678 1869 schenk für alle St. Georger. Diesmal Sich wohlfühlen mit gezielter Gymna- Ich erwarte gern Ihren Anruf. kommen u. a. die Koppellas, ein neu- stik gegen Nacken- und Rücken- Edeltraut Schlüter er Männerchor aus St. Georg, bis zu 17 sangesfreudige Herren, die eisern Unbedingt hingehen! jede Woche im Turm der St. Georgs Die ganze Erde uns Klänge dieser Zeit auf die Bühne. Wir Kirche üben, üben, üben. Koppellas Eine Revue zu Achtundsechzig hören die politischen Parolen und Phra- heißen sie, weil die Kirche an der Freitag 28. -

The PULSE on the Edge of Hamburg
The PULSE on the edge of Hamburg - Everyday life with the PULSE from the city to the tranquility of the countryside - Magistrale 6 - Buxtehuder Straße — Cuxhavener Straße - An artery outside the central network of Hamburg`s Magistralen - Disconnected from the central network - A part of Hamburg but on its own - Unique potential to offer something new and unique; something central Hamburg can`t offer Diverse and fragmented neighbourhoods along the Magistrale Moorburg Neuwiedenthal Neugraben-Fischbek Bostelbek Neugraben Hausbruch Heimfeld HARBUG Neu Wulmstorf Eissendorf A library of settlements over the last 200 years Fischbek Neugraben Neuwiedenthal/Heimfeld Harburg On the edge between the Geest and the Marschland - A settlement on the edge of Hamburg Geest Magistrale 6 Train Marschland On the edge between the Geest and the Marschland - Two significant landscape characters Challenges & Potentials Detached from the city centre but with differentiated local potential (Manhattan vs Brooklyn - Local vs Municipal) New York Hamburg Brooklyn Harburg - Disconnected from the central metwork - A part of Hamburg but on its own - Unique potential to offer - something different, something Hamburg does not have Diffuse and mixed settlement - local qualities to enhance and revise Fragmented structures Block structure Industrial structures Car street and high pace traffic - A place without pedestrian qualities, railway traffic and the noise Train 4 lane Magistrale Highway Landscape - Local qualities to enhance and strengthen Geest Heide Marschland Turning black traffic conditions into green mobility MOBILITY STRATEGY n sio er tionalV FROM BLACK TRAFFIC TO GREENca MOBILITY du E S G GSEducationalVersion FROM CAR SCALE TO HUMAN SCALE FROM INACCESSIBLE TO CONNECTING GSEducationalVersion GSEducationalVersion FROM STATIC INFRASTRUCTURE TO INTELLIGENT MOBILITY GSEducationalVersion GSEducationalVersion GSEducationalVersion The PULSE on the edge of Hamburg Two strong characters to build upon and strengthen along the Magistrale of Buxtehuder Straße / Cuxhavener Straße.. -

Entwässerungsfelder Moorburg-Ost Teilstilllegungsanzeige Nach § 15 Abs
Unterlage 16.3 Entwässerungsfelder Moorburg-Ost Teilstilllegungsanzeige nach § 15 Abs. 3 BImSchG Erläuterungsbericht und Stellungnahme zu den in § 5 Absatz 3 BImSchG genannten Pflichten April 2019 Unterlage 16.3 Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeines ...................................................................................................... 3 2 Standort und örtliche Verhältnisse .................................................................... 4 2.1 Standort ............................................................................................................ 4 2.2 Betriebliche Einrichtungen ................................................................................ 4 2.3 Eingriffsfläche der stillzulegenden Anlagenteile ................................................ 5 3 Rückbaumaßnahmen und Folgenutzung .......................................................... 5 3.1 Rückbau der technischen Komponenten und Flächenvorbereitung .................. 6 3.1.1 Vorbereitende Maßnahmen .............................................................................. 6 3.1.2 Rückbau Entwässerungseinrichtungen ............................................................. 6 3.1.3 Rückbau der Baustraßen und Entwässerungsfelddämme ................................ 6 3.1.4 Rodung Gehölzbestand .................................................................................... 7 3.1.5 Bauzeiten und Bauaufsicht ............................................................................... 7 3.2 Folgenutzung in der von der Stilllegung -

Stadtteilatlas Der Polizeilichen Kriminalstatistik 2018
Polizeiliche Kriminalstatistik 2018 -ausgewählte Delikte nach Bezirken / Stadtteilen- Landeskriminalamt LKA FSt 11 Bruno-Georges-Platz 1 22297 Hamburg Tel.: 040 4286-70111Polizeiliche Kriminalstatistik 2005 eMail: [email protected] http://www.polizei.hamburg.de Polizeiliche Kriminalstatistik 2017 / 2018 - ausgewählte Delikte nach Bezirken / Stadtteilen - Landeskriminalamt LKA FSt 11 Bruno Georges-Platz 1, 22297 Hamburg Tel.: 040 4286-70111 Bezirke mit Übersichten der Straftaten / Deliktsbereiche für alle Stadtteile des Bezirkes Bezirk Hamburg-Mitte Bezirk Hamburg-Altona Bezirk Hamburg-Eimsbüttel Bezirk Hamburg-Nord Bezirk Hamburg-Wandsbek Bezirk Hamburg-Bergedorf Bezirk Hamburg-Harburg alle Bezirke und Stadtteile nach Straftat / Deliktsbereich Straftaten insgesamt (Straftatenschlüssel ------) Raub, räuberische Erpressung, räuberischer Angriff auf Kraftfahrer (Straftatenschlüssel 210000) Sonstige Raubüberfälle auf Straßen, Wegen oder Plätzen (Straftatenschlüssel 217000) Körperverletzung insgesamt (Straftatenschlüssel 220000) Gefährliche und schwere Körperverletzung (Straftatenschlüssel 222000) Gewaltkriminalität (Summenschlüssel 892000) Diebstahl insgesamt (Straftatenschlüssel ******) Wohnungseinbruchsdiebstahl gem. § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB (Summenschlüssel 888000) Diebstahl von Kraftwagen insgesamt (Straftatenschlüssel ***1**) Diebstahl an/aus Kraftfahrzeugen insgesamt (Straftatenschlüssel *50***) Diebstahl von Fahrrädern insgesamt (Straftatenschlüssel ***3**) Ladendiebstahl insgesamt (Straftatenschlüssel *26***) Taschendiebstahl -

Inhaltsverzeichnis
200 Jahre Apotheke zum Ritter St. Georg Inhaltsverzeichnis 1. Die Eigentümer der Apotheke zum Ritter St. Georg ............................................ 2 2. Die Geschichte der Apotheke zum Ritter St.Georg .............................................. 2 2.1 Der Beginn im Jahre 1807..................................................................................... 2 2.2 Die Freie und Hansestadt Hamburg ...................................................................... 3 2.3 Die Familie Wolfsohn ........................................................................................... 4 2.4 Die Ära Rincker .................................................................................................... 5 2.5 Die Gegenwart....................................................................................................... 5 3. Die Apotheke zum Ritter St. Georg und ihre Wahrzeichen.................................. 6 3.1 St. Georg, Namensgeber und Schutzpatron .......................................................... 6 3.2 Ritterskulptur St. Georg an der Aussenfassade..................................................... 7 3.3 Bleiglasfenster mit dem Ritter St. Georg .............................................................. 7 4. Womit die Apotheker früher arbeiteten ................................................................ 8 4.1 Waage.................................................................................................................... 8 4.2 Giftschrank ........................................................................................................... -

Weissbuch Kinderglück
WEISSBUCH KINDERGLÜCK Was Kindern in Hamburg hilft glücklich zu sein – mit Blick in die Stadtteile INHALT VORWORT Vorwort ..................................................................................................................................................................Seite 3 tive betrachten. Wir waren schließlich alle mal an Was Kinder glücklich macht .............................................................................................................................. Seite 4 dieser Stelle und können das noch genauso gut: der Neugier folgen, die Welt entdecken – staunen und Kinderglücksindex .............................................................................................................................................. Seite 6 Glück fühlen. Kinderglück in den Stadtteilen ........................................................................................................................ Seite 10 Eltern gut, alles gut? .......................................................................................................................................... Seite 14 Die Welt der Erwachsenen ist heute kompliziert. Kindheit im Schatten der Alkoholsucht ......................................................................................................... Seite 16 Das lässt sich nicht wegzaubern. Man kann aber viel für Kinder (kleine und große) tun, wenn das, was Es braucht nur kleine Momente, damit die Seele bricht .............................................................................. Seite -
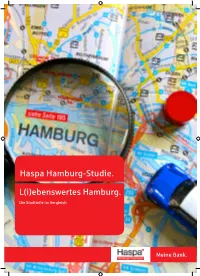
HASPA Liebenswertes HH II 13.6.Indd
Haspa Hamburg-Studie. L(i)ebenswertes Hamburg. Die Stadtteile im Vergleich Meine Bank. Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung Seite 3 2 Demografie Seite 4 3 Bildung Seite 11 4 Einkommen Seite 15 5 Wohnen Seite 18 6 Zusammenfassung Seite 23 Literaturverzeichnis Seite 25 2 Einleitung 1 Einleitung In der Freien und Hansestadt Hamburg leben gegenwärtig Die vorliegende Studie befasst sich mit der Frage, wie sich die rund 1,8 Millionen Menschen, die sich auf 105 Stadtteile in sieben demografischen und sozioökonomischen Bedingungen in den Bezirken verteilen (vgl. Karte 1). Die Lebensbedingungen, die un- Hamburger Stadtteilen darstellen und welche aktuellen Entwick- ter anderem von den demografischen und sozioökonomischen lungen, beispielsweise hinsichtlich des Wohnungsmarktes, sich Gegebenheiten geprägt werden, variieren zwischen den Hambur- identifizieren lassen. Die Analyse zeigt, dass das Bild der Hambur- ger Stadtteilen deutlich. Gleichzeitig zeigen sich differenzierte ger Stadtteile insgesamt sehr heterogen ist und sich die Lebens- Entwicklungen auf Stadtteilebene. Während es immer wieder ein- bedingungen in ihnen unterscheiden. So gibt es schrumpfende zelne Stadtteile schaffen, sich von einer relativ ungünstigen Aus- und wachsende Stadtteile, solche, die junge Menschen anziehen, gangssituation zu einem beliebten, prosperierenden Viertel zu und andere, die ältere Bewohner bevorzugt wählen. entwickeln, das Bevölkerung anzieht, gelingt dieses anderen Stadtteilen nicht. Karte 1 Stadtteile in Hamburg Wohldorf- Ohlstedt Duvenstedt