Buchbesprechungen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Taxons BW Fin 2013
Liste des 1863 taxons en Brabant Wallon au 31/12/2013 (1298 basidios, 436 ascos, 108 myxos et 21 autres) [1757 taxons au 31/12/2012, donc 106 nouveaux taxons] Remarque : Le nombre derrière le nom du taxon correspond au nombre de récoltes. Ascomycètes Acanthophiobolus helicosporus : 1 Cheilymenia granulata : 2 Acrospermum compressum : 4 Cheilymenia oligotricha : 6 Albotricha acutipila : 2 Cheilymenia raripila : 1 Aleuria aurantia : 31 Cheilymenia rubra : 1 Aleuria bicucullata : 1 Cheilymenia theleboloides : 2 Aleuria cestrica : 1 Chlorociboria aeruginascens : 3 Allantoporthe decedens : 2 Chlorosplenium viridulum : 4 Amphiporthe leiphaemia : 1 Choiromyces meandriformis : 1 Anthostomella rubicola : 2 Ciboria amentacea : 9 Anthostomella tomicoides : 2 Ciboria batschiana : 8 Anthracobia humillima : 1 Ciboria caucus : 15 Anthracobia macrocystis : 3 Ciboria coryli : 2 Anthracobia maurilabra : 1 Ciboria rufofusca : 1 Anthracobia melaloma : 3 Cistella grevillei : 1 Anthracobia nitida : 1 Cladobotryum dendroides : 1 Apiognomonia errabunda : 1 Claussenomyces atrovirens : 1 Apiognomonia hystrix : 4 Claviceps microcephala : 1 Aporhytisma urticae : 1 Claviceps purpurea : 2 Arachnopeziza aurata : 1 Clavidisculum caricis : 1 Arachnopeziza aurelia : 1 Coleroa robertiani : 1 Arthrinium sporophleum : 1 Colletotrichum dematium : 1 Arthrobotrys oligospora : 3 Colletotrichum trichellum : 2 Ascobolus albidus : 16 Colpoma quercinum : 1 Ascobolus brassicae : 4 Coniochaeta ligniaria : 1 Ascobolus carbonarius : 5 Coprotus disculus : 1 Ascobolus crenulatus : 11 -

Meeting Minutes
Minutes PAB-Products Sub-committee meeting held 10 May 2021 11-1PM I. Introductions and attendance o Jessie Uehling x o Mason Marks absent o Rachel Knox x o Steph Barss x o Angie Carter x o David Hart x II. Housekeeping The minutes from 27 June 2021 were unanimously approved. Jessie Uehling highlighted the upcoming speakers series: June 10th Paul Stamets June 24th Felix Blei July 8th Daniel Ballhorn & Kyle Meyers July 22nd James Keim August 5th Keith Williams August 19th Benjamin Malcolm Jessie Uehling clarified the following points: 1. sale and tax – sales refer to service center – client interactions and psilocybin products can be billed and taxed separately. 2. non-mushroom-based products – psilocybin products besides mushrooms may be regulated uniquely e.g. not as crops covered by ORS 215.203 3. tracking system - The OHA can develop its own tracking system if it likes, which presumably it will do if the OLCC's METRC system is deemed unfit. III. Paul Stamets presentation Paul gave an overview of Oregon based history of psychedelic research on psilocybin producing fungi. He gave presented fungal biology insights, noting that mushrooms are one of many complex tissues in the fungal life cycle. He underscored the importance of considering fungal allergies in screening and facilities design, as many people are allergic to fungal spores. He noted that the most widely distributed and cultivated species of Psilocybe is P. cubensis, a dung adapted fungus which can be easily and safely cultivated on grain substrates. He noted that several species including P. azurescens, P. alennii, P. -

Three New Taxa of Bolbitiaceae (Conocybe, Pholiotina) in Europe
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde Jahr/Year: 2010 Band/Volume: 19 Autor(en)/Author(s): Hausknecht Anton, Krisai-Greilhuber Irmgard Artikel/Article: Three new taxa of Bolbitiaceae (Conocybe, Pholiotina) in Europe. 175-187 ©Österreichische Mykologische Gesellschaft, Austria, download unter www.biologiezentrum.at Österr.Z. Pilzk. 19(2010) 175 Three new taxa of Bolbitiaceae (Conocybe, Pholiotina) in Europe ANTON HAUSKNECHT IRMGARD KRISAI-GREILHUBER Fakultätszentrum für Biodiversität Universität Wien Rennweg 14 A-1030 Wien, Austria Email: ahausknecht.oemg(g)aon.at Accepted 13. 11.2010 Key words: Agaricales, Bolbiliaceae, Conocybe, Pholiotina, Conocybe connata, Conocybe nigres- cens var. pminosa, Pholiotina arrhenii var. ßlarioides. - New taxa, new species, new variety. - Myco- flora of Austria, Czech Republic, Europe. Abstract: Three new taxa of Bolbitiaceae, viz. Conocybe connata, C. nigrescens var. pruinosa, and Pholiotina arrhenii var. ßlarioides are described and treated macro- and microscopically. Their sys- tematic position is discussed and the key given in the Bolbitiaceae monograph is emended. Further- more, colour photos of all three taxa are included. Zusammenfassung: Drei neue Taxa der Bolbitiaceae, Conocybe connata, C. nigrescens var. pruinosa und Pholiotina arrhenii var. ßlarioides werden beschrieben und makro- und mikroskopisch dokumen- tiert. Ihre systematische Position wird diskutiert, und der Schlüssel in der Monografie ergänzt. Alle drei Taxa werden farbig abgebildet. Since the publication of the Bolbitiaceae monograph (HAUSKNECHT 2009) steadily new findings occur in Europe, which are revealed as undescribed taxa. After two new species in the previous year (HAUSKNECHT & KRISAI-GREILHUBER 2009) we present and describe further three new taxa: Conocybe connata HALSKN., spec, nova (Figs. -

Conoscere-Funghi-5Nov2019.Pdf
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA REGIONE CALABRIA conoscere i funghi la raccolta la commercializzazione il consumo la commercializzazione Manuale di base per la formazione dei raccoglitori e per i Corsi di formazione propedeutici al rilascio Ernestodell’attestato Marra d’idoneità e Darall’identificazione dei funghi per la vendita al consumatore finale D D.P.R. 14 Luglio 1995 n. 376 – L.R. 26 Novembre 2001 n.30 a cura di Ernesto Marra e Dario Macchioni Manuale realizzato da AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE A COSENZA nell'ambito delle attività conformi al Piano Regionale di Prevenzione 2014 - 2019, Azione P.10.9.1 SI RINGRAZIANO gli Autori che hanno consentito l'uso del loro materiale fotografico per la realizzazione del lavoro: ARTURO BAGLIVO Esperto in Micologia, Lecce ANGELO BINCOLETTO Esperto in Micologia, Meda (MI) Testi a cura di RAFFAELE CAPANO Micologo, Portici (NA) ERNESTO MARRA MATTEO CARBONE Esperto in Micologia, Genova ANTONIO CONTIN Micologo, Castrovillari (CS) Medico Veterinario Dirigente Area Igiene VINCENZO CURCIO Micologo, Lamezia Terme (CZ) degli Alimenti e Micologo Ispettorato ANTONIO DE MARCO Micologo, Cassano allo Ionio (CS) Micologico - ASP Cosenza GENNARO DI CELLO Micologo, Lamezia Terme (CZ) GIANCARLO PARTACINI Esperto in Micologia, Levico Terme (TN) BENIAMINO RECCHIA Micologo, Castrovillari (CS) DARIO MACCHIONI GIOVANNI SICOLI Micologo, Amantea (CS) Referente Regionale del Piano Regionale della Prevenzione e Micologo Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie - Regione Calabria © Copyright di testi, grafica e fotografie dei rispettivi Autori, è vietata la riproduzione anche parziale. In copertina Boletus aereus (FOTO ERNESTO MARRA) Introduzione Nel 2016, gli Autori delle presenti pagine hanno condotto uno studio epidemiologico per il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria, sulle intossicazioni da consumo di funghi nel territorio regionale, i cui risultati sono consultabili in Rapporti ISTSAN 17/41 (Istituto Superiore di Sanità). -

3818-13226-1-PB.Pdf (7.292Mb)
GuineanA 14 Micoflora (Basidiomycota) de los eucaliptales del NO de la Península Ibérica Marcos Lago Álvarez Leioa, octubre 2008 Resumen RESUMEN Lago, M. 2008. Micoflora (Basidiomycota) de los eucaliptales del NO de la Península Ibérica. Guineana 14: 1-502. Apdo. 4063. E-362007-Vigo. e-mail: [email protected]. Laboratorio de Micoloxía. Facultade de Bioloxía. Campus As Lagoas-Marcosende. Universidade de Vigo. Se realiza un estudio sobre la diversidad micológica en las formaciones de Eucalyptus, centrado en los macrobasidiomicetos y en el NO de la Península Ibérica. El planteamiento del mismo obedece a la escasez de estudios centrados en estos sistemas forestales tan extendidos en el Norte y Occidente Peninsular. El principal objetivo ha sido la elaboración de un catálogo micológico de los macrobasidiomicetos en las formaciones de Eucalyptus del NO de la Península Ibérica, analizar la ecología de las distintas especies obtenidas y evaluar las contribuciones corológicas del estudio. Asimismo se procede a la revisión bibliográfica y actualización nomenclatural de las citaciones de macrobasidiomicetos en relación con Eucalyptus para la Península Ibérica. Se ha seguido la metodología habitual en los estudios micoflorísticos: Se procedió a la recolección del material de estudio en las distintas plantaciones seleccionadas (desde 1992 hasta 2001) o su localización en herbarios registrados (LOU-Fungi, MA-Fungi, BIO, LISU), proceso que implicó un total de 200 localidades, pertenecientes a Asturias, Lugo, A Coruña, Ourense y Pontevedra, en España, y Trás-os-Montes e Alto Douro, Minho, Douro Litoral y Beira Alta, en Portugal. El estudio macro y microscópico se realizó antes y después del proceso de conservación, para su identificación. -
Svensk Mykologisk Tidskrift Volym 38 · Nummer 2 · 2017 Svensk Mykologisk Tidskrift �������������������7
Svensk Mykologisk Tidskrift Volym 38 · nummer 2 · 2017 Svensk Mykologisk Tidskrift 1J@C%RV`:` 1R1$:`7 www.svampar.se 0VJ@7@QCQ$1@0 Sveriges Mykologiska Förening 0VJ]%GC1HV`:`Q`1$1J:C:` 1@C:`IVR0:I]R Föreningen verkar för :J@J7 J1J$QH.IVR0VJ@ QH.JQ`RV%`Q]V1@ R VJ G?`V @?JJVRQI QI 0V`1$V 0:I]:` QH. 1J `VV80VJ% @QIIV`IVR`7`:J%IIV` 0:I]:``QCC1J: %`VJ ]V`B`QH.?$:00V`1$V7@QCQ$1@:DV`VJ1J$8 R@7RR:0J: %`VJQH.:0:I]]CQH@J1J$QH.- : `%@ 1QJV` 1CC`V``: :`V`1JJ]BD7.VI1R: J: %]] `?R:JRV1@Q$QH.I:`@@V`%JRV`1:@ - 11180:I]:`8V80VJV`.BCC$VJQI- :$:JRV:0$?CC:JRVC:$:` CVI@:] 1 D80VJ ``:I ?CC IVR G1R`:$ R:@QJ :@ V`IVCC:JCQ@:C:0:I]`V`VJ1J$:`QH. ``BJ0Q`V=: .Q` I1JJV`QJR8 0:I]1J `VV`:RV1C:JRV %JRV`C?: R:@QJ :@ %]]`?.BCCIVRI7@QCQ$1@:`V`- $:`1$`:JJC?JRV` R VJ :I0V`@:J IVR I7@QCQ$1@ `Q`@J1J$ QH. Redaktion 0V VJ@:]8 HVR:@ V`QH.:J0:`1$% $10:`V 1@:VCIQJ VRCVI@:]V`.BCCV$VJQI1J?J1J$:0IVRCVIR JK=: :J :0 VJ]B`V`VJ1J$VJG:J@$1`Q 0HLJJKN00<= 5388-7733 =0:I]:`8V VRCVI:0 VJ` 7 [ 7`V`IVRCVII:`GQ::10V`1$V Jan Nilsson [ 7`V`IVRCVII:`GQ::% :J`V`0V`1$V IVGV`$ [ 7 `V` %RV`:JRVIVRCVII:`GQ::1 ;JJ<H6= 0V`1$^6 _ [ 7 `V``=^=0_ =$8V %GH`1]``QI:G`Q:R:`V1VCHQIV84:7IVJ Äldre nummer :00VJ@7@QCQ$1@0^ `Q` ^69 _H:JGVI:RVG7H`VR1 H:`RG7 ILHE0INH=<=_`1JJ]BVJAEQI@:JGV ?CC: 01Q%`1VG.Q]: 11180:I]:`8VQ` QQ%` ``BJD8 G:J@:HHQ%J7 Previous issues Q` 0VJ@ 7@QCQ$1@ 0 ^ILHE0INH=<=_:`V:0:1C:GCVQJ:AE1 :;<=76 H:JGVQ`RV`VR``QID8 ;:AL:D076E6 Sveriges Mykologiska Förening :=V VJ@:] GVGQ`$%J10V`1 V ;6 GVGQ`$ 11180:I]:`8V Omslagsbild 7]`11B`V `Q Q ?0C1J$$1H@ 1CC60:< VR IVRG1CRVJ:0$C1 V`GC?H@0:I]^Coprinellus -

European Including Be Replaced Making an Study European Of
PERSOONIA Published by the Rijksherbarium, Leiden Part Volume 6, i, pp. 119-165 (1970) The genus Conocybe subgen. Pholiotina. I. The European annulate species E. Kits+van+Waveren M.D. Amsterdam (With 54 Text-figures) Sixty-five collections, comprising all known European annulate species of Conocybe, subgenus Pholiotina, were examined, including the type accord- specimens of C. vexans P. D. Orton and C. percincta P. D. Orton. In ance with Orton, it is argued that Ricken, Kühner, and several other authors reversed the original conception of C. blattaria and C. togularis, as used by Fries, but that the specific epithet ‘togularis’ should be replaced by ‘arrhenii’. Conocybe aporos and C. arrhenii var. hadrocystis are described as a new species and a new variety respectively. It is argued that C. vexans is conspecific with C. blattaria, and C. percincta with C. teneroides. Singer’s observation the of basidia —hitherto only one its kind—that 2-spored may occur in C. pilaris was confirmed and such basidia were also found in one collectionof C. arrhenii. The taxonomic significance ofseveral macroscopic and microscopic characters, often used for the distinction of the species are both scrutinized and criticized and often found be little to very or none. A key to the annulate species of the subgenus Pholiotina, chiefly based on the characters and is of spores cheilocystidia, given. incentive exhaustive of annulate The to making an study the European species of Conocybe, subgenus Pholiotina, was our private herbariumcontaining twenty-three personal finds of these species by the end of 1968. To these could be added eight collections from the Rijksherbarium at Leiden, twenty-four from the Herbarium, Royal Botanic Garden, Edinburgh, five from the herbarium of Mr. -

Bolbitiaceae 05-04-2021
Bolbitiaceae 05-04-2021 Jean Werts & Joke De Sutter Bolbitiaceae • Alfabetische index • Genera alfabetisch • Foto’s & hyperlinken • Bibliografie Genera alfabetisch • Alnicola • Bolbitius • Conocybe • Pholiotina Genus Alnicola • Symbionten met Els, zelden Wilg of Berk, in moerassige gebieden; vruchtlichaam klein, met okerkleurige tot donkerbruine kleur; sporen groot, amandel- of citroenvormig, glad of wrattig. • Alnicola macroscopische sleutel Hans Vermeulen • Alnicola foto’s & hyperlinken • Alnicola soorten lage landen KVMV Alnicola in Vlaanderen KVMV Alnicola in Vlaanderen KVMV Alnicola in Vlaanderen deel 1 Deel 2 Deel 3 Alnicola soorten lage landen Alnicola amarescens Bittere zompzwam Alnicola badiolateritia Valse zilversteelzompzwam Alnicola bohemica Gewone zilversteelzompzwam Alnicola celluloderma Rossige elzenzompzwam Alnicola clavuligera Kleverige zompzwam Alnicola erebia Leverkleurige zompzwam Alnicola escharoides Bleke elzenzompzwam Alnicola fellea Wrange zompzwam Alnicola soorten lage landen Alnicola geraniolens Geraniumzompzwam Alnicola luteolofibrillosa Vlokkige zompzwam Alnicola pseudoamarescens Brandplekzompzwam Alnicola rubriceps Kastanjebruine zompzwam Alnicola salicis Wilgenzompzwam Alnicola scolecina Donkere elzenzompzwam Alnicola spadicea Bruinrode zompzwam Alnicola sphagneti Veenmoszompzwam Alnicola soorten lage landen Alnicola striatula Gestreepte zompzwam Alnicola suavis Geurige zompzwam Alnicola subconspersa Fijnschubbige elzenzompzwam Alnicola submelinoides Rimpelige zompzwam Alnicola tantilla Kruipwilgzompzwam -

Liste Des 1609 Taxons En Brabant Wallon Au 31/12/2011
Liste des 2094 taxons en Brabant Wallon au 31/12/2018 (1458 basidios, 505 ascos, 109 myxos et 22 autres) 1. Nombre de taxons par carré IFBL 2. Liste des taxons Remarque : Le nombre derrière le nom du taxon correspond au nombre de récoltes. Ascomycètes Acanthophiobolus helicosporus : 2 Ascocoryne cylichnium : 26 Acrospermum compressum : 7 Ascocoryne sarcoides : 64 Albotricha acutipila : 2 Ascodesmis microscopica : 1 Aleuria aurantia : 45 Ascodesmis nigricans : 1 Aleuria bicucullata : 1 Ascotremella faginea : 5 Aleuria cestrica : 1 Ascozonus woolhopensis : 10 Allantoporthe decedens : 2 Balsamia vulgaris : 1 Amphiporthe leiphaemia : 2 Belonopsis asteroma : 1 Anthostomella rubicola : 3 Belonopsis hydrophila : 7 Anthostomella tomicoides : 2 Belonopsis retincola : 13 Anthracobia humillima : 1 Bertia moriformis : 13 Anthracobia macrocystis : 3 Biscogniauxia mediterranea : 2 Anthracobia melaloma : 4 Bisporella citrina : 20 Anthracobia nitida : 2 Bisporella subpallida : 4 Apiognomonia errabunda : 1 Bisporella sulfurina : 15 Apiognomonia hystrix : 4 Blumeriella kerriae : 1 Aporhytisma urticae : 1 Brachysporium obovatum : 1 Arachnopeziza aurata : 1 Bulgaria inquinans : 18 Arachnopeziza aurelia : 1 Calloria neglecta : 39 Arthrinium sporophleum : 1 Caloscypha fulgens : 5 Arthrobotrys oligospora : 3 Calycellina chlorinella : 2 Ascobolus albidus : 18 Calycellina ochracea : 1 Ascobolus brassicae : 5 Calycellina rubescens : 1 Ascobolus carbonarius : 7 Calycina herbarum : 3 Ascobolus crenulatus : 11 Capitotricha bicolor : 1 Ascobolus degluptus : 1 Capronia -
Ordre Des Agaricales
Alain GERAULT FLORULE EVOLUTIVE DES BASIDIOMYCOTINA DU FINISTERE HOMOBASIDIOMYCETES AGARICALES Octobre 2005 Version 2.1 2 AVERTISSEMENT Il ne s’agit pas à proprement parler d’une flore mais d’une liste commentée et descriptive des espèces d’AGARICOMYCETIDEAE trouvées dans le Finistère. Elle est destinée à servir de base à la réalisation de l’inventaire des champignons du Finistère dans le cadre de l’inventaire national. Si l’étude des champignons “ supérieurs ” du Finistère a commencé dés le 19 ème siècle avec les mycologues Morlaisiens et Brestois, leurs travaux sont cependant difficilement exploitables. En effet la mycologie était encore balbutiante à l’époque et il est souvent très difficile de se faire une idée des espèces dont il est fait mention. A l’heure actuelle, la mycologie évolue beaucoup et il est indispensable de fixer, au moins provisoirement, les interprétations retenues pour les espèces déterminées. C’est donc dans ce but, que nous avons réalisé ce relevé des espèces signalées dans le Finistère, selon la nomenclature moderne et selon notre interprétation, qu’il sera aisé de corriger si elle s’avère erronée ou si elle doit être modifiée. Cette florule est enregistrée de manière électronique ce qui lui permet d’être réellement évolutive en quelques instants. Ce relevé étant incomplet nous avons adopté le terme de “ Florule évolutive ” pour bien montrer que beaucoup reste à faire et qu’elle doit être complétée et corrigée en permanence. Cette florule est destinée à tous les mycologues du Finistère (et d’ailleurs) qui voudront bien la considérer seulement comme une base de travail commune pour tenter de se mettre d’accord sur les interprétations à donner à certaines espèces critiques (hélas nombreuses !). -

Notes on Extra-European Taxa of Bolbitiaceae (Agaricales, Basidiomycota)
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde Jahr/Year: 2002 Band/Volume: 11 Autor(en)/Author(s): Horak Egon, Hausknecht Anton Artikel/Article: Notes on extra-European taxa of Bolbitiaceae (Agaricales, Basidiomycota). 213-264 ©Österreichische Mykologische Gesellschaft, Austria, download unter www.biologiezentrum.at österr. Z. Pilzk. 11 (2002) 213 Notes on extra-European taxa of Bolbitiaceae (Agaricales, Basidiomycota) EGON HORAK Geobotanical Institute, Herbarium, ETH Zollikerstrasse 107 • . CH-8008 Zurich, Switzerland ANTON HAUSKNECHT Sonndorferstrasse 22 A-3712 Maissau, Austria ' Received 19. 8. 2002 Key words: Agaricales, Bolbitiaceae, Conocybe, Galerella, Pholiotina, Tubarieila. — New taxa, spe- cies concepts, keys. - Mycoflora of Asia, Africa, North America, Australasia, and Oceania. Abstract: Collections of Bolbitiaceae from different regions outside Europe (Australia, Cook Islands, Indonesia, Mauritius, New Zealand, Papua New Guinea, Trinidad, USA) are discussed. Tubariella rhizophora is described as a new genus and species. New species and varieties, respectively, are de- scribed for the genera Galerella (G.fibrillosa), Conocybe (C. dennisii, C. discorosea, C. vinaceobrun- nea, C. volviornata, C. zeylanica var. marginata) and Pholiotina {P. glutinosa, P. pilosa, P. resinoso- cystidiata, P. vesiculosa). P. vesiculosa is placed within the new section Vesiculosae due to its aber- rant, vesiculose-subuteriform cheilocystidia. For most taxa, line drawings of macro- and microscopical features are provided. Species concepts are discussed, and keys are provided for complex infrageneric groups to facilitate determination and species delimitation. Colour plates of three taxa are given. Zusammenfassung: Aufsammlungen von Bolbitiaceae aus verschiedenen außereuropäischen Regio- nen (Australien, Cook Islands, Indonesien, Mauritius, Neuseeland, Papua Neu Guinea, Trinidad, USA) werden behandelt. -
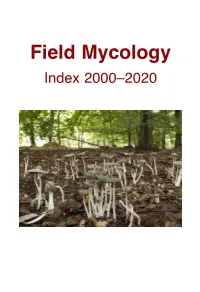
Field Mycology Index 2000–2020 SPECIES INDEX 1
Field Mycology Index 2000–2020 SPECIES INDEX 1 KEYS TO GENERA etc 18 AUTHOR INDEX 18 BOOK REVIEWS & CDs 21 GENERAL SUBJECT INDEX 23 Illustrations are all listed, but only a minority of Amanita gemmata 8(1):25, 17(1):19 (see also text references. Keys to genera are listed again, A. junquillea) page 12. Amanita inopinata 1(2):39, 1(4):112, 118, 2(2):40, 2(3):98, 4(4):121, 6(1):31, 7(1)21, 12(3):96, Name, volume (part): page (F = Front cover, B = 13(2):67 Back cover) Amanita junquillea 17(1):20 Amanita malleata 11(4):143 SPECIES INDEX Amanita muscaria (yellow form) 5(2) :B, 5(3) :86 A Amanita muscaria 7(1):32–33, 19(2):F Abortiporus biennis 16(4):138 Amanita muscaria var. alba 12(1):9–10 Aegerita spp. 5(1):29 Amanita nivalis 2(3) :105 Agaricus arvensis 3(2):46 Amanita novinupta 12(1):12 Agaricus bisporus 5(4):140 Amanita olivaceogrisea 2(3):99, 19(3):99 Agaricus bohusii 8(1):3, 12(1):29 Amanita ovoidea 7(1):11–12 Agaricus bresadolanus 15(4):113-114 Amanita pantherina 8(2):70 Agaricus depauperatus 5(4):115 Amanita phalloides 1(2):B, 13(2):56 Agaricus endoxanthus 13(2):38 Amanita pini 11(1):33 Agaricus langei 5(4):115 Amanita rubescens (poroid) 6(4):138 Agaricus moelleri 4(3):102, 103, 9(1):27 Amanita rubescens forma alba 12(1):11–12 Agaricus phaeolepidotus 5(4):114, 9(1):26 Amanita separata 4(4):134 Agaricus pseudovillaticus 8(1):4 Amanita simulans 10(1):19 Agaricus rufotegulis 4(4):111.