Hochwasser 2002 Im Muldegebiet
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Land Use Effects and Climate Impacts on Evapotranspiration and Catchment Water Balance
Institut für Hydrologie und Meteorologie, Professur für Meteorologie climate impact Q ∆ ∆ E ● p basin impact ∆Qobs − ∆Qclim P ● ● ● P ● ● ● ●● ●● ● ●● ● −0.16 ●●● ● ● ● ● ● ● ●●●●●●● ●●●●● ● ●●● ●● ● ●● ●● ● ● ● ● ● ● ● ●●●● U −0.08 ● ● ●● ●● ●●● ● ● ●● ● ●● ● ● ●● ●● ● ● ●● ∆ ● ● ● ● ● ● ●●● ● ● ●●● ●● ● ● ●●●●●● ● ●●●● ●● ●●●● ●●● ● ●●●● ● ● 0 ● ●● ● ●●●●● ● ● ● ● ●●● ● ● ●●●●●● ● ●● ● ● ● ●● ● ● ●● ● ●● ● ● ●● ●● ● ●● ●● ●●● ●●● ● ● ● ●● ●● ● ● ●● 0.08 ● ● ●●● ●●● ●●● ● ●● ● ●●●● ● ● ● ● ●●● ●●●● ● ● ● ● ● ● ●●●●●●●● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0.16 ● ● ●● ●● ● ●●● ● ●● ● ●● ● ● ● ● ●● ● ● climate impact ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●● ● ● Q ● ● ● ●● ● ● ● ● ● − ∆ ● ● ● ● ● ●● − ∆ ● ● ● E ● ● p basin impact ● P −0.2 −0.1 0.0 0.1 0.2 −0.2 −0.1 0.0 0.1 0.2 ∆W Maik Renner● Land use effects and climate impacts on evapotranspiration and catchment water balance Tharandter Klimaprotokolle - Band 18: Renner (2013) Herausgeber Institut für Hydrologie und Meteorologie Professur für Meteorologie Tharandter Klimaprotokolle http://tu-dresden.de/meteorologie Band 18 THARANDTER KLIMAPROTOKOLLE Band 18 Maik Renner Land use effects and climate impacts on evapotranspiration and catchment water balance Tharandt, Januar 2013 ISSN 1436-5235 Tharandter Klimaprotokolle ISBN 978-3-86780-368-7 Eigenverlag der Technischen Universität Dresden, Dresden Vervielfältigung: reprogress GmbH, Dresden Druck/Umschlag: reprogress GmbH, Dresden Layout/Umschlag: Valeri Goldberg Herausgeber: Christian Bernhofer und Valeri Goldberg Redaktion: Valeri Goldberg Institut für -

Vergleich Der Größten Hochwasser Im Muldegebiet
Vergleich der größten Hoch- wasser im Muldegebiet Schriftenreihe, Heft 18/2016 Schriftenreihe des LfULG, Heft XX/2016 | 1 Die größten Hochwasser im Einzugsgebiet der Mulde im meteorologisch- hydrologischen Vergleich Andreas Schumann, Björn Fischer, Uwe Büttner, Evelin Bohn, Petra Walther und Erhard Wolf Schriftenreihe des LfULG, Heft 18/2016 | 2 Inhalt 1 Einleitung ............................................................................................................................................................ 14 2 Beschreibung des Flussgebietes der Mulde .................................................................................................... 15 2.1 Lage und Abgrenzung .......................................................................................................................................... 15 2.2 Landschafts- und Naturräume .............................................................................................................................. 16 2.3 Geologie und Pedologie ....................................................................................................................................... 18 2.4 Flächennutzung .................................................................................................................................................... 23 2.5 Klimatische Verhältnisse ....................................................................................................................................... 24 2.6 Hydrologische Verhältnisse ................................................................................................................................. -

Rote Liste Und Artenliste Sachsens Zieralgen Artikel-Nr
Rote Liste und Artenliste Sachsens Zieralgen Artikel-Nr. L V-2-2/35 Inhalt Vorwort 03 1 Einleitung 05 2 Methodische Grundlagen der Erfassung und Bewertung 07 2.1 Fundnachweise, Taxaliste – Quellen und Herangehensweise 07 2.2 Erfassung und Auswertung von Begleitparametern 09 2.3 Lebensräume und ökologische Ansprüche der Desmidiaceen in Sachsen 09 3 Gefährdungskategorien 14 4 Gefährdungsanalyse 16 4.1 Grundlagen der Gefährdungsanalyse 16 4.2 Aktuelle Bestandssituation 16 4.3 Langfristiger Bestandstrend 17 4.4 Kurzfristiger Bestandstrend 18 4.5 Risikofaktoren 18 4.6 Gefährdungseinstufung 18 5 Kommentierte Artenliste 20 6 Rote Liste 62 7 Gefährdungssituation 70 8 Weiterer Untersuchungsbedarf 73 9 Literatur 74 10 Anhang 82 Anhang A1: Prozentuale Verteilung der Taxa auf Standorttypen 82 Anhang A2: Gesamt-Phosphor an den Messstellen mit aktuellen Desmidiaceen-Vorkommen 88 Anhang A3: pH-Wert an den Messstellen mit aktuellen Desmidiaceen-Vorkommen 92 Anhang A4: Leitfähigkeit an den Messstellen mit aktuellen Desmidiaceen-Vorkommen 100 Anhang A5: Vorstellung nicht eindeutig zuordenbarer Taxa 108 Vorwort Kommentierte Artenlisten bieten eine Übersicht Gefährdung innerhalb der Artengruppen werden über die in Sachsen vorkommende Artenvielfalt feste Bewertungskriterien angelegt, die den Ver- einer Organismengruppe. Sie vermitteln grund- gleich mit anderen Bundesländern ermöglichen. legende Informationen zu den Arten. Dazu zäh- Für die Zieralgen ist zudem die Kenntnis ihrer len auch die Fakten für eine Gefährdungsana- ökologischen Ansprüche wesentlich, da sie wich- lyse. Deren Ergebnis wird in der »Roten Liste« tige Indikatororganismen für die Bewertungs- zusammengefasst. verfahren nach der Europäischen Wasserrah- Rote Listen gefährdeter Organismen dokumen- menrichtlinie enthalten. tieren den Kenntnisstand über die Gefährdung Rote Listen gefährdeter Tier- und Pflanzenarten der einzelnen Arten und über den Anteil gefähr- Sachsens werden in Verbindung mit kommen- deter Arten der betrachteten Sippe. -

Bulletin VYDRA
bulletin VYDRA Nummer 19 Sonderausgabe mit Ergebnissen des Projektes LUTRA LUTRA bulletin VYDRA Nummer 19 Sonderausgabe mit Ergebnissen des Projektes LUTRA LUTRA ISBN 978-80-86475-59-2 INHALT Vorwort ....................................................................................................................................... 5 Poledník L., Schimkat J., Beran V., Zápotočný Š., Poledníková K.: Vorkommen des Fischotters im Osterzgebirge und im Erzgebirgsvorland in Sachsen und in der Tschechischen Republik 2019–2020 .................................................................................................................................. 7 Cocchiararo B., Poledník L., Künzelmann B., Beran V., Nowak C.: Genetische Struktur der Fischotterpopulation im Erzgebirge ………………….…………………………………………...………................. 26 Poledník L., Poledníková K., Mateos-González F., Stolzenburg U., Zápotočný Š.: Das Nahrungs- dargebot für den Fischotter im Erzgebirge und im Erzgebirgsvorland ........................................ 36 Poledník L., Poledníková K., Mateos-González F., Beran V., Zápotočný Š.: Zusammensetzung der Nahrung des Fischotters in unterschiedlichen Gewässerhabitaten im Bereich des Erzge- birges und des Erzgebirgsvorlandes ............................................................................................ 60 Beran V., Poledníková K.: Zur Wanderausstellung „Ich bin ein vydra. Wie der Fischotter über die Grenze kam.“ ........................................................................................................................ -

S.1 Supplementary Materials
S.1 Supplementary materials 1 Table S1: River stations analyzed over the period 1950 - 2009. The column elev denotes the mean basin elevation in meters above sea level, area denotes catchment area in km2, forest gives the relative coverage of forest land use (%) based on Corine 1990 data. Forest damage in percent is given in the “damage” column, using the Corine class 324. The columns P , E0, Q and P − Q denote average annual water balance components for the basins in mm/yr. miss gives the number of missing months. station / river major basin elev area forest damage PE0 QP -Q miss Buschmuehle/Kirnitzsch Upper Elbe 397 98 78 1 853 686 298 563 264 Kirnitzschtal/Kirnitzsch Upper Elbe 379 154 77 0 847 687 290 557 0 Porschdorf/Lachsbach Upper Elbe 378 267 39 0 845 687 360 485 0 Sebnitz/Sebnitz Upper Elbe 422 102 47 1 870 686 449 426 264 Markersbach/Bahra Upper Elbe 545 49 45 10 819 678 374 431 267 Bischofswerda/Wesenitz Upper Elbe 363 69 30 0 819 689 362 452 264 Elbersdorf/Wesenitz Upper Elbe 315 227 17 0 789 690 295 496 1 Dohna/Müglitz Upper Elbe 557 198 35 6 848 677 408 440 9 Geising/Rotes Wasser Upper Elbe 780 26 53 35 956 667 559 389 216 Kreischa/Lockwitzbach Upper Elbe 380 44 23 0 779 684 254 531 187 Klotzsche/Prießnitz Upper Elbe 261 40 60 0 724 693 267 454 244 Rehefeld/Wilde Weißeritz Upper Elbe 808 15 91 61 974 666 783 188 140 Ammelsdorf/Wilde Weißeritz Upper Elbe 734 49 64 20 963 671 605 368 18 Beerwalde/Wilde Weißeritz Upper Elbe 663 81 53 12 940 674 527 413 84 Baerenfels/Pöbelbach Upper Elbe 742 6 75 12 976 670 808 194 244 Freital/Poisenbach Upper Elbe 295 12 42 0 720 690 222 493 336 Piskowitz/Ketzerbach Upper Elbe 214 157 0 0 665 696 122 547 336 Seerhausen/Jahna Upper Elbe 178 153 0 0 635 698 63 570 219 Merzdorf/Döllnitz Upper Elbe 167 211 7 0 623 699 136 489 1 Zescha/Hoyersw. -

Hydrologisches Handbuch Gewässerkundliche Hauptwerte Teil 3 11/2012
Hydrologisches Handbuch Gewässerkundliche Hauptwerte Teil 3 11/2012 Inhaltsverzeichnis 1 Vorbemerkung........................................................................................................................................................ 3 2 Alphabetisches Verzeichnis.................................................................................................................................. 4 3 Hydrografisches Verzeichnis................................................................................................................................ 12 4 Erläuterung der Bezeichnungen und Abkürzungen ........................................................................................... 20 5 Gewässerkundliche Hauptwerte........................................................................................................................... 23 5.1 Hauptwerte der Wasserstände................................................................................................................................. 23 5.1.1 Elbe und Nebenflüsse (Obere Elbe) ........................................................................................................................ 24 5.1.2 Schwarze Elster....................................................................................................................................................... 34 5.1.3 Mulde ...................................................................................................................................................................... -

Pegelverzeichnis Teil 1 08/2014 Inhaltsverzeichnis
Hydrologisches Handbuch Pegelverzeichnis Teil 1 08/2014 Inhaltsverzeichnis 1 Vorbemerkung..........................................................................................................................................................3 2 Alphabetisches Verzeichnis der Pegel...................................................................................................................4 3 Alphabetisches Verzeichnis der Gewässer ...........................................................................................................10 4 Erläuterung der Bezeichnungen und Abkürzungen..............................................................................................16 5 Pegelverzeichnis ......................................................................................................................................................19 5.1 Elbe und Nebenflüsse (Obere Elbe)...........................................................................................................................19 5.2 Schwarze Elster .........................................................................................................................................................27 5.3 Mulde .........................................................................................................................................................................29 5.4 Weiße Elster...............................................................................................................................................................40 -

Hydrologisches Handbuch Gewässerkundliche Hauptwerte Teil 3 08/2017 Inhaltsverzeichnis
Hydrologisches Handbuch Gewässerkundliche Hauptwerte Teil 3 08/2017 Inhaltsverzeichnis 1 Vorbemerkung.......................................................................................................................................................... 3 2 Alphabetisches Verzeichnis ................................................................................................................................... 4 3 Hydrografisches Verzeichnis .................................................................................................................................. 10 4 Erläuterung der Bezeichnungen und Abkürzungen ............................................................................................. 18 5 Gewässerkundliche Hauptwerte ............................................................................................................................. 21 5.1 Hauptwerte der Wasserstände .................................................................................................................................. 21 5.1.1 Elbe und Nebenflüsse ................................................................................................................................................ 22 5.1.2 Schwarze Elster ......................................................................................................................................................... 29 5.1.3 Mulde ........................................................................................................................................................................ -
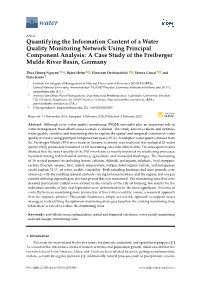
Quantifying the Information Content of a Water Quality Monitoring Network
water Article Quantifying the Information Content of a Water Quality Monitoring Network Using Principal Component Analysis: A Case Study of the Freiberger Mulde River Basin, Germany Thuy Hoang Nguyen 1,2,*, Björn Helm 2 , Hiroshan Hettiarachchi 1 , Serena Caucci 1 and Peter Krebs 2 1 Institute for Integrated Management of Material Fluxes and of Resources (UNU-FLORES), United Nations University, Ammonstrasse 74, 01067 Dresden, Germany; [email protected] (H.H.); [email protected] (S.C.) 2 Institute for Urban Water Management, Department of Hydrosciences, Technische Universität Dresden (TU Dresden), Bergstrasse 66, 01069 Dresden, Germany; [email protected] (B.H.); [email protected] (P.K.) * Correspondence: [email protected]; Tel.: +49-35189219370 Received: 11 November 2019; Accepted: 3 February 2020; Published: 5 February 2020 Abstract: Although river water quality monitoring (WQM) networks play an important role in water management, their effectiveness is rarely evaluated. This study aims to evaluate and optimize water quality variables and monitoring sites to explain the spatial and temporal variation of water quality in rivers, using principal component analysis (PCA). A complex water quality dataset from the Freiberger Mulde (FM) river basin in Saxony, Germany was analyzed that included 23 water quality (WQ) parameters monitored at 151 monitoring sites from 2006 to 2016. The subsequent results showed that the water quality of the FM river basin is mainly impacted by weathering processes, historical mining and industrial activities, agriculture, and municipal discharges. The monitoring of 14 critical parameters including boron, calcium, chloride, potassium, sulphate, total inorganic carbon, fluoride, arsenic, zinc, nickel, temperature, oxygen, total organic carbon, and manganese could explain 75.1% of water quality variability. -

Str. 30 31 32 33 34 35 36 37 Průtokové Vlny V Malém Povodí
Obsah str. 30 Průtokové vlny v malém povodí Červíku 174 Milan Jařabáč 31 Monitoring of technogenic soil system in temperate climate 179 Vladimíra Jelínková, Jana Šebestová, Jan Šácha, M.Dohnal, Michal Sněhota 32 Automatické sněhoměrné stanice 186 Jan Jirák 33 A web system for display and analysis of real-time monitoring 193 observations of small urbanized catchments in Lahti, Finland Jiří Kadlec, Juhani Jarveläinen 34 Testovanie parametrov metódy SCS - CN – efekt predchádzajúcich 199 vlahových podmienok na simuláciu odtoku Beata Karabová 35 Hodnocení distribuce kořenů pšenice a ječmene v laboratorních 206 podmínkách Aleš Klement, Šárka Novotná, Miroslav Fér, Radka Kodešová 36 Monitoring seasonal variability of near-saturated hydraulic conductivity 209 of cultivated soil using automated minidisk infiltrometer Vladimír Klípa, David Zumr, Michal Sněhota 37 Distribuovaný model pro simulaci vývoje a tání sněhové pokrývky na 215 povodí Zbyněk Klose, Jiří Pavlásek, Pavel Pech 38 Behavior of selected pharmaceuticals in soils 223 Radka Kodešová, Martin Kočárek, Aleš Klement, Miroslav Fér, Oksana Golovko, Antonín Nikodém, Roman Grabic, Ondřej Jakšík 39 Aplikace harmonické analýzy pro studium evapotranspirace břehových 230 porostů v suchém období. Případová studie Starosuchdolského potoka Pavel Kovář, Šárka Dvořáková, Jitka Pešková, Josef Zeman, František Doležal, Milan Sůva 40 Hydrologie a hydrochemie dlouhodobě zkoumaného ultrabazického 238 povodí Pluhův bor Pavel Krám, Jan Čuřík, František Veselovský, Oldřich Myška, Anna Lamačová, Jakub Hruška, -

Top Facts About the Environment Along the Hiking Route “Rübenau and Surrounding Area, on the Hunt for Sunken Horses and Wild Game Birds”
Top Facts About the Environment Along the Hiking Route “Rübenau and Surrounding Area, On the Hunt for Sunken Horses and Wild Game Birds” Length of the hike: approx. 8 kilometers Level of difficulty: Easy. Nearly the entire path runs through the Rübenau Plateau. The most difficult part of the hike is an 80 meter difference in elevation in the last kilometer re- turning to the parking lot from the town. Breaks: There is a multitude of beautiful places to take a break and spend some time along the way. Bring some snacks in your bag to enjoy on your break Paths: Well-maintained forest roads and woodland trails Haus der Kammbegegnungen (reservations mandatory) In der Gasse 3 09496 Marienberg/Rübenau Phone: 03735 / 6681251 Gasthof und Pension Bergschänke Bergweg 3 09496 Marienberg/Rübenau Phone: 037366 / 6258 Trail description: The trail parking lot is located at the intersection of Rübenauer Waldstraße Forest Road and Görkauer Street on the northeastern edge of Rübenau. Fees are not charged for use. The trailhead is located at the inside part of the parking lot and follows a forest road running northwest toward Lehmheider Pond. Up the trail 500 meters, we will come to a fork in the trail and take the path on the right. About one kilometer later, we will come to the Vierenweg (marked in red on the nature park hiking map 5/6) and follow it westward until we reach Lehmheider Pond. A bench and little mountain huts beckon for us to stay a while. After another 300 meters, we will come up on the Alten Komotauer Trail and follow it north toward Steinhübel. -

Spatial Decision Support System for the Integrated Management of The
Das Augusthochwasser 2002 im Osterzgebirge und dessen statistische Bewertung The extreme flood in August 2002 in the eastern part of the Ore Mountains and its statistical assessment Andreas Schumann Ruhr- Universität Bochum Lehrstuhl für Hydrologie, Wasserwirtschaft und Umwelttechnik 2 The extreme flood in August 2002 in the eastern part of the Ore Mountains and its statistical assessment z The hydrological event z Statistical evaluation of the flood event z How realistic is the statistical assessment ? 3 The extraordinary level of the flood 2002 in relationship to flood peaks of the past (since 1771) at an old building in the city of Grimma at the Mulde River in Germany 4 Meteorological reason for the floods in August 2002 - Vb- Circulation Pattern 5 Spatial Distribution of the extreme precipitation from August 10 to August 13, 2002 in the German part of the Ore Mountains PMP and Area in sq.km Duration 24 hours Duration 72 hours measured Region rainfall maxima Station Zinnwald 1 to 25 km2 350 mm 312 mm 500 mm 406 mm in August 2002 Region Zinnwald 1.000 km2 300 mm 450 mm Part of the Elbe 5.000 km2 200 mm 275 mm River Basin Watershed Upper 12.000 km2 160 mm 250 mm Elbe Precipitation between August 11 and 13, 2002 in mm PMP with a duration of 12 hours for watersheds with 500 km2 in size in summer (June to August) 7 Areal precipitation values from August 10 to 13 2002 for watersheds in the Ore Mountains 450 Area Precipitation 400 10.8.- 13.08.2002 350 300 250 200 150 100 50 0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Watershed Size km2 Temporal distribution of the precipitation from August 8 11 to 13 for different river basins in Saxonia Pegel Göritzhain/ Chemnitz Pegel Niederschlema/ Zwickauer Mulde Pegel Cotta/ Verein.