Manuskript Ästhetik Des Tabuisierten Final 7.2.17
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Significance of Daily Soaps in the Everyday Life of Children and Young People Maya Götz
1 The significance of daily soaps in the everyday life of children and young people Maya Götz Anybody who ever has anything to do with girls, be it either in the work-world or family, is well accustomed to the programmes Gute Zeiten, schlechte Zeiten (Good times, bad times) (subsequently referred to as GZSZ), Marienhof (Marienhof) , Verbotene Liebe (Forbidden love) or Unter uns (Among us). Amongst 10- to 15-year-olds these series reach their peak viewing rates, and the lists of favourite programmes are dominated monotonously by GZSZ. The girls themselves often describe their passion for soap operas as “an addiction”. It is often difficult for outsiders to relate to the fact that these girls “always” have to sit in front of the TV at a certain time and then “urgently” discuss the programme with their friend/s. In an overall view of these programmes, the lack of quality in production aesthetics and melodramatic content features is a striking characteristic. Therefore, it seems strange how significant “their” soap is for the girls. This is where the study of the IZI has its starting point and investigates the significance of daily soaps in the everyday life of children and youth (Götz 2002, 1999). Interviews were conducted with “soap fans”, who frequently watched one of the four German daily soaps, the children's weekly soap Schloss Einstein (the Einstein Castle) or the real-life soap Big Brother, and considered one of these their favourite programme. Method This study is based on 401 interviews with children and young people between 6 and 19 years old, who stated they frequently watch one of the six soaps mentioned above as their favourite programme. -

Die Virtuelle Strasse Im Netz – Zur Verwendbarkeit Von Online
DIE VIRTUELLE STRASSE IM NETZ – ZUR VERWENDBARKEIT VON ONLINE- AUFTRITTEN DEUTSCHER TV-SEIFENOPERN, INSBESONDERE DER LINDENSTRASSE, IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT by BORIS JETELINA (Under the Direction of Brigitte Rossbacher) ABSTRACT With the help of the internet, access to video is becoming much easier and the internet itself is a versatile source for teaching material. Even a soap opera, such as Lindenstraße and its website, can be used to teach language and culture effectively. This thesis explores the problems a teacher may come across in the foreign language classroom when teaching culture as well as other aspects of the German language. The thesis also provides suggestions on how to resolve them. Furthermore, it examines the opportunities for the classroom offered by Lindenstraße online and includes a lesson plan that makes use of the multiple features of the Lindenstraße website. INDEX WORDS: Soap opera, German, Culture, Video, Internet, Second language acquisition DIE VIRTUELLE STRASSE IM NETZ – ZUR VERWENDBARKEIT VON ONLINE- AUFTRITTEN DEUTSCHER TV-SEIFENOPERN, INSBESONDERE DER LINDENSTRASSE, IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT by BORIS JETELINA A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of the University of Georgia in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree MASTER OF ARTS ATHENS, GEORGIA 2007 © 2007 Boris Jetelina All Rights Reserved DIE VIRTUELLE STRASSE IM NETZ – ZUR VERWENDBARKEIT VON ONLINE- AUFTRITTEN DEUTSCHER TV-SEIFENOPERN, INSBESONDERE DER LINDENSTRASSE, IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT by BORIS JETELINA Major Professor: Brigitte Rossbacher Committee: Christine Haase Alexander Sager Electronic Version Approved: Maureen Grasso Dean of the Graduate School The University of Georgia May 2007 DANK Ich möchte an dieser Stelle Dr. Rossbacher danken für ihre tatkräftige Unterstützung bei der Zusammenstellung der Sekundärliteratur und für ihre Bereitschaft, zu jeder Zeit meine Fortschritte mit mir zu besprechen. -

Who Knows You Better Than RTL? France’S Leading Radio Station Shows in a Campaign How Close It Is to the French Hearts
31 March 2011 week 13 Who knows you better than RTL? France’s leading radio station shows in a campaign how close it is to the French hearts United States Germany American Idol extends Grundy UFA starts producing Facebook presence extended episodes of Verbotene Liebe Denmark 15-year-old Sarah wins France X Factor Jacques Esnous on RTL Radio’s Japan coverage the RTL Group intranet week 13 31 March 2011 week 13 Cover: Snapshot from the RTL Radio campaign trailer Who knows you better 2 than RTL? France’s leading radio station shows in a campaign how close it is to the French hearts United States Germany American Idol extends Grundy UFA starts producing Facebook presence extended episodes of Verbotene Liebe Denmark 15-year-old Sarah wins France X Factor Jacques Esnous on RTL Radio’s Japan coverage the RTL Group intranet week 13 Slightly cheeky, but seriously informative In its new, definitely tongue-in-cheek ad campaign, RTL Radio in France has set out to highlight the unique, extremely strong link the station has forged with its listeners. France - 31 March 2011 The first poster proclaims that: “French people make exceptional lovers…according to 95% of French people”. The second claims: “The French love consensus. 50% agree with this statement and 50% do not”. The third and last poster notes that: “French people are worried about the environment...and about rising oil prices”. All three posters end with the tagline: “Who knows you better than RTL?”. For its new communication campaign, the French radio station RTL Radio has opted try something fresh and new. -
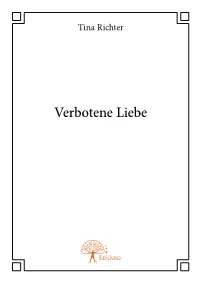
Verbotene Liebe
Tina Richter Verbotene Liebe ----------------------------INFORMATION---------------------------- Couverture : Classique 2 [Grand format (170x240)] NB Pages : 66 pages - Tranche : (nb pages x 0,055 mm)+2 = 5.63 ---------------------------------------------------------------------------- Verbotene Liebe 6.62 596609 Tina Richter 2 2 Fichiers audio Fichier audio n°1 : Die Handlung in Kürze Fichier audio n°2 : Vornamen Fichier audio n°3 : Diktat Fichier audio n°4 : Kleider Fichier audio n°5 : Bundesländer Fichier audio n°6 : Eine Episode Fichier audio n°7 : Vokablen Fichier audio n°8 : Vokabeln Fichier audio n°9 : Adjektive Fichier audio n°10 : Die Folge 21 Fichier audio n°11 : Weibliche Berufe Fichier audio n°12 : Lebenslauf Fichier audio n°13 : Wortschatz B2 Situationen im Alltag Fichier audio n°14 : Wortschatz B2 von A bis Z 2 3 4 2 Tina RICHTER : « Verbotene Liebe » Cette méthode se donne comme objectif de rapprocher l’apprentissage de la langue allemande de la réalité et du quotidien des Allemands. Elle propose une approche inédite et ouverte qui tient compte des intérêts et des besoins de l’apprenant et lui permet d’acquérir les connaissances dont il a besoin pour réussir ses épreuves de langue. Conçu pour répondre aux attentes A2 – B2, cet ouvrage favorise un apprentissage dynamique qui se base sur un document sonore authentique, la série télévisée allemande « Verbotene Liebe ». Malgré son immense succès auprès du public, cette série ne connait à ce jour aucune didactisation et elle n’est que rarement utilisée en cours de langue. Or, avec ses personnages attachants, ses dialogues qui reflètent la conversation de tous les jours et des thématiques d’actualité, elle forme une base idéale de motivation pour l’apprenant. -

How RTL Group Gives Back to Society (2013)
corporaTe responsibiliTy how In 1924, a sole radio transmitter broadcast from Luxembourg. Today, RTL Group has a portfolio of 53 TV channels in ten countries. RTL Group’s worldwide production arm – which adopted the company rTl group name FremantleMedia in 2001 – grew its revenues by 128 per cent to € 1.7 billion since its inception. gives back To socieTy Corporate responsibility Corporate responsibility company overview: best-in-class european entertainment company helping, The iLuxembourgbasednforming, company has interests in TV channels and radio BROADCAST stationsp inromo Germany,Ting France, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, Strong #1 or #2 in attractive Spain, Hungary, Tions Croatia, and India. key countries It is one solu of the world’s leading producers of television content, such as CONTENT talent and game shows, drama, daily soaps and telenovelas, including Global leader in TV entertainment production, exploitation and distribution Idols, Got Talent, The X Factor, Good Times − Bad Times and Family Feud. DIGITAL The roots of the company date back to 1924, when Radio Luxembourg At the forefront of the digital and fi rst went on air. Compagnie Luxembourgeoise de Radiodiffusion (CLR) non-linear transition was founded in 1931. As a Euro pean pioneer, the company broadcast a TEAM unique programme in several languages using the same frequency. Highly experienced international manage- RTL Group itself was created in spring 2000 following the merger of ment team with an integrated approach Luxembourgbased CLTUFA and the British content production company RESULTS Pearson TV,Television owned by UK media group Pearson will PLC. CLTUFA itself was Strong track record of delivering created in 1997 when the shareholders of UFA (Bertelsmann) and the fi nancial results historic Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion – CLT (Audiofi na) merged their TV, radioremain and TV production businesses. -

Connect ID TV Connect ID 55 Connect ID 46 Connect ID 40 35907000
Connect ID TV Connect ID 55 Connect ID 46 Connect ID 40 35907000 Quick guide Connect ID 40-55 - 2 - Quick guide Table of contents Welcome! .......................................................................................3 Video ............................................................................................25 Scope of delivery .......................................................................................... 3 Video playback ............................................................................................26 About this quick guide ................................................................................. 3 Additional functions for DR+ archive playback ................................... 27 Imprint ............................................................................................................ 3 Audio/Radio ...............................................................................28 For your safety ..............................................................................4 Audio playback ...........................................................................................29 Technical information (Connect ID DR+) .................................................. 5 Radio mode (DVB radio) ...........................................................................30 Radio mode (Internet radio) ......................................................................31 english Basic functions .............................................................................6 Photo -

Tatjana KäStel
Tatjana Kästel Share, rate and discuss pictures of Tatjana Kästel's feet on wikiFeet - the most comprehensive celebrity feet database to ever have existed. People who liked Tatjana Kästel's feet, also liked: Jennifer Aniston. Sandra Bullock. Tatjana Kaestel Photos - 1 of 21 Photos - (L-R) Nicole Mieth, Tatjana Kaestel, Verena Zimmermann and Miriam Lahnstein pose for a portrait during the '20 Jahre Verbotene Liebe' photocall on December 10, 2014 in Cologne, Germany. Tatjana Kaestel Photos - 1 of 21. Thanks for signing up! Please check your email (you may need to check your promotions tab) to confirm your subscription! Tatjana Kaestel Photos - 1 of 21»Photostream. Pictures. '20 Jahre Verbotene Liebe' Photo Call. Tatjana Kästel, Actress: Verbotene Liebe. Tatjana Kästel was born on March 20, 1982 in Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany. She is an actress, known for Verbotene Liebe (1995), Medicopter 117 - Jedes Leben zählt (1998) and SOKO Köln (2003). Find the perfect Tatjana Kaestel stock photos and editorial news pictures from Getty Images. Download premium images you can't get anywhere else. Tatjana Kaestel Pictures and Images. Close. We're having trouble loading your results. Melanie Kogler (left) and Tatjana Kästel als Marlene and Rebecca. A noble interlude at âžVerbotene Liebe✠(Forbidden Love): Rebecca & Marlene are falling in love with each other. Countess Rebecca von Lahnstein (played by Tatjana Kästel) falls in love with musical singer Marlene von Lahnstein (Melanie Kogler). Marlene, who had only been with men up to now, discovers her feelings for Rebecca, too. -

Falsche Götter
DIENSTAG, 30. DEZEMBER 2014 / NR. 22 269 MEDIEN DER TAGESSPIEGEL 23 „Lustlos, aber aktiv“ Falsche Götter Gespräch über den Nutzen und die Nutzer Der norwegische Dreiteiler „Mammon“ knüpft an den Erfolg von Stieg Larssons „Millennium“-Trilogie an der zahllosen Online-Petitionen für alles und jedes Von Stefanie Kaufmann Dimeski gativer Journalist, der nur schwer Nähe Herr Donsbach, Herr Schürmann, mehr durch solche neuen Formen ergänzt zu anderen Menschen aufbauen kann. als 200000 Menschen haben bislang die wird. Mit anderen Worten: Diejenigen, Hektik in der Redaktion: Der Tageszei- Die skandinavischen Serienerfolge ka- Online-Petition „Für ein buntes Deutsch- die sich offline engagieren, sind auch die tung „Aftenavisen“ liegen Geheimdoku- men bisher zumeist aus Dänemark und land“ und gegen Pegida unterschrieben. Ersten, die dies im Netz tun. mente zur Aufdeckung eines der größten Schweden. Dänische Politserien wie Eine Million sollen es werden. Realistisch? Was können derartige Online-Bewegun- Wirtschaftsskandale Norwegens vor. Der „Borgen – Gefährliche Seilschaften“ und Ja, das kann man für realistisch halten. gen erreichen? Stoff ist hochbrisant, die Quelle exklusiv „Kommissarin Lund – Das Verbrechen“ und das Blatt der Konkurrenz zeitlich vo- sowie die dänisch-schwedische Produk- Eine Million wären immer noch nur 1,6 In erster Linie geht es darum, Aufmerk- Prozent der Wahlberechtigten in raus, kurzum: die Story ist heiß. Politiklei- tion „Die Brücke – Transit in den Tod“ samkeit zu erreichen und die Anhänger ter Frank Mathiesen will die -
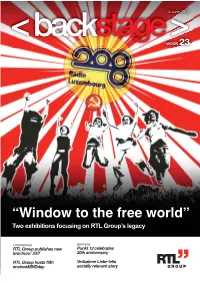
“Window to the Free World” Two Exhibitions Focusing on RTL Group’S Legacy
6 June 2012 week 23 “Window to the free world” Two exhibitions focusing on RTL Group’s legacy Luxembourg Germany RTL Group publishes new Punkt 12 celebrates brochure: 24/7 20th anniversary RTL Group hosts fi fth Verbotene Liebe tells environMINDday socially relevant story week 23 the RTL Group intranet Cover: Montage with Radio Luxembourg’s logo 2 week 23 the RTL Group intranet Cultural heritage Exhibitions in Warsaw and Luxembourg are dedicated to the signifi cance of RTL and Radio Luxembourg – from two different perspectives. Luxembourg - 6 June 2012 For more information, please see varsovie.mae.lu Jacques Santer (left) with ambassador Conrad Bruch (center) at the opening of the exhibition in Warsaw In Warsaw, an exhibition entitled ‘Wspominając There is no denying that Radio Luksemburg w PRL’ (Remembering many of the people who make Radio Luxembourg in the People’s Republic of up Poland’s political, economic and Poland), is currently showing in the salons of the cultural elite today listened to Radio Luxembourg Embassy of the Grand Duchy of Luxembourg , in their youth. According to the Polish newspaper under the patronage of HRH the Grand Duke of Gazeta, Honorary Minister of State and Luxembourg and the President of the Republic Chairman of the Board of CLT-UFA, Jacques of Poland, Bronisław Komorowski. Santer, who attended the offi cial opening of the exhibition as a guest of honour, said: “When The idea for this initiative came to Conrad I fi rst met Margaret Thatcher in my capacity Bruch, the Ambassador of the Grand Duchy of as prime minister, she exclaimed: ‘Oh, Luxembourg in Poland. -

Tendenzen Im Zuschauerverhalten 111 | Media Perspektiven 3/2015
Media Perspektiven 3/2015 | 110 (2) soll nachfolgend über das Fernsehnutzungsver- Fernsehgewohnheiten und halten des vergangenen Jahres berichtet werden. Fernsehreichweiten im Jahr 2014 Wie gewohnt stehen dabei Informationen über den Zeitaufwand für das Fernsehen und die Sender- sowie die Sendungspräferenzen des Publikums im Tendenzen im Zentrum. Im Unterschied zu früheren Jahren bliebe der Jahresrückblick auf die Fernsehgewohnheiten Zuschauerverhalten jedoch unvollständig, wenn nicht auch die genann- Von Camille Zubayr* und Heinz Gerhard** ten neuen nonlinearen Angebotsformen Berücksich- tigung fänden. Der Fernsehmarkt 2014 zeichnete sich durch zwei So umfänglich die neuen nonlinearen Angebote aus- Nutzung von übergreifende Entwicklungen aus: Zum einen dräng- fallen, so lückenhaft ist allerdings auch die Infor- Streamingangeboten ten zunehmend Fernsehangebote über nonlineare mationslage über ihre bevölkerungsweite Nutzung. noch kein Verbreitungsformen, wie Video-on-Demand und Die Gründe hierfür sind vielfältig: Zunächst wird Massenphänomen Streaming, in den Markt. Zum anderen setzte sich diese vom linearen Fernsehen vollkommen losge- die seit einigen Jahren beobachtbare Fragmentie- löste Form der Bewegtbildnutzung von der Mess- rung fort, kleinere Programme erzielen Marktanteils- technologie der AGF noch nicht erfasst. Vorausset- zuwächse bei der Fernsehnutzung. Diese Fragmen- zung hierfür ist eine gewisse Marktrelevanz, um tierung ist allerdings zum Teil auch eine Binnen- auch den finanziellen Aufwand für die Messung zu fragmentierung: Die vier großen Sendergruppen rechtfertigen. Die Betreiber selbst bekunden für ARD, ZDF, RTL und ProSiebenSat.1 konnten in den ihre Dienste eine jeweils sehr hohe Marktrelevanz, letzten Jahren mit digitalen Zusatzprogrammen unterlassen aber bislang die Veröffentlichung kon- Marktanteilsrückgänge in den jeweiligen Haupt- kreter Kunden- bzw. Nutzerzahlen. Eine erste empi- programmen ausgleichen – oder sogar Zugewinne rische Annäherung bietet eine Umfrage, deren Feld- erzielen. -

U Funktionen Von Soap Operas Für Die Zuschauer
media perspektiven 1/98 x46 ............................................................................................................................................................... haben, bei demdie Zuschauer die auf demBild- schirmpräsentierten Gefühle nachvollziehen, sich auf die Geschichten einlassen, mit den Figu- U Funktionen von Soap operas ren mitleiden etc. Solche Funktionen hängen allerdings in hohemMaße von den individuel- für die Zuschauer len Motiven und Aktivitäten der Zuschauer ab, ARD-Forschungsdienst* die die Wirkungen von Soap operas beeinflussen (vgl. die Studie von Kimund Rubin). Soap operas können offensichtlich auf die Der Begriff der Soap opera (Seifenoper) geht auf Wahrnehmung und Beurteilung sozialer Realität Bartergeschäfte in den 50er Jahren zurück, als einwirken (vgl. Shrum1996) und erfüllen damit große amerikanische Waschmittelhersteller Fort- für einen Teil der Zuschauer soziale Orientie- setzungsgeschichten für das Fernsehen produ- rungsfunktionen. Wahrscheinlich orientieren zieren ließen und ihnen imGegenzug dafür von sich die Zuschauer in gewissemMaß an den dar- den Programmveranstaltern kostenlose Werbe- gestellten Lebensentwürfen, den Charakteren, zeit zur Verfügung gestellt wurde. Wie so häufig deren Handlungen und Problemlösungen, wobei wurde dieses, in den USA erfundene Format von die eigene Lebenszufriedenheit sowie spezifi- deutschen Programmanbietern übernommen, sche Persönlichkeitsmerkmale wichtige Voraus- zunächst als synchronisierte Fassungen amerika- setzungen sind. Angesichts der Ergebnisse -

Ard Zdf Rtl Sat.1 Pro 7 Wdr Nrw.Tv Mdr Br Ndr Kika 3 Sat Arte Rtl 2 Kabel Eins
Westfälische Rundschau · Nr. 284 · RTV1_ Medien-Rundschau Dienstag, 6. Dezember 2011 $ Der Synchronsprecher Rainer Brandt sorgte für den trockenen, schrägen Humor der Spencer-und-Hill-Filme " %& ' ! " ( München. Harald Schmidt be- Berlin. Die entscheidende kommt einen dritten Sende- Tim Müßle Antwort sparte sichGünther platz. Vom10. Januar an ist er Jauchfür den Schluss seiner mit seiner „Harald Schmidt SchwäbischGmünd/Berlin. Bud im Fernsehen Sendung am Sonntagabend Show“ auchdonnerstags ab „Sie drehten gerade eine Sze- auf: „Ichglaube einfach, dass 23.15 Uhr zu sehen. ne in einem orientalischen Ba- „Aladin“, Sonntag, 11.12., Ka- ichdas nicht gut kann. Und als Sat.1-Chef Joachim Kosack: sar, wo ein Liliputaner mit beleins, 12.45 Uhr Nachfolger von dir könnte ich „Indem wir die wöchentliche einem Messer in der Hand an es schon garnicht“, sagte er im Frequenz einer inhaltlichsehr einem riesigen Wandteppich „Hügel der blutigen Stiefel“, RTL-Jahresrückblickzusei- starken Sendung erhöhen, ma- runterrutschen muss, um dann Montag, 26.12., MDR, 23.30 nem langjährigen Freund Tho- chen wir aus der ,Harald unten angekommen, Carlo Uhr mas Gottschalk. Das ZDF Schmidt Show’ endlicheine diesen Gruß aus Solingen in muss die Suche nacheinem richtige Late Night.“ Dabei die Rippen zu jagen“, erinnert „Banana Joe“, Samstag(Sil- Nachfolger für „Wetten liegt die Betonung auf „inhalt- sichRainer Brandt. Mit „Car- vester), 31.12., Kabeleins, dass..?“ somit fortsetzen. lichstark“. Ein Quotenknaller lo“ ist Bud Spencer gemeint, 12.10 Uhr Jauchhatte den Spannungs- ist die Show seit Schmidts und der „Gruß aus Solingen“ bogen von Gottschalks letzter Rückkehr von der ARDzusei- beschreibt ein Messer.Diese Sendung am Vorabend in sei- nem Stammsender nicht eben.