Paßstraßen Im Nordzug Der Frankenalb Von
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ausbaustrecke Nürnberg–Ebensfeld Abschnitt Hallstadt–Breitengüßbach Aus- Und Neubaustrecke Nürnberg–Berlin
Titel: Archäologische Grabungen entlang der Strecke: Vor- und Frühgeschichtliche Siedlungen werden freigelegt und dokumentiert Titel: Bauabschnitt Hallstadt–Breitengüßbach mit Straßenüberführung über die Bundesautobahn 70, Visualisierung Ausbaustrecke Nürnberg–Ebensfeld Abschnitt Hallstadt–Breitengüßbach Aus- und Neubaustrecke Nürnberg–Berlin Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 8 Nürnberg–Berlin Von der Europäischen Union kofinanziert Transeuropäisches Verkehrsnetz (TEN-V) Strecke Hallstadt–Breitengüßbach vor dem viergleisigen Ausbau in Hallstadt Ortsdurchfahrt Hallstadt, Visualisierung Bahnbau und Umwelt Schall- und Erschütterungsschutz Durch den Bau einer Bahntrasse sind Eingriffe in Natur und Für den Schall- und Erschütterungsschutz wurde auf Grund- Landschaft zwar unvermeidlich, sie können aber gemindert lage der geltenden gesetzlichen Bestimmungen ein Konzept oder ausgeglichen werden. Wenn Verluste an Lebensräumen erarbeitet. für Tiere und Pflanzen nicht vor Ort zu kompensieren sind, werden sie an anderer Stelle gleichwertig kompensiert. In Die Anwohner werden umfassend vor Lärm geschützt. Schall- einem Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) werden schutzwände und -wälle entstehen entlang der Trasse auf alle Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen fünf Kilometern Länge, teilweise auch Mittelwände zwischen dokumentiert. Die Maßnahmen werden mit den Umweltbe- den Gleisen. Sie mindern den Bahnlärm in den Ortsbereichen. hörden abgestimmt. Geschützte Zauneidechsen wurden vorab in unmittelbarer Neben diesen aktiven Schallschutzmaßnahmen -

Planfeststellungsbeschluss Für Den Ausbau Der Kreisstraße BA 5 Von
Planfeststellungsbeschluss für den Ausbau der Kreisstraße BA 5 von Bau-km 0-035 bis Bau-km 2+004 (Str.-km 9+661 bis Str.-km 7+687) im Gebiet der Stadt Hallstadt und der Gemeinde Gundelsheim, Landkreis Bamberg Aktenzeichen: 32-4354.40-2/2007 Bayreuth, den 15.05.2014 Regierung von Oberfranken Übersichtsplan Übersichtsplan Seite 2 von 50 Regierung von Oberfranken Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Seite ÜBERSICHTSPLAN .............................................................................................. 2 INHALTSVERZEICHNIS ........................................................................................ 3 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS .............................................................................. 5 A. ENTSCHEIDUNG ............................................................................................ 11 1 Feststellung des Plans ............................................................................... 11 2 Festgestellte Planunterlagen ...................................................................... 11 3 Umfasste Entscheidungen ......................................................................... 13 3.1 Wasserrechtliche Planfeststellung ............................................................................................. 13 3.2 Wasserrechtliche Erlaubnis - Gehobene Erlaubnis .................................................................... 13 4 Straßenrechtliche Verfügungen ................................................................. 13 5 Nebenbestimmungen, Ausnahmen und Befreiungen -

Mitteilungsblatt 17/2020
Gemeinde Gundelsheim www.gemeinde-gundelsheim.de Gemeinde Gundelsheim - Karmelitenstr. 11 - 96163 Gundelsheim Ausgabe 09/ 2020 Gemeinde Gundelsheim • Karmelitenstr. 11 • 96163 Gundelsheim Ausgabe 17 Tel.: 0951/94444- -Mail: [email protected] Freitag, 15. Mai 2020 Tel.: 0951/94444-0 ŏ(• E-Mail: [email protected] Freitag, 21. August 2020 Impuls. Genau in dieser besonderen Zeit beginnt die neue Wahlperiode 2020 - 2026. VielesB fokussiertÜ C H sich E Rauf E I Covid-19 und dabei wird manchmal auch vergessen, dass es noch andere Themen in der Welt, in unserer Gemeinde, im privaten Umfeld gibt. In den nächsten Jahren werden besonders die PunkteGUNDELSHEIM Klimawandel, Digitalisierung, soziale Gerechtigkeit als Entscheidungsparameter bei allen Debatten im Mittelpunkt stehen. Dabei müssen aus Worthülsen tatsächliche Handlungen abgeleitet werden.Bachstr. 12 96163 Gundelsheim Die Erwartungen an den Gemeinderat sind hoch und die Aufgaben vielfältig: Schaffung von Wohnraum, Bürger-Gast-Haus HS7, Gemeindebücherei, Erweiterung Kindertagesstätte, Kläranlage, Neugestaltung Karmelitenstraße, Nutzung Festplatz, Lärmschutz Autobahn, Radewege- und ÖPNV-Anbindung,Öffnungszeiten … Dabei gilt es weiterhin parteiübergreifend die beste Lösung zu finden, Kompromisse zu erzielen. Zwar liegt es in der Natur der Sache, dass es teilweise unterschiedliche Auffassungen gibt, trotzdem gilt es mit Fairness, Mo 17 – 19 Uhr Sonntag,Respekt und Ehrlichkeit dem zu diskutieren. 30. August 2020 Di 16 – 18 Uhr BesuchUnd am Ende Brunnenhaus sollten wir die gemeinsamen und Ab machungenHochbehälter einhalten und nurDo das 10von – anderen14 Uhr einfordern, was wir auch selbst bereit sind zu geben. Dann bräuchte es vieleSo Aufrufe 10 –u.a. 12 nachUhr 16ordentlichem Uhr bis 17 Parken, Uhr nach sauberen Rinnen am Straßenrand, nach sichtbaren Hausnummerierungen, nach regelmäßigen Heckenschnitt, nach Einhaltung der Anleinpflicht, nach angemessenem Abstand, Treffpunkt:nach Beachtung Rathaus, der Bauordnung Karmelitenstr. -

Die Historische Kultur- Landschaft Von Kemmern
DIE HISTORISCHE KULTUR- LANDSCHAFT VON KEMMERN Thomas Gunzelmann Einleitung Die Vorgaben des Naturraums Die Kulturlandschaft ist das sichtbare Ergebnis der Ausei - Die Gemarkung Kemmern ist großräumig dem Fränkisch- nandersetzung des Menschen mit dem von der Natur vor - Schwäbischen Schichtstufenland und genauer dessen Un - gegebenen Raum im Verlauf der Geschichte. Je weiter man tereinheit des Fränkischen Keuperberglandes zuzuordnen. zeitlich zurückgeht, desto stärker war eine Dorfgemeinde Auf lokaler Ebene erstreckt sich das Gemeindegebiet über wie Kemmern auf die lokalen Ressourcen angewiesen und zwei Naturräume: Im kleineren westlichen Teil sind dies die desto intensiver war auch die kleinräumige Gestaltung der südlichen Haßberge, im größeren östlichen der Talraum des Landschaft durch die Landnutzung fast aller Einwohner. Obermains. (Abb. 1) Der tiefste Punkt des Gemeindegebietes Heute ist diese enge Bindung der materiellen Lebensgrund - liegt beim Austritt des Maines aus diesem bei etwa 235 m, lagen an die überschaubare Gemarkung eines Ortes weit - der höchste Punkt liegt bei 380 m auf dem Semberg im Be - gehend aufgehoben und durch supranationale Wirtschafts - reich des „Wiesenthauer Schlages“. Morphologisch ist das kreisläufe mit den Tendenzen zur Konzentration bis hin Areal deutlich in zwei gegensätzliche Teile geteilt und dies zur Monopolisierung ersetzt. Dennoch lassen sich die Zeug - entlang einer geologischen Störungslinie, dem Talrandbruch nisse der historischen Nutzung dieses Raumes durch Land - am westlichen Rand des Maintales, der sehr geradlinig von wirtschaft, Gewerbe, Verkehr und auch durch Erholungs - Nordnord-West nach Südsüd-Ost verläuft. Westlich dieser funktionen immer an bestimmten landschaftlichen Merk - Linie steigt das Bergland der Südlichen Haßberge, hier im malen – sowohl einzelnen Elementen wie auch größeren Bereich des Höhenzuges des Sembergs, steil um bis zu 140 Strukturen – ablesen, in Kemmern sogar weit stärker als in Höhenmeter auf einer Entfernung von 800 m an, während vielen Nachbarorten. -

Sommerturnier SV Hallstadt G- Jugend No. 1, Gr. a Court 1 10:00 SV Hallstadt 1 SC Kemmern : Goalscorers Sommerturnier SV Hallsta
Sommerturnier SV Hallstadt G- No. 1, Gr. A Sommerturnier SV Hallstadt G- No. 2, Gr. A Jugend Jugend Court 1 10:00 Court 2 10:00 SV Hallstadt 1 : SC Kemmern 1. FC Bischberg : SpVgg Rattelsdorf Goalscorers Goalscorers Made with passion by tournej Made with passion by tournej Sommerturnier SV Hallstadt G- No. 3, Gr. B Sommerturnier SV Hallstadt G- No. 4, Gr. B Jugend Jugend Court 1 10:10 Court 2 10:10 SV Hallstadt 2 : SV Gundelsheim SV Dörfleins : TSV Kleukheim Goalscorers Goalscorers Made with passion by tournej Made with passion by tournej Sommerturnier SV Hallstadt G- No. 5, Gr. A Sommerturnier SV Hallstadt G- No. 6, Gr. A Jugend Jugend Court 1 10:20 Court 2 10:20 SpVgg Trunstadt : SV Hallstadt 1 SpVgg Rattelsdorf : SC Kemmern Goalscorers Goalscorers Made with passion by tournej Made with passion by tournej Sommerturnier SV Hallstadt G- No. 7, Gr. B Sommerturnier SV Hallstadt G- No. 8, Gr. B Jugend Jugend Court 1 10:30 Court 2 10:30 DJK Bamberg : SV Hallstadt 2 TSV Kleukheim : SV Gundelsheim Goalscorers Goalscorers Made with passion by tournej Made with passion by tournej Sommerturnier SV Hallstadt G- No. 9, Gr. A Sommerturnier SV Hallstadt G- No. 10, Gr. A Jugend Jugend Court 1 10:40 Court 2 10:40 SpVgg Trunstadt : 1. FC Bischberg SpVgg Rattelsdorf : SV Hallstadt 1 Goalscorers Goalscorers Made with passion by tournej Made with passion by tournej Made with passion by tournej Sommerturnier SV Hallstadt G- No. 11, Gr. B Sommerturnier SV Hallstadt G- No. 12, Gr. B Jugend Jugend Court 1 10:50 Court 2 10:50 DJK Bamberg : SV Dörfleins TSV Kleukheim : SV Hallstadt 2 Goalscorers Goalscorers Made with passion by tournej Made with passion by tournej Sommerturnier SV Hallstadt G- No. -

Das Fränkische Wendland
Das fränkische Wendland und das „Eisenland“ zwischen Main und Steigerwald mit seinen slawischen Orts-, Gewässer-, Berg-, Wald- und Flurnamen Eine Spurensuche im Bereich Würzburg - Ansbach – Ingolstadt - Bamberg - Fulda von Michael Steinbacher 1 ... aber Wortgeschichte tut uns nicht den Gefallen, einfach zu sein. Jost Trier 2 Inhaltsverzeichnis VORWORT ................................................................................................................................................. 8 SUUINFURTER MARCA, FOLCFELDER MARCA, WINIDO MARCA ........................................................................................... 9 DAS „GEIßFELD“ GOZFELD IM MAINDREIECK ................................................................................................................. 9 DIE MAINWENDEN UND DIE REGNITZWENDEN ............................................................................................................... 9 NAMEN ALS ZEUGEN DER GESCHICHTE ...................................................................................................... 11 HINWEISE ZUR BENUTZUNG DES BUCHES .................................................................................................. 13 DER BAYERNATLAS ONLINE ...................................................................................................................................... 13 WENDEN, WINDEN, DEUTSCHE UND FRANKEN .......................................................................................... 14 DIE „SLAWISIERUNG“ DES ÖSTLICHEN FRANKEN .......................................................................................................... -

Schulpsychologen Für Grund- Und Mittelschulen Schuljahr 2020/21
Schulpsychologen für Grund- und Mittelschulen Schuljahr 2020/21 Schulamtsbezirk Name Schule/ Dienststelle zuständig für: Erlöserschule Gangolfschule Gaustadt Hainschule Kaulbergschule Erlöser-Mittelschule Bamberg BerRin Luitpoldschule Neuerbstr. 20 Groeschke, Martinschule 96052 Bamberg Tanja Rupprechtschule Tel. 0951/9321600 Trimmbergschule Wunderburgschule Bamberg Stadt Kunigundenschule Montessorischule GS Domschule Domschule Bamberg GS GS Burgwindheim Lin Obere Karolinenstr. 4a GS Ebrach Habermeier, 96049 Bamberg GS Pommersfelden Elke Tel. 0951/95200811 GS Schönbrunn Fax 0951/95200817 GS/MS Schlüsselfeld GS Stegaurach GS/MS Hallstadt Hans-Schüller-Grundschule GS/MS Breitengüßbach Königshofstr. 3 GS/MS Oberhaid BerRin Hoch, 96103 Hallstadt GS/MS Zapfendorf Jutta Tel. 0951/9740117 GS Strullendorf + 0951/974010 GS Buttenheim Fax 0951/9740129 GS Hirschaid GS Sassanfahrt Hans-Schüller-Grundschule Königshofstr. 3 Bamberg-Landkreis SRin Müller, Heidelsteigschule 96103 Hallstadt Nadine Bamberg Tel. 0951/974010 Fax 0951/9740130 GS Memmelsdorf Mittelschule Scheßlitz MS Scheßlitz Mittlerer Weg 8 Lin Rudrof, GS Königsfeld 96110 Scheßlitz Carola GS/MS Litzendorf Tel. 09542/ 772343 GS Stadelhofen Fax 09542/ 921096 GS Heiligenstadt Grundschule Lin Priesendorf-Lisdorf GS Priesendorf Seidenath, Schindsgasse 10 GS/MS Bischberg Christine 96170 Priesendorf GS Viereth-Trunstadt Tel. 09549/442 Fax 09549/5139 Kilian-Grundschule-Scheßlitz GS Scheßlitz Ostlandstr. 1 Lin Fösel, GS/MS Baunach 96110 Scheßlitz Sandra GS Kemmern Tel. 09542/921215 GS Rattelsdorf -
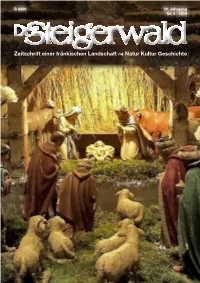
Steigerwald-2019-4.Pdf
B 4260 39. Jahrgang Nr. 4 - 2019 Zeitschrift einer fränkischen Landschaft d Natur Kultur Geschichte Das Geschenk für jeden Anlass Kaffeepott „Steigerwald“ aus Keramik mit 4-farbigem Druck nur 9.50 € Bierkrug „Steigerwald“ aus Keramik mit 4-farbigem Druck, 0,5 ltr. So… nur 13.80 € … bestellen Sie Ihren Kaffeepott oder Ihren Bierkrug • rufen Sie uns an: 09723 - 934730 oder • mailen Sie uns: [email protected] Nach Erhalt der Ware zahlen Sie bequem per Rechnung oder Bankeinzug. Beachten Sie bitte, dass wir für den Versand zusätzlich 6.- Euro berechnen müssen. Druck & Media Unteidig GmbH Schweinfurter Straße 3, 97506 Grafenrheinfeld Druckpartner des Steigerwaldklubs für die Mitgliedszeitschrift „Der Steigerwald“ Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde, Weihnachten und ein Neues Jahr stehen vor der Tür. Wir freuen uns auf einige Tage der Ruhe und der Begegnung mit Verwandten, Freunden oder Bekannten. Weihnachten ist auch eine Zeit der Besinnung und wir erinnern uns in diesen Tagen an das, was das ganze Jahr hindurch alles passiert ist. Zum Jahresende möchte ich die Gelegenheit nutzen, allen ganz herzlich Danke zu sagen, die sich für das Wohl des Steigerwaldklubs engagieren. Insbesondere danke ich allen, die in den Zweig- und Korporativ-Vereinen, Gemeinden und dem Hauptvorstand in ihrer Freizeit ehrenamtlich tätig sind. Diese Leistungen sind nicht hoch genug einzuschätzen. Unser Vereinsleben steht und fällt mit dem ehrenamtlichen Engagement. Nicht nur ein Stück Kultur, sondern unsere gesamte Lebensweise gerät in Gefahr, wenn es nicht gelingt, Menschen für Ehrenämter zu gewinnen. Dafür ebenfalls persönlich herzlichen Dank. Das Jahr 2019 war geprägt von den Vorbereitungen und der Durchfüh- rung des 40-jährigen Jubiläums (1979 – 2019) am Drei-Franken-Stein. -

Waldeckische Bibliographie“ Im Juni 1998 Gedruckt Wurde (Zu Hochgrebe S
WALDECKISCHE BIBLIOGRAPHIE Bearbeitet von HEINRICH HOCHGREBE 1998 Für die Präsentation im Internet eingerichtet von Dr. Jürgen Römer, 2010. Für die Benutzung ist unbedingt die Vorbemerkung zur Internetpräsentation auf S. 3 zu beachten! 1 EINLEITUNG: Eine Gesamtübersicht über das Schrifttum zu Waldeck und Pyrmont fehlt bisher. Über jährliche Übersichten der veröffentlichten Beiträge verfügen der Waldeckische Landeskalender und die hei- matkundliche Beilage zur WLZ, "Mein Waldeck". Zu den in den Geschichtsblättern für Waldeck u. Pyrmont veröffentlichten Beiträgen sind Übersichten von HERWIG (Gbll Waldeck 28, 1930, S. 118), BAUM (Gbll Waldeck 50, 1958, S. 154) und HOCHGREBE (Gbll Waldeck 76, 1988, S. 137) veröffentlicht worden. NEBELSIECK brachte ein Literaturver-zeichnis zur waldeckischen Kir- chengeschichte (Gbll Waldeck 38, 1938, S. 191). Bei Auswahl der Titel wurden die Grenzgebiete Westfalen, Hessen, Itter, Frankenberg und Fritzlar ebenso berücksichtigt wie die frühen geschichtlichen Beziehungen zu den Bistümern Köln, Mainz, Paderborn sowie der Landgrafschaft Hessen-Kassel. Es war mir wohl bewußt, daß es schwierig ist, hier die richtige Grenze zu finden. Es werden auch Titel von waldeckischen Autoren angezeigt, die keinen Bezug auf Waldeck haben. Die Vornamen der Autoren sind ausgeschrieben, soweit diese sicher feststellbar waren, was jedoch bei älteren Veröffentlichungen nicht immer möglich war. Berücksichtigung fanden Titel aus periodisch erscheinenden Organen, wichtige Artikel aus der Ta- gespresse und selbständige Veröffentlichungen in Buch- oder Broschürenform. Für die Bearbeitung der Lokalgeschichte sind hier zahlreiche Quellen aufgezeigt. Bei Überschneidung, bzw. wenn keine klare Scheidung möglich war, sind die Titel u. U. mehrfach, d. h. unter verschiedenen Sachgebieten aufgeführt. Anmerkungen in [ ] sind vom Bearbeiter einge- fügt worden. Verständlicherweise kann eine solche Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit er- heben, sie hätte aber auch außerhalb meiner Möglichkeiten gelegen, was besonders für das ältere Schrifttum zutrifft. -

Sommerturnier SV Hallstadt G-Jugend
Sommerturnier SV Hallstadt G-Jugend Presenter: SV Hallstadt Date: 07.07.2019 Event Location: Sportverein Hallstadt 1922 e. V., Am Sportplatz 26, 96103 Hallstadt Start: 10:00 Match Duration in Group Phase: 8 minutes Match Duration in Final Phase: 8 minutes Placement Mode: Points - Goal Difference - Amount of Goals - Head-to-Head Record Participants Group A Group B Live Results 1 SV Hallstadt 1 6 SV Hallstadt 2 2 1. FC Bischberg 7 SV Dörfleins 3 SpVgg Rattelsdorf 8 TSV Kleukheim 4 SpVgg Trunstadt 9 DJK Bamberg 5 SC Kemmern 10 SV Gundelsheim Preliminary Round No. C Start Gr Match Result Group A 1 1 10:00 A SV Hallstadt 1 SC Kemmern 0 : 0 Pl Participant G GD Pts 2 2 10:00 A 1. FC Bischberg SpVgg Rattelsdorf 6 : 0 1. 1. FC Bischberg 13 : 1 12 10 3 1 10:10 B SV Hallstadt 2 SV Gundelsheim 0 : 0 2. SC Kemmern 5 : 1 4 8 4 2 10:10 B SV Dörfleins TSV Kleukheim 0 : 2 3. SV Hallstadt 1 6 : 3 3 7 5 1 10:20 A SpVgg Trunstadt SV Hallstadt 1 0 : 4 4. SpVgg Trunstadt 1 : 10 -9 1 6 2 10:20 A SpVgg Rattelsdorf SC Kemmern 0 : 3 5. SpVgg Rattelsdorf 2 : 12 -10 1 7 1 10:30 B DJK Bamberg SV Hallstadt 2 0 : 1 8 2 10:30 B TSV Kleukheim SV Gundelsheim 2 : 0 Group B 9 1 10:40 A SpVgg Trunstadt 1. FC Bischberg 0 : 4 Pl Participant G GD Pts 10 2 10:40 A SpVgg Rattelsdorf SV Hallstadt 1 1 : 2 1. -

Aktuelle Ausgabe
JOBS IhreStellenanzeige auch online unter: jobs. wobla.net 41. Jahrgang/Nr. 40 DIE WOCHENZEITUNG FÜR DIE REGION BAMBERG 6. Oktober 2021 ➤ Smart-City-Projekt WOBLA-WETTER-WARTE Sozialplanung lädt 5-Tage-Trend Vorübergehend freundlich! zum Mitmachen ein Nach einem trüben Wochen- start bessert sich das Wetter Stadt Bamberg startet Befragung zur Unterstützung einer bald deutlich. Genau zum bürgernahen und zukunftsorientierten Sozialpolitik Wochenende dürfen wir uns auf ruhiges und meist sonni- Zu den Aufgaben der Stadt rung positiv genutzt werden ges Herbstwetter freuen. Bamberg zählt es, eine bürger- und allen Generationen mehr nahe und zukunftsorientierte Lebensqualität und Unterstüt- Besonders am Mittwoch und Sozialpolitik zu betreiben. zung bringen? Die so gewon- teilweise auch am Donners- nenen Einschätzungen sollen tag hängen noch zähe Wol- Jetzt für die Zukunft dann mit den Angeboten vor ken herum, aus denen sogar Ort abgeglichen und lokale noch etwas Regen fallen Für alle hier lebenden Gene- Maßnahmen in die Wege gelei- kann. rationen soll es gute Versor- tet werden. „Genau das ist es, gungsstrukturen geben. Hierzu was wir mit dem Programm Ab Freitag heitert es nach er sind die Erfahrungen der Bür- Smart City Bamberg erreichen t Auflösung örtlicher Frühne- a gerinnen und Bürger wichtig. möchten. Einen Gesamtnutzen he belfelder immer mehr auf. Deswegen startet die Stadt schaffen, der ganz Bamberg zu- T Die Höchstwerte liegen an- Bamberg im Rahmen von gutekommt und den Menschen ann fangs bei 12 °C bis 14 °C und „Smart City“ mit Unterstüt- in den Mittelpunkt stellt. Dabei am Wochenende bei 16 °C. offm zung der Universität Bamberg ist es uns ein wichtiges Anlie- H Nachts droht dann bei kla- A (Lehrstuhl für Statistik) eine gen, alle Bürgerinnen und Bür- T rem Himmel aber Boden- E Bürgerinnen- und Bürgerbe- ger einzubinden. -

Trees in Bamberg and Hallstadt in the Radiation Field of 65 Mobile Phone Base Stations
Trees in Bamberg and Hallstadt in the radiation field of 65 mobile phone base stations Examples from a documentation about 700 trees (2006-2016) A Tree Damages beginning on one side The trees of the Bamberg-Documentation are numbered from 1 to 700. Those trees which are part of the study „Radiofrequency radiation injures trees around mobile phone base stations“ (Science of the Total Environment 572 (2016) 554-569) have a second, red number. Tree names Tree species No No. Addresses Years of fel pa document. led ge Maple Acer platanoides 1 71 Railway station 2009-2013 3 Maple Acer platanoides 2 56 Hauptsmoorstr. 26a 2008-2012 4 Maple Acer platanoides 3 234 Berliner Ring 2013-2015 5 Maple Acer platanoides 4 150 Katzenberg 2010-2011 6 Maple Acer platanoides 5 304 P&R Heinrichsdamm 2008-2016 7 Maple Acer platanoides 12 658 Hallstadt, LichtenfelserStr. 2008-2015 9 Maple Acer platanoides 14 642 Hallstadt, Cemetery 2008-2016 11 Hornbeam Carpinus betulus 17 181 Hauptsmoorstr. 85 2011-2012 12 Lime tree Tilia sp. 28 673 Hotel Residenzschloss 2010-2015 13 Lime tree Tilia sp. 38 668 Hallstadt, Marktplatz 2009-2015 14 Chestnut Aesculus hippocast. 35 240 Franz-Ludwig-Straße 2008-2012 15 Locust tree Robinia pseudoacacia 36 290 Gutenbergstraße 2008-2015 16 Mountain ash Sorbus occuparia 38 158 Hezilostraße 2010-2016 X 17 Box elder maple Acer negundo 39 193 Kindergarten St. Heinrich 2012-2014 18 Walnut tree Juglans regia 41 675 Garden of St. Michael 2012-2015 19 Tree of life Thuja occidentalis 47 118 Cemetery Gaustadt 2009-2012 20 Tree of life Thuja occidentalis 48 309 Ottostraße 2011-2013 X 21 Douglas fir Pseudotsuga menziesii 56 24 B22/Strullendorfer Straße 2007-2014 22 Lime tree Tilia sp.