Auf Den Spuren Deutschsprachiger Künstler
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
CAPRI È...A Place of Dream. (Pdf 2,4
Posizione geografica Geographical position · Geografische Lage · Posición geográfica · Situation géographique Fra i paralleli 40°30’40” e 40°30’48”N. Fra i meridiani 14°11’54” e 14°16’19” Est di Greenwich Superficie Capri: ettari 400 Anacapri: ettari 636 Altezza massima è m. 589 Capri Giro dell’isola … 9 miglia Clima Clima temperato tipicamente mediterraneo con inverno mite e piovoso ed estate asciutta Between parallels Zwischen den Entre los paralelos Entre les paralleles 40°30’40” and 40°30’48” Breitenkreisen 40°30’40” 40°30’40”N 40°30’40” et 40°30’48” N N and meridians und 40°30’48” N Entre los meridianos Entre les méridiens 14°11’54” and 14°16’19” E Zwischen den 14°11’54” y 14°16’19” 14e11‘54” et 14e16’19“ Area Längenkreisen 14°11’54” Este de Greenwich Est de Greenwich Capri: 988 acres und 14°16’19” östl. von Superficie Surface Anacapri: 1572 acres Greenwich Capri: 400 hectáreas; Capri: 400 ha Maximum height Fläche Anacapri: 636 hectáreas Anacapri: 636 ha 1,920 feet Capri: 400 Hektar Altura máxima Hauter maximum Distances in sea miles Anacapri: 636 Hektar 589 m. m. 589 from: Naples 17; Sorrento Gesamtoberfläche Distancias en millas Distances en milles 7,7; Castellammare 13; 1036 Hektar Höchste marinas marins Amalfi 17,5; Salerno 25; Erhebung über den Nápoles 17; Sorrento 7,7; Naples 17; Sorrento 7,7; lschia 16; Positano 11 Meeresspiegel: 589 Castellammare 13; Castellammare 13; Amalfi Distance round the Entfernung der einzelnen Amalfi 17,5; Salerno 25; 17,5 Salerno 25; lschia A Place of Dream island Orte von Capri, in Ischia 16; Positano 11 16; Positano 11 9 miles Seemeilen ausgedrükt: Vuelta a la isla por mar Tour de l’ île par mer Climate Neapel 17, Sorrento 7,7; 9 millas 9 milles Typical moderate Castellammare 13; Amalfi Clima Climat Mediterranean climate 17,5; Salerno 25; lschia templado típicamente Climat tempéré with mild and rainy 16; Positano 11 mediterráneo con typiquement Regione Campania Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali winters and dry summers. -

Salvatore Dell'infanzia« Emil Von Behring Und Capri
ULRIKE ENKE: »SALVATORE DELL’INFANZIA« EMIL VON BEHRING UND CAPRI Über den Medizin-Nobelpreisträger Emil von Beh- umfangreichen Nachlass Emil von Behrings, der sich ring (1854–1917), den Entdecker des Diphtherie- seit dem Jahr 2000 als Depositum in der Emil-von- heilserums und »Retter der Kinder«, ist in der Möwe Behring-Bibliothek der Philipps-Universität Marburg schon des öfteren geschrieben worden, und in der befindet und seit 2009 in einem von der Deutschen Tat: Es ist seit langem bekannt, dass Behring zu den Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt aufge- prominentesten Gästen und zeitweiligen Einwoh- arbeitet wird. Die nun gesichteten historischen Do- nern Capris gehörte. Sehr ausführlich hat sich Edwin kumente – Briefe, Notizen, Fotografien – helfen, Cerio mit Behring und der sich gerade etablierenden einige der offenen Fragen und Widersprüchlichkei- Bakteriologie und Infektionslehre in seinem Buch ten aus dem Weg zu räumen und Behrings Bezie- Capri. Ein kleines Welttheater im Mittelmeer (München hung zur Sireneninsel im Golf von Neapel in einem 1954) beschäftigt, und auch seine zweite Ehefrau neuen und klareren Licht zu zeigen. Claretta widmet dem Immunologen und seiner Casa Rossa einige Seiten in ihrem schönen Büchlein Mein Bekanntlich wurde Emil Behring (er wurde 1901 in Capri (Hamburg 2010). Es war Edwin Cerio, der den erblichen Adelsstand erhoben) am 15. März anlässlich des fünfzigsten Jubiläums der Entdeckung 1854 im damals westpreußischen Hansdorf als fünf- des Diphtherieheilserums im Mattino (Neapel) über tes Kind eines Dorfschullehrers geboren. Er wuchs Behring als »Salvatore dell’Infanzia« geschrieben hat mit zwölf Geschwistern in ärmlichen Verhältnissen und es mit diesem Text in die gewichtige internatio- auf; der Besuch der Höheren Schule war nur dank nal angelegte Festschrift Die Welt dankt Behring (Ber- der Unterstützung von Stipendien und Freitischen, lin 1942, S. -

Schubert: the Nonsense Society Revisited
© Copyright, Princeton University Press. No part of this book may be distributed, posted, or reproduced in any form by digital or mechanical means without prior written permission of the publisher. Schubert: The Nonsense Society Revisited RITA STEBLIN Twenty years have now passed since I discovered materials belonging to the Unsinnsgesellschaft (Nonsense Society).1 This informal club, active in Vienna from April 1817 to December 1818, consisted mainly of young painters and poets with Schubert as one of its central members. In this essay I will review this discovery, my ensuing interpretations, and provide some new observations. In January 1994, at the start of a research project on Schubert ico- nography, I studied some illustrated documents at the Historisches Museum der Stadt Wien (now the Wienmuseum am Karlsplatz), titled “Unsinniaden.”2 The documents comprise forty-four watercolor pictures and thirty-seven pages of text recording two festive events celebrated by the Nonsense Society: the New Year’s Eve party at the end of 1817 and the group’s first birthday party on 18 April 1818.3 The pictures depict various club members, identified by their code names and dressed in fan- ciful costumes, as well as four group scenes for the first event, including Vivat es lebe Blasius Leks (Long live Blasius Leks; Figure 1), and two group scenes for the second event, including Feuergeister-Scene (Fire Spirit Scene; Figure 6 below).4 Because of the use of code names—and the misidentifi- cations written on the pictures by some previous owner of the -

11. Heine and Shakespeare
https://www.openbookpublishers.com © 2021 Roger Paulin This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0). This license allows you to share, copy, distribute and transmit the text; to adapt the text and to make commercial use of the text providing attribution is made to the authors (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Attribution should include the following information: Roger Paulin, From Goethe to Gundolf: Essays on German Literature and Culture. Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2021, https://doi.org/10.11647/OBP.0258 Copyright and permissions for the reuse of many of the images included in this publication differ from the above. Copyright and permissions information for images is provided separately in the List of Illustrations. In order to access detailed and updated information on the license, please visit, https://doi.org/10.11647/OBP.0258#copyright Further details about CC-BY licenses are available at, https://creativecommons.org/ licenses/by/4.0/ All external links were active at the time of publication unless otherwise stated and have been archived via the Internet Archive Wayback Machine at https://archive.org/web Updated digital material and resources associated with this volume are available at https://doi.org/10.11647/OBP.0258#resources Every effort has been made to identify and contact copyright holders and any omission or error will be corrected if notification is made to the publisher. ISBN Paperback: 9781800642126 ISBN Hardback: 9781800642133 ISBN Digital (PDF): 9781800642140 ISBN Digital ebook (epub): 9781800642157 ISBN Digital ebook (mobi): 9781800642164 ISBN Digital (XML): 9781800642171 DOI: 10.11647/OBP.0258 Cover photo and design by Andrew Corbett, CC-BY 4.0. -

Capri Ieri E Oggi 150 Anni Nel Mito
CAPRI IERI E OGGI 150 ANNI NEL MITO Lo stile "capri" ha sedotto artisti, intellettuali, dandy, star di Hollywood. Ha creato le mode. E fa ormai parte dell'immaginario collettivo DI MANUELA PIANCASTELLI In queste pagine: via Camerelle a distanza di circa un secolo. Ieri come oggi è la strada più "in" dello shopping caprese. Tra i negozi di culto che hanno qui le loro vetrine: la gioielle- ria di Pietro Capuano soprannominato Chantecler; i profumi isolani di Chartusia; i sandali fatti a mano di Gennaro Canfora. Nella foto d'epoca (1900 circa), l'insegna dello Zum Kater Hiditigeigei, per 40 anni famosissimo luogo d'incontro. apri è una risata geologica, un ritratto firmato da dio, mare che si squama a una bava di vento d'inverno. Una dietro l'altra 'e parole di Filippo Marinetti (il creatore del futurismo aveva casa a Capri), Edwin Cerio (nume tutelare dell'iso- la, che salvò dalle speculazioni edilizie degli anni 30), Michele Prisco (tra i massimi scrittori napoletani del Dopoguerra, autore di una guida su Capri) disegna- no l'immagine dell'isola che, in tempi e modi diversi, Capri irrompe in Europa, e poi nel mondo, nell'estate del contribuirono a lanciare nel firmamento dei luoghi più 1826 quando due pittori tedeschi, August Kopisch ed Ernst esclusivi del mondo. L'isola-simbolo della fascinosa bellez- Fries, entrano per la prima volta a nuoto nella Grotta Azzur- za italica, un mito clic dura senza soluzione di continuità da ra, accompagnati con una barchetta dal notaio Giuseppe 150 anni. E che nulla, neanche i motoscafi estivi rumorosi Pagano, tra i primi albergatori dell'isola. -

9. Gundolf's Romanticism
https://www.openbookpublishers.com © 2021 Roger Paulin This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0). This license allows you to share, copy, distribute and transmit the text; to adapt the text and to make commercial use of the text providing attribution is made to the authors (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Attribution should include the following information: Roger Paulin, From Goethe to Gundolf: Essays on German Literature and Culture. Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2021, https://doi.org/10.11647/OBP.0258 Copyright and permissions for the reuse of many of the images included in this publication differ from the above. Copyright and permissions information for images is provided separately in the List of Illustrations. In order to access detailed and updated information on the license, please visit, https://doi.org/10.11647/OBP.0258#copyright Further details about CC-BY licenses are available at, https://creativecommons.org/ licenses/by/4.0/ All external links were active at the time of publication unless otherwise stated and have been archived via the Internet Archive Wayback Machine at https://archive.org/web Updated digital material and resources associated with this volume are available at https://doi.org/10.11647/OBP.0258#resources Every effort has been made to identify and contact copyright holders and any omission or error will be corrected if notification is made to the publisher. ISBN Paperback: 9781800642126 ISBN Hardback: 9781800642133 ISBN Digital (PDF): 9781800642140 ISBN Digital ebook (epub): 9781800642157 ISBN Digital ebook (mobi): 9781800642164 ISBN Digital (XML): 9781800642171 DOI: 10.11647/OBP.0258 Cover photo and design by Andrew Corbett, CC-BY 4.0. -

1/2 Das Gerümpel Von Capri : Monika Manns Begegnung Mit U
1/2 Das Gerümpel von Capri : Monika Manns Begegnung mit U Autor(en): Andert, Karin Objekttyp: Article Zeitschrift: Schweizer Monat : die Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur Band (Jahr): 91 (2011) Heft 983 PDF erstellt am: 30.09.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-168708 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch literatur Monika Mann Angeregt durch das Buch «Monika Mann. Eine Biografie» meldete sich im Herbst letzten Jahres bei Karin Andert, der Autorin dieses Buches, einer der letzten Zeitzeugen, der Monika Mann noch persönlich gekannt hat. U., der anonym bleiben möchte, hatte die mittlere Tochter Thomas Manns im April 1986 auf Capri erstmals getroffen. -

Literary Clusters in Germany from Mid-18Th to Early-20Th Century
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Kuld, Lukas; O'Hagan, John Working Paper Location, migration and age: Literary clusters in Germany from mid-18th to early-20th Century TRiSS Working Paper Series, No. TRiSS-WPS-03-2019 Provided in Cooperation with: Trinity Research in Social Sciences (TRiSS), Trinity College Dublin, The University of Dublin Suggested Citation: Kuld, Lukas; O'Hagan, John (2019) : Location, migration and age: Literary clusters in Germany from mid-18th to early-20th Century, TRiSS Working Paper Series, No. TRiSS-WPS-03-2019, Trinity College Dublin, The University of Dublin, Trinity Research in Social Sciences (TRiSS), Dublin This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/226788 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence. -

Sie Waren Nicht Nach Ihren Wünschen
Thomas Manns Vater, der Lübecker Geschäftsmann Thomas Johann Heinrich Mann musste bereits im Alter von 28 Jahren den väterlichen Betrieb übernehmen und trug von da an die Verantwortung für die Geschicke der Familie. Er verfügte in seinem Testament die Liquidation seiner Firma, da seine Söhne Thomas und Heinrich Mann nicht nach seinem Wunsch waren. Im Roman lässt Thomas Mann seinen Vater in der Person des Konsuls Thomas Buddenbrook auftreten, dessen Sohn Hanno, der Autor nach seinem eigenen Vorbild schuf. Hier gestattet uns Thomas Mann einen Einblick in seine Kindheit und Jugend und in sein Verhältnis zu seinem Vater und seinem Bruder Heinrich. Allen Vätern im Roman „Buddenbrooks“ ist gemein, dass sie je einen Sohn hatten, der nicht nach ihrem Wunsch war. Thomas Manns eigene Söhne hätten durchaus nach seinem Wunsch sein können, denn alle waren hoch intelligent, musisch begabt und schriftstellerisch tätig. Doch Thomas Mann scheint seine Söhne eher als Bedrohung empfunden zu haben. Zitat Golo Mann: „ihm waren die Töchter natürlich lieber, die machten ihm keine Sorge. Denn von den Töchtern wusste er, sie können nicht werden wie er. Bei den Söhnen bestand die Sie waren nicht nach ihren Wünschen Gefahr.“ Tatsächlich liebte Thomas Mann von seinen sechs Kindern nur seine Tochter Elisabeth vorbehaltlos, während die anderen ihm fremd oder Thomas Mann als Vater und die Väter im Werk „Buddenbrooks“ gar verhasst waren. Anhand des Romans „Buddenbrooks“ aber auch durch Auszüge aus Briefen, Tagebüchern und Interviews mit den Kindern Thomas Manns soll Xenia Marita Riebe DER OBSIDIAN hier der Versuch unternommen werden, die Beziehungen zwischen Vätern und Söhnen sowohl im Roman als auch im wirklichen Leben darzustellen. -

Amalficoast Capri
ENGLISH VERSION ebook pdf Caprionline Capri Amalf Coast BUCKET LIST EXPERIENCES From the creators of Capri.com and Positano.com INDEX 100 BUCKET LIST EXPERIENCES . 3 The Tower of Ziro 74 3 The Island of Capri 3 Restaurants on the Amalf Coast 76 The Amalf Coast 5 Shopping on the Amalf Coast 78 Sorrento 8 Wineries on the Amalf Coast 80 Getting Around 10 Positano 82 Where to Stay 12 Around Positano 84 How Many Nights 13 Praiano 85 Where to Book a Hotel 14 Furore Fjord 86 The Best Time of Year to Visit 17 Conca dei Marini (the Emerald Grotto) 87 Ravello 89 THE ISLAND OF CAPRI . 18 Amalf 92 18 Where to Stay 19 Atrani 95 Getting to Capri 21 Minori, Maiori, and Tramonti 96 Getting Around Capri 22 Cetara, Erchie, and Vietri sul Mare 98 One-Day Itinerary on Capri 25 Sant’Agata and Nerano 100 Three-Day Itinerary on Capri 26 Rentals and Tours by Sea 103 The Blue Grotto 28 Beaches on the Amalf Coast 104 Boat Tours Around the Island 33 Beaches in Positano 106 Renting or Chartering a Boat 34 Beaches in Nerano and Atrani 107 Beaches on Capri 38 Beaches in Amalf and Cetara 108 The Pizzolungo Trail 41 Beaches in Maiori and Minori 109 The Charterhouse of San Giacomo 42 Beaches in Vietri sul Mare 109 The Gardens of Augustus - Via Krupp 43 The Punta Cannone Belvedere 43 SORRENTO . 110 Villa Jovis 44 Where to Stay 111 110 Astarita Park and Villa Lysis 45 Getting to Sorrento 112 Visiting Anacapri 46 Getting Around Sorrento 115 Axel Munthe’s Villa San Michele 48 A Day in Sorrento 116 Mount Solaro and Cetrella 50 Restaurants in Sorrento 118 The Migliara Scenic Overlook 53 Shopping in Sorrento 120 The Trail of the Forts 55 Beaches on the Sorrentine Peninsula 122 La Piazzetta 56 The Bay of Ieranto 124 Aperitivo Spots 57 Mount Faito 126 Restaurants on Capri 58 Punta Campanella 128 Shopping 61 DAY TRIPS FROM SORRENTO . -

Ca Protagonista, Che Sfacciata to Our Senses
IWC PILOT. #B_ORIGINAL. Join the conversation on #B_Original. Big Pilot’s Watch. Ref. 5009: ispirato ai questo orologio, come di chi lo indossa: una innata atti- primi orologi da aviatore e originale al tempo stesso – tudine ad essere originale. IWC. ENGINEERED FOR MEN. come i suoi celebri predecessori, anche il nuovo Big Pilot’s Watch eccelle per la sua tecnica di precisione e Movimento meccanico, Sistema di ricarica automatica il design funzionale. Difatti, il più grande calibro di Pellaton, Calibro di manifattura 51111, Autonomia di marcia di 7 giorni a carica completa, Indicazione della riserva di carica, manifattura realizzato da IWC accumula rapidamente Datario, Secondi centrali con dispositivo di arresto, Cassa un’autonomia di marcia di sette giorni. Con l’indice 36 interna in ferro dolce per la protezione dai campi magnetici, triangolare posizionato sotto la minuteria e gli indici dei Vetro zaffiro, antidecompressione, Incisione speciale sul • 5 minuti più sottili, il quadrante evoca il modello origi- fondello, Impermeabile 6 bar, Diametro 46 mm, Cinturino in nale del 1940. Non sorprende quindi la definizione di pelle di vitello di Santoni review CAPRI COPIA OMAGGIO • COMPLIMENTARY COPY • n. 36 1994 - 2016 Con il Patrocinio di: Comune di Anacapri âi`>ÊÕÌ>Ê `Ê ÕÀ>Ê-}}ÀÊiÊ/ÕÀÃ Periodico di turismo, cultura, attualità Anno XXIII - N. 3 6 - 2016 Registrazione al Tribunale di Roma n. 83/94 dell’11.3.94 Dentro l’isola 36 Azzurra 36 39 Io e le statue di Riccardo Esposito 44 50 sfumature di Capri di Simona Schettino 66 Lo spettacolo del -
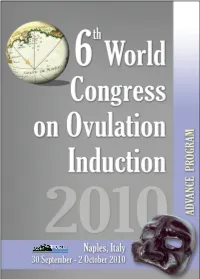
Programma Advance 6Th 2010
Ovulation Induction is a critical therapeutic procedure employed in the management www.ovulationinduction2010.org of infertility, both alone and in conjunction with assisted reproduction procedures. Since 1994 the World Congress on Ovulation Induction has become a key scientific event to update physicians and scientists on novel and ground-breaking approaches and techniques in this invaluable therapeutic area. The 6th edition of the World Congress on Ovulation Induction will take place in Naples, Italy from the 30th of September to the 2nd of October, 2010. This beautiful city, close to unique venues such as the islands of Capri and Ischia and the archaeological sites of Pompeii and Herculaneum will be a perfect backdrop for this high-level scientific event. The Congress will be held at a central and convenient facility located on the Mediterranean seashore with a breathtaking view of the bay of Naples, its islands, and Mount Vesuvius. We look forward to welcoming you in Naples in 2010. Prof. Marco Filicori Prof. Giuseppe De Placido Presidents of the Congress Professor Marco Filicori Chairman GynePro Medical Group, Bologna, Italy Professor Giuseppe De Placido Head Reproductive Medicine Unit Department of Obstetrics and Gynecology University of Naples “Federico II”, Naples, Italy International Scientific Committee Fleming R (UK) Hugues JN (FR) Macklon NS (UK) FACULTY Nardo L (UK) Pellicer A (ES) Ubaldi F (IT) Italian Scientific Committee Caserta D (IT) Chiantera A (IT) Cicinelli E (IT) Colacurci N (IT) Crosignani PG (IT) Dessole S (IT) Genazzani AR (IT) Locci M (IT) Moscarini M (IT) Nappi C (IT) Perino A (IT) Petraglia F (IT) Pivonello R (IT) Volpe A (IT) Zullo F (IT) Local Organizing Committee Clarizia R (IT) Mollo A (IT) Ranieri A (IT) E.C.M.