Internet- Examensreader Für Praktische Theologie
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Lutheran Pastor
THE LUTHERAN PASTOR BY G. H. GERBERDING, D. D., PROFESSOR OF PRACTICAL THEOLOGY IN THE THEOLOGICAL SEMINARY OF THE EVAN GELICAL LUTHERAN CHURCH, CHICAGO, ILL., AUTHOR OF N e w T e s t a m e n t “ ״ , T h e W a y o f S a l v a t io n i n t h e L u t h e r a n C h u r c h» . E t c ״ , C o n v e r s io n s SIXTH EDITION. PHILADELPHIA, PA.: LUTHERAN PUBLICATION SOCIETY. [Co p y r ig h t , 1902, b y G. H . G e r b e r d l n g .] DEDICATION, TO A HOLY MINISTRY, ORTHODOX AS CHEMNITZ, CALOVIUS, GERHARD, AND KRAUTH ; SPIRITUAL AND CONSECRATED AS ARNDT, SPENER, AND ZINZENDORF ; ACTIVE IN THE MASTER’S SERVICE AS FRANCKE, MUHLEN BERG, OBERLIN, AND PASSAVANT, THIS BOOK. IS HOPEFULLY DEDICATED. PREFACE TO SECOND EDITION. A SECOND edition of this work has been called for more speedily than we expected. For this we are grateful. It shows that there was a need for such a work, and that this need has been met. The book has been received with far greater favor, in all parts of our Church, than we had dared to hope. While there have been differences of opinion on certain points—which was to be expected— there have been no serious criticisms. This new edition is not a revision, but a reprint. In only two places has the text been corrected. On page 7 of the Introduction we have added a foot note, because the blunt statement of the text was liable to be misunderstood. -

Geistlichen Liederversen
Auswahl von geistlichen Liederversen zum Gebrauche bei der Molgenandacht in Schulen. Dftlm I«. 7. -V A'tfltk Arensburg 1862, Verlag von H, I. Jürgens, 2) aß in vorliegender zweiten Auflage der Auswahl von geistlichen Liederversen nichts wider die heilige Schrift und unsere Bekenntnißschriften enthalten sei, wird von dem Oesellschen Evangelisch-Lutherischen Consistorio desmittelst attestirt. Arensburg, am 11. Januar 1862. Im Namen und von wegen des Oesellschen Evangelisch-Lutherischen Consistorii. (L. 8.) Geistlicher Beisitzer (5. E. Hesse. SteUv. Secretair Ed. Baron Sass. 1. Schullieder. 1. Ihn schützen auf dem Throne, Ihn krönen mit der Krone Mel.: Wachet auf, ruft uns die Stimme. Des Friedens, der Gerechtigkeit. Gott, wie dank ich's deiner Treue, 4. Ja, Herr, wollst uns beglücken, Daß du an diesen Ort auf's Neue Dein Gottessiegel drücken Gesund und froh mich hast gebracht! Auf jede Herrscherthat: Vater, nimm mein Herz und Leben, Daß Freud' aus ihr die Fülle Ich will es dir auf's Neue geben, Und Heil und Segen quille Sonst ist nichts.was mich fröhlich macht. Zum Wohl, das keinen Wandel hat. O leite selbst mich an, Nach Claus Harms. Daß ich dich lieben kann Treu und innig, Wie du mich liebst. 3. ><**** In Jesu Christ Uns Allen Gnad' um Gnade giebst. Mel.: Wie schön leucht't uns der «. Bis hieher hat uns Gott gebracht! 2. Nun erwecke Herz und Sinnen, Ein'n neuen Lauf laß uns beginnen, Ihm sei von Herzen Dank gesagt Vergessen was da hinten liegt! Für seine Tren und Gnaden! Laß uns alles Böse fliehen! Was Tausenden nicht ist bescheert, Und segn' an uns der Lehrer Mühen. -

Kristendommens Historie ______
www.reitoft.dk 1 HISTORIE I FUGLEPERSPEKTIV Kristendommens historie ____________________________________________________________________ År År Ref PAL: Filip konge Noe -0004 0034 PAL: Herodes Antipas i Galiæa og Perea -0004 0039 PAL: Arkelaus.HerodesAntipas.Filip -0004 PAL: Jesus bliver født -0004 0030 PAL: Arkelaus. Judæa og Samaria -0004 0006 Herodes Filippus:Iturea,Trakonitis -0004 0034 13 Herodes Antipas: Galilea,Perea -0004 0039 13 Herodes Arkelaus: Samaria,Judea,Idumea -0004 0006 13 Kejserdyrkelsen * Priene i Lilleasien -0009 3,97 Jødisk filosof Filon fra Alexandria -0025 0040 3,72 "alegorisk fortolkning" -0025 0040 3,72 ROM: kejser Augustus -0031 0014 KEJSER AUGUSTUS -0031 0014 13 Kong Herodes den Store i Palæstina -0037 -0004 13 Hillel og Sjammaj (skriftkloge) * * * -0060 3,58 Israel indlemmes i Romerriget -0063 3,47 Hasmonæertiden -0076 -0067 3,63 Mitra-dyrkelsen -0100 3,82 * P L A T O N I S M E * -0100 3,89 Platonisme: Posidonius -0100 3,89 MESSIANSKE BEVÆGELSER * JOHS.DØBER * -0165 0070 3,68 Synagoger * * * "attenbønnen" -0200 3,56 "Hør,Israel.Herren vor Gud,Herren er en" -0200 3,57 Skriftkloge * Salme 1 -0200 3,58 "De sibyllinske Orakler" -0200 3,78 Ba'al * Astarte * SYRISK-LL-ASIATISK -0204 3,81 * E P I K U R Æ I S M E * Epikur -0300 3,93 Hellenisme - Stoisme * * * * * * * * * -0323 0400 4,24/31 Osiris * Isis * Serapis * ÆGYPTEN... -0333 0394 3,81 * DIOGENES SKOLE * diatriben -0400 -0325 3,92 Rabb.litt: Midrasj og Talmud (2 udgaver) -0450 -400? 3,59 Kyniker * Antisthenes * Diogenes -0455 -0360 3,92 Tempeltjenesten i Jerusalem * Byggeri -0500 0070 3,54 Josias reform -0622 3,54 Af tekniske grunde er tiden F.K. -

Bildausgabe, Stabile Bildgröße Durch Zeilengenaue Tabelle
Abt. 150.020 Nachlass von Henhöfer, Aloys D. h. c. Priester (1789 - 1862) Bearbeitet von Pfarrer Walter Schnaiter mit Vorwort und Register Laufzeit: 1815 – 2006 Umfang: ca. 0,5 lfde. Meter März 2010 Archiv der Evang. Landeskirche in Baden Inhaltsverzeichnis Vorwort II 1.0. Biografie 1 2.0. Kirchengeschichte 1 3.0. Korrespondenz 1 3.1. Korrespondenz und Biografie 9 3.2. Korrespondenz und Predigten 10 4.0. Predigten 11 Bibelstellenindex 16 Ortsindex 16 Personenindex 17 Sachindex 19 I Vorwort Vorwort Der Bestand des Nachlasses von Aloys Henhöfer Beobachtungen im Nachlass Die Dokumente von und über Aloys Henhöfer beziehen sich auf eine Laufzeit von 1815 bis 2006 und haben einen Umfang von ungefähr 0,5 lfde. Meter. Zu den Archivalien von Aloys Henhöfer gehören verschiedene Sammlungen von Dokumenten, welche soweit es nachvollzogen werden kann, als un- terschiedliche Einheiten in das Landeskirchliche Archiv gelangt sind. Herkunft des Nachlasses Auskunft über die Herkunft des Nachlasses gibt der Schriftverkehr mit dem Landeskirchlichen Archiv und Bibliothek.1 Über die Ablieferungen (Nr. 10) und (Nr. 16) durch Pfarrer Werner Hauser gibt es keine Aufzeichnungen. Dokument (Nr. 10/6) und Verzeichnungseinheiten (Nr. 11) und (Nr. 17) stam- men aus der Sammlung Urban, auf welche sich ein Brief von Dekan i. R. G. Urban an die Bibliothek des Evang. Oberkirchenrates aus Bretten vom 14. März 1968 bezieht. Die Korrespondenz in Verzeich- nungseinheit (Nr. 18) erwähnt eine „Sammlung Spöck“. Die Landeskirchliche Bibliothek Karlsruhe hat im Jahr 1983 Kopien von 23 Predigten, die meisten über die altkirchlichen Evangelien aus den Jahren 1819, 1835, 1836, 1838, 1839, 1842 und 1845 mit Ergänzungen aus späterer Zeit, vor allem 1857, und zwei weitere Texte aus dem Evang. -
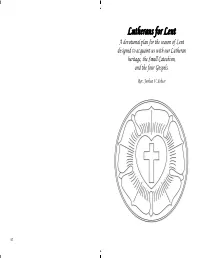
Lutherans for Lent a Devotional Plan for the Season of Lent Designed to Acquaint Us with Our Lutheran Heritage, the Small Catechism, and the Four Gospels
Lutherans for Lent A devotional plan for the season of Lent designed to acquaint us with our Lutheran heritage, the Small Catechism, and the four Gospels. Rev. Joshua V. Scheer 52 Other Notables (not exhaustive) The list of Lutherans included in this devotion are by no means the end of Lutherans for Lent Lutheranism’s contribution to history. There are many other Lutherans © 2010 by Rev. Joshua V. Scheer who could have been included in this devotion who may have actually been greater or had more influence than some that were included. Here is a list of other names (in no particular order): Nikolaus Decius J. T. Mueller August H. Francke Justus Jonas Kenneth Korby Reinhold Niebuhr This copy has been made available through a congregational license. Johann Walter Gustaf Wingren Helmut Thielecke Matthias Flacius J. A. O. Preus (II) Dietrich Bonheoffer Andres Quenstadt A.L. Barry J. Muhlhauser Timotheus Kirchner Gerhard Forde S. J. Stenerson Johann Olearius John H. C. Fritz F. A. Cramer If purchased under a congregational license, the purchasing congregation Nikolai Grundtvig Theodore Tappert F. Lochner may print copies as necessary for use in that congregation only. Paul Caspari August Crull J. A. Grabau Gisele Johnson Alfred Rehwinkel August Kavel H. A. Preus William Beck Adolf von Harnack J. A. O. Otteson J. P. Koehler Claus Harms U. V. Koren Theodore Graebner Johann Keil Adolf Hoenecke Edmund Schlink Hans Tausen Andreas Osiander Theodore Kliefoth Franz Delitzsch Albrecht Durer William Arndt Gottfried Thomasius August Pieper William Dallman Karl Ulmann Ludwig von Beethoven August Suelflow Ernst Cloeter W. -

Waldeckische Bibliographie“ Im Juni 1998 Gedruckt Wurde (Zu Hochgrebe S
WALDECKISCHE BIBLIOGRAPHIE Bearbeitet von HEINRICH HOCHGREBE 1998 Für die Präsentation im Internet eingerichtet von Dr. Jürgen Römer, 2010. Für die Benutzung ist unbedingt die Vorbemerkung zur Internetpräsentation auf S. 3 zu beachten! 1 EINLEITUNG: Eine Gesamtübersicht über das Schrifttum zu Waldeck und Pyrmont fehlt bisher. Über jährliche Übersichten der veröffentlichten Beiträge verfügen der Waldeckische Landeskalender und die hei- matkundliche Beilage zur WLZ, "Mein Waldeck". Zu den in den Geschichtsblättern für Waldeck u. Pyrmont veröffentlichten Beiträgen sind Übersichten von HERWIG (Gbll Waldeck 28, 1930, S. 118), BAUM (Gbll Waldeck 50, 1958, S. 154) und HOCHGREBE (Gbll Waldeck 76, 1988, S. 137) veröffentlicht worden. NEBELSIECK brachte ein Literaturver-zeichnis zur waldeckischen Kir- chengeschichte (Gbll Waldeck 38, 1938, S. 191). Bei Auswahl der Titel wurden die Grenzgebiete Westfalen, Hessen, Itter, Frankenberg und Fritzlar ebenso berücksichtigt wie die frühen geschichtlichen Beziehungen zu den Bistümern Köln, Mainz, Paderborn sowie der Landgrafschaft Hessen-Kassel. Es war mir wohl bewußt, daß es schwierig ist, hier die richtige Grenze zu finden. Es werden auch Titel von waldeckischen Autoren angezeigt, die keinen Bezug auf Waldeck haben. Die Vornamen der Autoren sind ausgeschrieben, soweit diese sicher feststellbar waren, was jedoch bei älteren Veröffentlichungen nicht immer möglich war. Berücksichtigung fanden Titel aus periodisch erscheinenden Organen, wichtige Artikel aus der Ta- gespresse und selbständige Veröffentlichungen in Buch- oder Broschürenform. Für die Bearbeitung der Lokalgeschichte sind hier zahlreiche Quellen aufgezeigt. Bei Überschneidung, bzw. wenn keine klare Scheidung möglich war, sind die Titel u. U. mehrfach, d. h. unter verschiedenen Sachgebieten aufgeführt. Anmerkungen in [ ] sind vom Bearbeiter einge- fügt worden. Verständlicherweise kann eine solche Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit er- heben, sie hätte aber auch außerhalb meiner Möglichkeiten gelegen, was besonders für das ältere Schrifttum zutrifft. -

Der Komponist Als Prediger: Die Deutsche Evangelisch-Lutherische Motette Als Zeugnis Von Verkündigung Und Auslegung Vom Reformationszeitalter Bis in Die Gegenwart
DER KOMPONIST ALS PREDIGER: DIE DEUTSCHE EVANGELISCH-LUTHERISCHE MOTETTE ALS ZEUGNIS VON VERKÜNDIGUNG UND AUSLEGUNG VOM REFORMATIONSZEITALTER BIS IN DIE GEGENWART Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades vorgelegt beim Fachbereich 2 Kommunikation/Ästhetik Fach Musik/Auditive Kommunikation Carl von Ossietzky Universität Oldenburg von Jan Henning Müller Salbeistraße 22 26129 Oldenburg Oldenburg (Oldb) Juli 2002 Tag der Einreichung: 31.Juli 2002 Tag der Disputation: 29.Januar 2003 Gutachter: Prof. Dr. Peter Schleuning, Prof. Dr. Wolfgang E. Müller Inhaltsverzeichnis 1 EINLEITUNG 4 1.1 Thematische Einführung und Abgrenzung 4 1.2 Zur Darstellung 5 1.3 Gattungsspezifische Annäherung in vier Schritten 7 1.3.1 „Gattung“ als Vorstellung, Begriff und Kategorie 7 1.3.2 Musikalische Gattungen 10 1.3.3 Die Motette als musikalische Gattung 13 1.3.4 Zur Spezifität der evangelisch -lutherischen Motette 17 1.4 Konsequenzen für die Analyse und Motettenkorpus 20 1.4.1 Zur Analyse 20 1.4.2 Motettenkorpus 24 2 VORAUSSETZUNGEN IM MITTELALTER UND IM HUMANISMUS 26 2.1 Rhetorik, Homiletik und Predigt 26 2.2 Zum vorreformatorischen Musikbegriff 31 2.3 Gattungsgeschichtlicher Abriss: die Motette bis etwa 1500 34 3 „SINGEN UND SAGEN“: DIE GENESE DER GATTUNG 41 3.1 Aussermusikalische Faktoren 41 3.1.1 Theologische Voraussetzungen 41 3.1.2 Zum Musikbegriff der Reformatoren (Luther, Walter, Melanchthon) 55 3.1.3 Erste deutschsprachige Predigtmotetten 67 3.2 Innermusikalische Faktoren 82 3.2.1 Beispielfundus 82 3.2.2 Textdisposition 84 3.2.3 Modale Affektenlehre 91 3.2.4 Klausellehre und Klauselhierarchie 94 3.2.5 Musikalische Deklamation 110 3.2.6 Musikalisch-rhetorische Figuren 117 3.2.7 Analyseschema 127 4 DIE EV.-LUTH. -

Pietismus Und Die Revolution 1848/49 Evangelikale in England Und in Baden
Nicholas M. Railton Pietismus und die Revolution 1848/49 Evangelikale in England und in Baden Der badische Pfarrer Jakob Theodor Plitt (1815–1886) Sonderveröffentlichungen des Vereins für Kirchengeschichte in der Evangelischen Landeskirche in Baden Herausgegeben vom Vorstand des Vereins für Kirchengeschichte in der Evangelischen Landeskirche in Baden Band 8 Heidelberg – Ubstadt-Weiher – Neustadt a.d.W. – Basel Nicholas M. Railton Pietismus und die Revolution 1848/49 Evangelikale in England und in Baden Der badische Pfarrer Jakob Theodor Plitt (1815–1886) (mit englischer Version von Vorwort und Einführung) Herausgegeben von Gerhard Schwinge verlag regionalkultur Dr. Nicholas M. Railton, University of Ulster, Northern Ireland, Faculty of Arts, Lecturer in German. 1981: MA Dundee University, 1986: Ph.D. Dundee University. – Railton arbeitete mehrere Jahre in Deutschland und hat sich auf neuere und neueste deutsche Kirchengeschich- te spezialisiert; sein besonderes Interesse gilt den Beziehungen zwischen Deutschland und Großbritannien und Irland. Herausgeberschaft, Lektorat und alle Beigaben: Dr. Gerhard Schwinge, Pfarrer a. D., Kirchenbibliotheks- direktor i. R. und Geschäftsführer des Vereins für Kirchen- geschichte 1989–1998 Umschlag: Jakob Theodor Plitt (Abb. 1) / Rastatter Aufstand 1849 (Abb. 28) / K. Mann, Th. Plitt: Der evangelische Bund, 1847 (Abb. 4) Herstellung: verlag regionalkultur (vr) Satz: Harald Funke (vr) Umschlaggestaltung: Jochen Baumgärtner (vr) Endkorrektur: Gerhard Schwinge, Durmersheim ISBN 978-3-89735-730-3 Bibliographische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar. Diese Publikation ist auf alterungsbeständigem und säurefreiem Papier (TCF nach ISO 9706) gedruckt entsprechend den Frankfurter Forderungen. © 2012. Alle Rechte vorbehalten verlag regionalkultur Heidelberg – Ubstadt-Weiher – Weil am Rhein – Basel Korrespondenzadresse: Bahnhofstr. -

Strassenlexikon.Pdf
Landes - hauptstadt Kiel Hans - G. Hilscher Kieler Straßenlexikon Stand: Januar 2021 Fortgeführt seit 2005 durch: Landeshauptstadt Kiel Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation Impressum : Herausgeberin : Landeshauptstadt Kiel Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation Postfach 1152, 24099 Kiel Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet 9. Auflage Inhaltsverzeichnis 2 Vorwort 4 Hinweise 5 Abkürzungen 7 Lexikon 8 Eingemeindungen :- Brunswik 213 Ellerbek 213 Elmschenhagen 213 Friedrichsort 213 Gaarden-Ost 213 Gaarden-Süd 214 Hassee 214 Hasseldieksdamm 214 Holtenau 213 Meimersdorf 214 Mettenhof 214 Moorsee 214 Neumühlen-Dietrichsdorf 214 Pries 213 Projensdorf 214 Rönne 215 Russee 215 Schilksee 213 Suchsdorf 215 Wik 215 Winterbek 214 Wellingdorf 215 Wellsee 215 Quellen 211 Anhang 216 V o r w o r t 3 Straßennamen können viel über die besondere Geschichte einer Stadt aussagen, aber nur wenige sprechen für sich. Wer weiß z.B. , daß der Jensendamm an einen frühere Stadtbaurat erinnert oder daß der Blocksberg nach einem dort ehemals ansässigen Gärtner Block benannt ist? In diesen Fällen erschließt sich der Hinter- grund erst durch Nachforschung. Vielfach spiegeln die Namen auch die jeweilige politische und gesellschaftli- che Situation ihrer Entstehung wider, so nutzten z.B. die Nationalsozialisten diese Form der Ehrung ihrer Vor- bilder. Nach 1945 wurden diese Namen dann wieder ersetzt. Straßenbenennungen der jüngsten Zeit weisen auf ein gewachsenes Bewußtsein für die Bedeutung der Frauen in der Geschichte hin. Bis jetzt sind viele Auflagen der Broschüre Kieler "Straßennamen - Herkunft und Bedeutung" erschienen, die der bereits in den Ruhestand getretene Mitarbeiter der Statistikstelle Kiel Hans-Christian Voß entwickelt und betreut hat. Diese Publikation erfreute sich stets lebhafter Nachfrage und wurde sogar gelegentlich in den Schulunterricht einbezogen. -

Concordia Theological Quarterly
Concordia Theological Quarterly Volume 75:3–4 July/October 2011 Table of Contents Walther and the Revival of Confessional Lutheranism Martin R. Noland ................................................................................ 195 Grabau Versus Walther: The Use of the Book of Concord in the American Lutheran Debate on Church and Ministry in the Nineteenth Century Benjamin T.G. Mayes ......................................................................... 217 C.F.W. Walther’s Use of Luther Cameron A. MacKenzie ..................................................................... 253 Mission through Witness, Mercy, Life Together in Walther and the First Fathers of Missouri Albert B. Collver ................................................................................. 275 Eduard Preuss and C.F.W. Walther Roland F. Ziegler ................................................................................ 289 Wilhelm Löhe: His Voice Still Heard in Walther’s Church John T. Pless ........................................................................................ 311 Walther, the Third Use of the Law, and Contemporary Issues David P. Scaer ..................................................................................... 329 The King James Version: The Beginning or the End? Cameron A. MacKenzie ..................................................................... 343 Theological Observer ...................................................................................... 367 Dean Wenthe: An Appreciation An Old Seminary, a New -

Christa Jungnickel Russell Mccormmach on the History
Archimedes 48 New Studies in the History and Philosophy of Science and Technology Christa Jungnickel Russell McCormmach The Second Physicist On the History of Theoretical Physics in Germany The Second Physicist Archimedes NEW STUDIES IN THE HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY VOLUME 48 EDITOR JED Z. BUCHWALD, Dreyfuss Professor of History, California Institute of Technology, Pasadena, USA. ASSOCIATE EDITORS FOR MATHEMATICS AND PHYSICAL SCIENCES JEREMY GRAY, The Faculty of Mathematics and Computing, The Open University, UK. TILMAN SAUER, Johannes Gutenberg University Mainz, Germany ASSOCIATE EDITORS FOR BIOLOGICAL SCIENCES SHARON KINGSLAND, Department of History of Science and Technology, Johns Hopkins University, Baltimore, USA. MANFRED LAUBICHLER, Arizona State University, USA ADVISORY BOARD FOR MATHEMATICS, PHYSICAL SCIENCES AND TECHNOLOGY HENK BOS, University of Utrecht, The Netherlands MORDECHAI FEINGOLD, California Institute of Technology, USA ALLAN D. FRANKLIN, University of Colorado at Boulder, USA KOSTAS GAVROGLU, National Technical University of Athens, Greece PAUL HOYNINGEN-HUENE, Leibniz University in Hannover, Germany TREVOR LEVERE, University of Toronto, Canada JESPER LU¨ TZEN, Copenhagen University, Denmark WILLIAM NEWMAN, Indiana University, Bloomington, USA LAWRENCE PRINCIPE, The Johns Hopkins University, USA JU¨ RGEN RENN, Max Planck Institute for the History of Science, Germany ALEX ROLAND, Duke University, USA ALAN SHAPIRO, University of Minnesota, USA NOEL SWERDLOW, California Institute of Technology, USA -

Church Unity, Luther Memory, and Ideas of the German Nation, 1817-1883
That All May be One? Church Unity, Luther Memory, and Ideas of the German Nation, 1817-1883 Item Type text; Electronic Dissertation Authors Landry, Stan Michael Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with permission of the author. Download date 23/09/2021 16:04:45 Link to Item http://hdl.handle.net/10150/193760 THAT ALL MAY BE ONE? CHURCH UNITY, LUTHER MEMORY, AND IDEAS OF THE GERMAN NATION, 1817-1883 by STAN MICHAEL LANDRY _____________________ A Dissertation Submitted to the Faculty of the DEPARTMENT OF HISTORY In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY In the Graduate College THE UNIVERSITY OF ARIZONA 2010 2 THE UNIVERSITY OF ARIZONA GRADUATE COLLEGE As members of the Dissertation Committee, we Certify that we have read the dissertation prepared by Stan Michael Landry entitled: "That All May be One? ChurCh Unity, Luther Memory, and Ideas of the German Nation, 1817-1883" and reCommend that it be aCCepted as fulfilling the dissertation requirement for the Degree of Doctor of Philosophy _________________________________________________________________________________ Date: 8 Feb. 2010 Susan A. Crane _________________________________________________________________________________ Date: 8 Feb. 2010 Susan Karant-Nunn _________________________________________________________________________________ Date: 8 Feb. 2010 Peter W. Foley Final approval and acceptance of this dissertation is contingent upon the candidate’s submission of the final Copies of the dissertation to the Graduate College. I hereby Certify that I have read this dissertation prepared under my direCtion and reCommend that it be aCCepted as fulfilling the dissertation requirement.