2011 ·Heft 2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Die Externsteine – Ähnliche Zuschreibungen in Der Öffent- Ein Denkmal Als Objekt Lichen Wahrnehmung Der Externsteine
„Kraftort“, „Kultplatz“, „Gestirnsheilig- tum“ – oftmals finden sich solche und Die Externsteine – ähnliche Zuschreibungen in der öffent- Ein Denkmal als Objekt lichen Wahrnehmung der Externsteine. wissenschaftlicher Forschung Vorstellungen von einem „vorchristli- und Projektionsfläche chen Kultort“ im Teutoburger Wald wur- den von Vertreterinnen und Vertretern völkischer Vorstellungen der völkischen Bewegung seit Beginn des 20. Jahrhunderts popularisiert und Fachtagung im sind bis heute wirkmächtig. Ein Ziel der Lippischen Landesmuseum Detmold Fachtagung ist es, die Ursprünge, Funk- 6. und 7. März 2015 tionen und Rezeption der völkischen Mythenbildung an den Externsteinen zu beleuchten. In einem zweiten Tagungsschwerpunkt stellen Wissenschaftlerinnen und Wis- Teilnahmegebühr 10,00 Euro, senschaftler verschiedener Fachdiszipli- ermäßigt 8,00 Euro nen den aktuellen Forschungsstand zur Geschichte der Externsteine-Anlagen Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um den Mythen gegenüber. Damit wird Anmeldung bis zum 20.2.2015 wird eines der bedeutendsten Denkmäler gebeten. Westfalens erstmals interdisziplinär ge- Kontakt: würdigt. Lippisches Landesmuseum Detmold Im Rahmen der Tagung zeigt das Lip- Ameide 4 32756 Detmold pische Landesmuseum Karen Russos [email protected] Film „Externsteine“ (2012) und lädt zur anschließenden Diskussion mit der Tel. 05231/9925-19 Londoner Regisseurin ein. Die Tagung wird veranstaltet von: Mit freundlicher Unterstützung durch: Lippisches Landesmuseum Detmold Stiftung Standortsicherung Kreis Lippe Schutzgemeinschaft -

Stadt Und Dorf Im L(Reis Lippe in Landesforschung, Landespflege
28 In F :l v2 E H E E Stadt und Dorf im l(reis Lippe E & in Landesforschung, ts Landespflege und Landesplanung z ts Vorträge auf der Jahrestagung 0Fr 6 der Geographischen Kommission N ts in Lemgo 19t0 ts E td aI LANDESKUNDLICHE BEITRAGE UND BERICHTE Herausgegeben von der Geographischen Kommission für Westfalen Schriftenreihe der Geographischen Kommission im Provinzialinstitut ftir Westfälische Landes- und Volksforschung Landschaf tsverband Westf alen-Lippe SPIEKER LANDESKUNDLICHE BEITRAGE UND BERICHTE Herausgegeben von der Geographischen Kommission für Westfalen durch Wi Ihe lm MüIl e r - WilI e und E Ii s a b e t h B e rt e ls m e i e r 28 Stadt und Dorf im Kreis Lippe in Landesforschung, Landespflege und Landesplanung Vorträge auf der Jahrestagung der Geographischen Kommission in Lemgo 19E0 l9t1 Im Selbstverlag der Geographischen Kommission für Westfalen, Münster Bezug durch den Selbstverlag Geographische Kommission, Robert-Koch- Str. 26, 4400 Münster (Westf.). Schrifileitung: Dr. Elisabeth Bertelsmeier Erscheint gleichzeitig als Sonderveröffentlichung des Lippischen Heimatbundes e.V. Anschriften: OSt.-Dir. Dr. Fr. Brand : Birkenkampstraße fB, 4920 Lemgo . Stellvertr. Stadtdirektor Dipl.-Ing. U. F a ß h a u e r : Stadtbauamt, 4g2O Lemgo . prof. Dr. H. F. Gorki : Abt. 16 - Geographie - der Universität, 4600 Dortmund 50 . Oberkonservator Dr. U. K o r n : * Westfälisches Amt für Denkmalpflege Landschaftsverband Westfalen-Lippe -, 4400 Münster prof. Dr. W. Müller-Wille em.: Vorsitzender der Geographischen Kommission für Westfalen, Landschaftsverband Westfalen-Lippe, 4400 Münster Druck: C. J. Fahle GmbH, 4400 Münster (Westf.), Neubrückenstraße B-ll INHALT Seite MüLLer-WiLLe, W.: Begrüßung und Eröffnung . 7 Fa$hauer, U.: Grußwort der Stadtverwaltung Lemgo I Gorkt,Ii. -

Cornelia Müller-Hisje Aus Der Kinderstube Und Wie Es Dazu Kam
Ausgabe Nr. 13 Cornelia Müller-Hisje Aus der Kinderstube und wie es dazu kam... des "Herrenmenschen" Ulrike von der Linden Dipl. Psychologin „Three Times Blue(s)“ Bettina von Uechtritz und Steinkirch www.reporter-lippe.de Anzeigen 2 Anzeigen Einigen geht es offenbar zu gut... Zugegebener Maßen war das Leben früher aufregender. Es war einmal ein Hirtenjunge. Jeden Tag aufs Gleiche brachte Früher, als man auch in Deutschland noch die Folgen eines er seine Schafe auf die saftigen Wiesen hinter dem Dorf. Krieges spüren konnte. Früher, als man noch jederzeit an Und jeden Tag langweilte er sich. „Wolf!“brüllte er einmal. einer Grippe sterben konnte. Früher, als das Fernsehen noch Dorfbewohner eilten ihm zu Hilfe. Doch sie fanden heraus, schwarz-weiß war und man auch im Winter zu Fuß zur Schule dass es ein falscher Alarm war und es keinen Wolf in der oder zur Arbeit gehen musste. Früher, als man sich darüber Nähe gab. Kurz danach überraschte der Wolf den Jungen freute, wenn es zum Geburtstag einen neuen Pullover gab, wirklich. Diesmal nahmen die Dorfbewohner die Rufe nicht der nicht bereits von 3 älteren Geschwistern getragen wurde. mehr ernst und der Wolf fraß die ganze Herde und auch den Hirtenjungen. (Diese Fabel stammt aus dem 6 Jh.v.Chr.) Und heute? Heute ist das Leben langweilig. Für viele Jungendliche liegt das größte existenzbedrohende Wollen wir alle so abstumpfen und verrohen, dass wir echte Problem darin, dass sie noch nicht das allerneuste Smartphone Hilferufe nicht mehr wahrnehmen? Ich will das nicht. Ich werde besitzen, um ein Selfie von sich und ihrem veganen Low- weiterhin einschreiten, wenn ich ein Verbrechen vermute. -
![Guide to the MS-196: “Meine Fahrten 1925-1938” Scrapbook [My Trips 1925-1938]](https://docslib.b-cdn.net/cover/6096/guide-to-the-ms-196-meine-fahrten-1925-1938-scrapbook-my-trips-1925-1938-296096.webp)
Guide to the MS-196: “Meine Fahrten 1925-1938” Scrapbook [My Trips 1925-1938]
________________________________________________________________________ Guide to the MS-196: “Meine Fahrten 1925-1938” Scrapbook [My Trips 1925-1938] Jesse Siegel ’16, Smith Project Intern July 2016 MS – 196: “Meine Fahrten” Scrapbook (Title page, 36 pages) Inclusive Dates: October 1925—April 1938 Bulk Dates: 1927, 1929-1932 Processed by: Jesse Siegel ’16, Smith Project Intern July 15, 2016 Provenance Purchased from Between the Covers Company, 2014. Biographical Note Possibly a group of three brothers—G. Leiber, V. Erich Leiber, and R. Leiber— participated in the German youth movement during the 1920s and 1930s. The probable maker of the photo album, Erich Leiber, was probably born before 1915 in north- western Germany, most likely in the federal state of North Rhine-Westphalia. His early experiences with the youth movement appear to have been in conjunction with school outings and Christian Union for Young Men (CVJM) in Austria. He also travelled to Sweden in 1928, but most of his travels are concentrated in northwestern Germany. Later in 1931 he became an active member in a conservative organization, possibly the Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg,1 participating in outings to nationalistic locations such as the Hermann Monument in the Teutoburg Forest and to the Naval Academy at Mürwik in Kiel. In 1933 Erich Leiber joined the SA and became a youth leader or liaison for a Hitler Youth unit while still maintaining a connection to a group called Team Yorck, a probable extension of prior youth movement associates. After 1935 Erich’s travels seem reduced to a small group of male friends, ending with an Easter trip along the Rhine River in 1938. -

Guides to German Records Microfilmed at Alexandria, Va
GUIDES TO GERMAN RECORDS MICROFILMED AT ALEXANDRIA, VA. No. 32. Records of the Reich Leader of the SS and Chief of the German Police (Part I) The National Archives National Archives and Records Service General Services Administration Washington: 1961 This finding aid has been prepared by the National Archives as part of its program of facilitating the use of records in its custody. The microfilm described in this guide may be consulted at the National Archives, where it is identified as RG 242, Microfilm Publication T175. To order microfilm, write to the Publications Sales Branch (NEPS), National Archives and Records Service (GSA), Washington, DC 20408. Some of the papers reproduced on the microfilm referred to in this and other guides of the same series may have been of private origin. The fact of their seizure is not believed to divest their original owners of any literary property rights in them. Anyone, therefore, who publishes them in whole or in part without permission of their authors may be held liable for infringement of such literary property rights. Library of Congress Catalog Card No. 58-9982 AMERICA! HISTORICAL ASSOCIATION COMMITTEE fOR THE STUDY OP WAR DOCUMENTS GUIDES TO GERMAN RECOBDS MICROFILMED AT ALEXAM)RIA, VA. No* 32» Records of the Reich Leader of the SS aad Chief of the German Police (HeiehsMhrer SS und Chef der Deutschen Polizei) 1) THE AMERICAN HISTORICAL ASSOCIATION (AHA) COMMITTEE FOR THE STUDY OF WAE DOCUMENTS GUIDES TO GERMAN RECORDS MICROFILMED AT ALEXANDRIA, VA* This is part of a series of Guides prepared -

The Weather in Germany in Spring 2021
Press Release The weather in Germany – Spring 2021 Coldest spring since 2013 – but average sunshine Offenbach, 31 May 2021 – Spring 2021 was much too cool. Thus, the series of excessively warm springs in Germany, which had started in 2013, came to an end. The cool north winds in April and the inflow of fresh maritime air in May, in particular, kept average temperatures low. Summery weather only made a brief appearance. Whereas the amount of precipitation was less than the long-term average, the sunshine duration was slightly higher than normal. This is the summary announced by the Deutscher Wetterdienst (DWD) after an initial analysis of the observations from its approximately 2,000 measuring stations. A mild March was followed by a very cool April and May At 7.2 degrees Celsius (°C), the average temperature in spring 2021 was 0.5 degrees lower than the international reference value 1961–1990. Compared to the current 1991–2020 reference period, the deviation was -1.7 degrees. The factors that determined the negative deviation were the coldest April for 40 years and the cool May. Before this, March had brought fluctuating temperatures. Germany only enjoyed a brief high summer intermezzo for Mother's Day on 9 May. During this time, Waghäusel-Kirrlach, to the south-west of Heidelberg, registered the first hot day of 2021 (> 30 °C) with a temperature of 31.3 °C, which was also the hottest spring temperature nationwide. The lowest temperature was recorded on 6 April at Messstetten on the Swabian Alb (-13.6 °C). Little precipitation in the north-east in contrast to plenty of precipitation in the south per square metre (l/m²): at around 175 l/m2, it was only 93 per cent of the long-term average. -
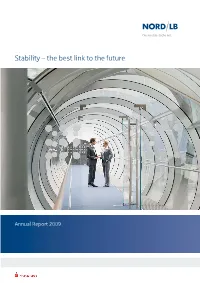
NORD/LB Group Annual Report 2009
Die norddeutsche Art. Stability – the best link to the future Annual Report 2009 NORD/LB Annual Report 2009 Erweiterter Konzernvorstand (extended Group Managing Board) left to right: Dr. Johannes-Jörg Riegler, Harry Rosenbaum, Dr. Jürgen Allerkamp, Dr. Gunter Dunkel, Christoph Schulz, Dr. Stephan-Andreas Kaulvers, Dr. Hinrich Holm, Eckhard Forst These are our figures 1 Jan.–31 Dec. 1 Jan.–31 Dec. Change 2009 2008 (in %) In € million Net interest income 1,366 1,462 – 7 Loan loss provisions – 1,042 – 266 > 100 Net commission income 177 180 – 2 ProÞ t/loss from Þ nancial instruments at fair value through proÞ t or loss including hedge accounting 589 – 308 > 100 Other operating proÞ t/loss 144 96 50 Administrative expenses 986 898 10 ProÞ t/loss from Þ nancial assets – 140 – 250 44 ProÞ t/loss from investments accounted – 200 6 > 100 for using the equity method Earnings before taxes – 92 22 > 100 Income taxes 49 – 129 > 100 Consolidated proÞ t – 141 151 > 100 Key Þ gures in % Cost-Income-Ratio (CIR) 47.5 62.5 Return on Equity (RoE) – 2.7 – 31 Dec. 31 Dec. Change 2009 2008 (in %) Balance Þ gures in € million Total assets 238,688 244,329 – 2 Customer deposits 61,306 61,998 – 1 Customer loans 112,083 112,172 – Equity 5,842 5,695 3 Regulatory key Þ gures (acc. to BIZ) Core capital in € million 8,051 7,235 11 Regulatory equity in € million 8,976 8,999 – Risk-weighted assets in € million 92,575 89,825 3 BIZ total capital ratio in % 9.7 10.0 BIZ core capital ratio in % 8.7 8.1 NORD/LB ratings (long-term / short-term / individual) Moody’s Aa2 / P-1 / C – Standard & Poor’s A– / A-2 / – Fitch Ratings A / F1 / C / D Our holdings Our subsidiaries and holding companies are an important element of our corporate strategy. -

Instrumentalising the Past: the Germanic Myth in National Socialist Context
RJHI 1 (1) 2014 Instrumentalising the Past: The Germanic Myth in National Socialist Context Irina-Maria Manea * Abstract : In the search for an explanatory model for the present or even more, for a fundament for national identity, many old traditions were rediscovered and reutilized according to contemporary desires. In the case of Germany, a forever politically fragmented space, justifying unity was all the more important, especially beginning with the 19 th century when it had a real chance to establish itself as a state. Then, beyond nationalism and romanticism, at the dawn of the Third Reich, the myth of a unified, powerful, pure people with a tradition dating since time immemorial became almost a rule in an ideology that attempted to go back to the past and select those elements which could have ensured a historical basis for the regime. In this study, we will attempt to focus on two important aspects of this type of instrumentalisation. The focus of the discussion is mainly Tacitus’ Germania, a work which has been forever invoked in all sorts of contexts as a means to discover the ancient Germans and create a link to the modern ones, but in the same time the main beliefs in the realm of history and archaeology are underlined, so as to catch a better glimpse of how the regime has been instrumentalising and overinterpreting highly controversial facts. Keywords : Tacitus, Germania, myth, National Socialism, Germany, Kossinna, cultural-historical archaeology, ideology, totalitarianism, falsifying history During the twentieth century, Tacitus’ famous work Germania was massively instrumentalised by the Nazi regime, in order to strengthen nationalism and help Germany gain an aura of eternal glory. -

Radflyer Geschichten Ansicht.Pdf
Radtour Waldrand steht eine Schutzhütte, gegenüber ein Bauernhof. Hier biegen wir rechts ab. Kurz danach kommen wir nach Hiddesen hinein und auf den Cheruskerweg, der später zum Germanenweg wird. An der Kreu- zung mit dem Hünenweg biegen wir links ab und erklimmen den Berg bis zum Maiweg, an dem wir rechts müssen. Hier geht es flach weiter, bis wir am Ende der Straße auf die Straße zum Hermannsdenkmal treffen. Nun müssen wir uns nach links wenden und wieder kräftig in die Pedale treten, um zum Denkmal zu gelangen. Oben angekommen, ist eine Pause in der Gastronomie sicher angebracht (wie das Hermanns- denkmal über den Parkplatz erreichbar). Danach wartet auf der Denkmalstraße Richtung Vogelpark und Heiligen- kirchen eine wunderschöne Abfahrt. Aber Achtung: Hier fahren auch Autos! An der Kreuzung Denkmalstraße/Paderborner Str. (mit Ampel) geht es rechts weiter auf dem Europaradweg R1 und der BahnRadRoute nach Berlebeck. 2. Wer den Aufstieg meiden möchte, fährt nach der Kreuzung Fried- rich-Ebert-Straße links in den Unteren Weg und folgt somit der weiteren Ausschilderung R1 und der BahnRadRoute. In Heiligenkirchen biegen Anfahrt: wir nach links auf die Denkmalstraße ab und an der folgenden großen Mit dem Auto: Über die Autobahnen A 2 Ruhrgebiet – Hannover (Aus- Ampelkreuzung rechts wie unter Punkt 1 beschrieben. fahrt Bielefeld Zentrum, B 66 Richtung Oerlinghausen/Detmold und über Geschichte und In Berlebeck geht es an der Einmündung Fromhauser Straße über die A 33 (Ausfahrt Paderborn Elsen, B 1 Richtung Detmold/Hameln) die Fußgängerampel weiter auf dem R1 und der BahnRadRoute zu kommt man einfach und bequem nach Detmold. Aus allen Richtungen Geschichten den Externsteinen. -

Leben Und Arbeiten in Lippe
wir in lippe leben und arbeiten in lippe www.forum-lippe.de 02 INHALTSANGABE VORWORT 03 WIRTSCHAFTSSTANDORT LIPPE 04 VERKEHRSVERBINDUNGEN 05 SCHÖNER WOHNEN IN LIPPE 06 KINDER, SCHULE, BILDUNG UND GESUNDHEIT 08 SPORT 10 FREIZEIT FÜR DIE GANZE FAMILIE 12 EINKAUFEN UND GASTRONOMIE 14 KULTUR 15 EVENTS IN DER REGION 16 FORUM LIP.PE – WER WIR SIND 17 FORUM LIP.PE – WAS WIR MACHEN 18 Impressum Gestaltung MEN AT WORK Werbeagentur GmbH Druck Merkur Druck GmbH & Co. KG Auflage 1.600 Exemplare Redaktion FORUM LIP.PE Wir bedanken uns für die zur Verfügung gestellten Abbildungen unter anderem bei Franz Paus (S. 2 Bild 3 v. l.), Frank Beyer (S. 8 Bild 3 v. l.) und Jan Braun/HNF (S. 15 Bild 1 v. l.). Das Copyright für diese Abbildungen liegt bei dem jeweiligen Eigentümer. berühmte lipper Gerhard Schröder | *7.4.1944 in Mossenberg (heute Ortsteil von Blomberg) | Okt. 1998 – Nov. 2005 deutscher Bundeskanzler VORWORT 03 Liebe Leserin, lieber Leser, wenn man das erste Mal vom Lipperland hört, dann stellt man sich die Frage, wie es wohl um die Vielfältigkeit und Lebensqualität der Region bestellt ist. Wir möchten Sie mit dieser Broschüre auf eine erste Erkundungstour durch Lippe schicken, bei der Sie das Land des Hermanns und den wunderschönen Teutoburger Wald entdecken können. Aber Lippe ist viel mehr als das! Es bietet Ihnen eine moderne Arbeitswelt in zukunftsweisenden und welt- weit agierenden Unternehmen. Das vielfältige kulturelle Angebot und die Nähe zur Natur machen die Freizeit zu einem Vergnügen. Für Ihre ersten Schritte in Lippe haben wir Ihnen zahlreiche Internet-Links zur Verfügung gestellt. -

2971 Amphora Spr08
® A publication of the American Philological Association Vol. 7 • Issue 1 • Spring 2008 From Sicily with Love: Book Review: Breaking The Myth of Galatea and Polyphemos in Ground. Pioneering Ian Fleming’s MOONRAKER Women Archaeologists by Ingrid Edlund-Berry by Patrick Callahan “After all you must have had some Breaking Ground. Pioneering Women education?” Archaeologists. Getzel M. Cohen and Bond laughed. “Mostly in Latin and Martha Sharp Joukowsky, Editors. The Uni- Greek. All about Caesar and Balbus and versity of Michigan Press, Ann Arbor so on.”-You Only Live Twice, 86. 2004. Pp. 582; 24 pp. of b&w photo- ith the release of the film graphs; 9 pp. of maps. Clothbound WCasino Royale in November of $80.00. ISBN 0-472-11372-0. 2006 and the upcoming release of Quantum of Solace in Novem- Fig. 1. Statue group from the Museum at ntecedent, adventuress, or archaeolo - ber of 2008 revitalizing the Bond film Sperlonga. © Marco Prins and Jona Lender- A gist? These were the labels used to industry, there has been an enthusiastic ing. From Livius.org with permission. characterize some of the pioneering return to Ian Fleming’s 007 novels and women in anthropology and archaeology short stories. As old readers return and education, his Greek is a bit rusty when young readers begin to discover the fun in On Her Majesty’s Secret Service (1963) in an exhibit at the library of the University in reading these works, they will find the Corsican Mafioso and Bond’s future of Pennsylvania Museum of Archaeology with unanticipated pleasure a depth of father-in-law, Marc-Ange, must explain and Anthropology in 2000. -
Geoparks in Deutschland Geoparks in Germany Deutschlands Erdgeschichte Erleben Experience Germany’S Geological History
Geoparks in Deutschland Geoparks in Germany Deutschlands Erdgeschichte erleben Experience Germany’s Geological History Kiel Nordisches Steinreich Schwerin Hamburg Eiszeitland am Oderrand Bremen Berlin TERRA.vita Hannover Potsdam Magdeburg Harz • Braunschweiger Cottbus Land • Ostfalen Leipzig Muskauer Ruhrgebiet Grenz Kyffhäuser Faltenbogen Welten Porphyr-(Łuk Mużakowa) Düsseldorf Inselsberg - Saale- Unstrut land Dresden Köln Drei Gleichen Erfurt Triasland Westerwald- Vulkanregion Lahn-Taunus Vogelsberg Schieferland Vulkanland Eifel Frankfurt Mainz Bayern-Böhmen Bergstraße- (Česko-Bavorský) Odenwald Saarbrücken Nürnberg Ries Stuttgart Schwäbische Alb München GEOPARKS IN DEUTSCHLAND INHALT CONTENT Geoparks in Deutschland Geoparks in Germany 3 Vom Norddeutschen Tief- Karte map 6 land bis zum Hochgebirge Geopark Bayern-Böhmen Geopark Bavaria-Bohemia 7 der Alpen, von der Mecklen- Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald burgischen Seenplatte über Geo-Nature Park Bergstraße-Odenwald 8 die bewaldeten Höhen der Geopark Eiszeitland am Oderrand Mittelgebirge bis zu den Geopark Ice Age Landscape on the Edge of the Oder River 9 Felsen der Schwäbischen Geopark GrenzWelten Geopark Border Worlds 10 Alb oder des Elbsandstein- Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen gebirges – Deutschlands Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen 11 Landschaften sind vielfältig. Geopark Thüringen Inselsberg – Drei Gleichen GeoPark Inselsberg – Three Equals 12 GeoPark Kyffhäuser GeoPark Kyffhäuser 13 Woher stammt diese Vielfalt der Landschaftsformen? Geopark Muskauer Faltenbogen / Łuk Mużakowa Deutschlands Geoparks versuchen darauf eine Antwort zu Geopark Muskau Arch / Łuk Mużakowa 14 geben: Waren es in Nord- und Ostdeutschland und im Alpen- GeoPark Nordisches Steinreich vorland die Gletscher der Eiszeit, die das Landschaftsbild GeoPark Nordisches Steinreich 15 formten, so beherrschen in der Eifel oder am Vogelsberg erlo- Geopark Porphyrland Geopark Porphyry Country 16 schene Vulkane aus dem Tertiär das Bild.