Jörg Bernhard Bilke
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Für Freiheit Und Demokratie
Bernd Eisenfeld/Rainer Eppelmann/ Karl Wilhelm Fricke/Peter Maser Für Freiheit und Demokratie 40 Jahre Widerstand in der SBZ/DDR Wissenschaftliche Dienste Archiv für Christlich-Demokratische Politik 2 Bernd Eisenfeld/Rainer Eppelmann/Karl Wilhelm Fricke/Peter Maser Für Freiheit und Demokratie 40 Jahre Widerstand in der SBZ/DDR 3 ISBN 3-931575-99-3 Herausgeber: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Wissenschaftliche Dienste 4 INHALT Vorwort ... 7 Karl Wilhelm Fricke: Widerstand und politische Verfolgung in der DDR ... 9 Peter Maser: Die Rolle der Kirchen für die Opposition ... 20 Bernd Eisenfeld: Stasi-Methoden in den achtziger Jahren bei der Bekämpfung widerständiger Erscheinungen ... 33 Rainer Eppelmann: Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur ... 44 5 6 Vorwort Seit 1991 veranstaltet das Archiv für Christlich-Demokratische Politik der Konrad-Adenauer- Stiftung jährlich eine Tagung zum Thema ”Widerstand und Verfolgung in der SBZ/DDR. Das achte ”Buchenwald-Gespräch” fand Ende Oktober 1998 in Berlin in Verbindung mit der Gedenkstätte Hohenschönhausen statt. Hohenschönhausen ist ein authentischer Ort der kommunistischen Willkürjustiz und politischen Strafverfolgung. Die Gebäude der ehemaligen Großküche wurden nach Kriegsende von der sowjetischen Besatzungsmacht als Internierungslager für NSDAP- Mitglieder und NS-Verdächtige genutzt. Nach Auflösung des ”Speziallagers Nr. 3” diente Hohenschönhausen als zentrales sowjetisches Untersuchungsgefängnis für politisch- ideologische Gegner. 1950 richtete dort das Ministerium für Staatssicherheit eine zentrale Untersuchungshaftanstalt für politische Häftlinge ein. Der Rundgang unter Führung ehemaliger Häftlinge ließ die bedrückende Atmosphäre, Isolation und seelische Zermürbung lebendig werden, der die Insassen ausgesetzt waren. Im Mittelpunkt der Vorträge stand die Verfolgung der Regimegegner durch die SED in den fünfziger, siebziger und achtziger Jahren. Eine Auswahl der Beiträge ist in dieser Broschüre abgedruckt. -

Nachlässe Von Germanistinnen Und Germanisten Aus Derddr
Erschienen in: Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes Jg. 64 (2017) H. 2, S. 171-180. Nachlässe von Germanistinnen und Germanisten aus der DDR: eine Beständeübersicht Simone Waidmann / Frederike Teweleit / Ruth Doersing Die nachfolgende Beständeübersicht ist als heuristisches Arbeitsinstrument zu verstehen, das keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Sie beruht auf Re cherchen in öffentlich zugänglichen Nachweisinstrumenten und Selbstauskünften bestandshaltender Institutionen. Neben Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftlern wurden in Auswahl auch germanistische Linguistinnen und Linguisten berücksichtigt. Auf nahme in die Übersicht fanden nur Bestände (Nachlässe und Vorlässe), die von den genannten Personen bzw. deren Erben gebildet wurden. Instituts- und Gremien unterlagen, Promotions- und Habilitationsakten, Personalakten von Arbeitgebern und andere durch Dritte gebildete Bestände, u. a. Stasiakten, bleiben unberück sichtigt. Die Heterogenität der Angaben ist auf die sehr unterschiedlichen Er schließungsstände in den jeweiligen Archiven zurückzuführen. Becker, Henrik (1902-1984) Universitäts rchiv Jena Nachlass(5,25 lfm, erschlossen, Findbuch) Inhalt:Lehrtätigkeit, hier Unterlagen über die Tätigkeit an der Volkshochschule und der ABF in Leipzig sowie am Germanistischen Institut und dem Institut für Sprachpflege und Wortforschung der FSU Jena. Mitarbeit in Arbeitsgemein schaften und Kommissionen, hauptsächlich Sprachlehrbücher des Sprachlehr- buchausschusses der Gewerkschaft der Lehrer und Erzieher -

The East German Writers Union and the Role of Literary Intellectuals In
Writing in Red: The East German Writers Union and the Role of Literary Intellectuals in the German Democratic Republic, 1971-90 Thomas William Goldstein A dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of History. Chapel Hill 2010 Approved by: Konrad H. Jarausch Christopher Browning Chad Bryant Karen Hagemann Lloyd Kramer ©2010 Thomas William Goldstein ALL RIGHTS RESERVED ii Abstract Thomas William Goldstein Writing in Red The East German Writers Union and the Role of Literary Intellectuals in the German Democratic Republic, 1971-90 (Under the direction of Konrad H. Jarausch) Since its creation in 1950 as a subsidiary of the Cultural League, the East German Writers Union embodied a fundamental tension, one that was never resolved during the course of its forty-year existence. The union served two masters – the state and its members – and as such, often found it difficult fulfilling the expectations of both. In this way, the union was an expression of a basic contradiction in the relationship between writers and the state: the ruling Socialist Unity Party (SED) demanded ideological compliance, yet these writers also claimed to be critical, engaged intellectuals. This dissertation examines how literary intellectuals and SED cultural officials contested and debated the differing and sometimes contradictory functions of the Writers Union and how each utilized it to shape relationships and identities within the literary community and beyond it. The union was a crucial site for constructing a group image for writers, both in terms of external characteristics (values and goals for participation in wider society) and internal characteristics (norms and acceptable behavioral patterns guiding interactions with other union members). -

Historischer Kalenderdienst“ 6/2020 (November – Dezember 2020 – Januar 2021)
Presseinformation Erinnerung als Auftrag: „Historischer Kalenderdienst“ 6/2020 (November – Dezember 2020 – Januar 2021) Die 96. Ausgabe des „Historischen Kalenderdienstes“ der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Dikta- tur weist auf Jahrestage ausgewählter historischer Ereignisse in den Monaten November/Dezember/Ja- nuar hin. Im Erinnerungsjahr 2020 setzt der Kalenderdienst einen Schwerpunkt auf die Ereignisse und Entwicklungen des Jahres der deutschen Einheit 1990 in Deutschland und Europa, die sich zum 30. Mal jähren. Auf der Homepage http://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de finden Sie weiterhin täglich ein histori- sches Datum in der Rubrik „heute vor …“ und weitere Ereignisse im historischen Kalendarium. Sollten Sie Fragen zu den angeführten Daten haben, stehen wir Ihnen mit Hintergrundinformationen gerne zur Ver- fügung. Die nächste Ausgabe des „Historischen Kalenderdienstes“ erscheint am 30. November 2020. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Tilman Günther | Fon: 030 31 98 95 225 | E-Mail: [email protected]. „Historischer Kalenderdienst“ 6/2020 November – Dezember 2020 – Januar 2021 Vor 75 Jahren 04.11.1945 Ungarn: Bei den freien Parlamentswahlen erreichen die Kommunisten, die auf einer getrennten Liste gegen die Sozialisten antreten, nur 16,9 Prozent der Stimmen. 06.11.1945 Der Thüringer Sozialdemokrat und Überlebende des KZ Buchenwalds, Hermann Brill, bis Juli 1945 unter amerikanischer Besatzung Regierungspräsident von Thüringen, warnt seine Partei vor der KPD. 20.12.1945 Die SMAD setzt den CDU-Vorsitzenden Andreas Hermes ab. Er hatte sich gegen die Übergriffe und Ungerechtigkeiten bei der Umsetzung der Bodenreform in der SBZ ausgesprochen. 10.01.1946 In London tritt zum ersten Mal die Generalversammlung der UNO zusammen. 11.01.1946 Ausrufung der Volksrepublik Albanien. -

Mémoires Du Goulag Déportés Politiques Européens En URSS
Mémoires du goulag Déportés politiques européens en URSS Sous la direction d'Anne-Marie Pailhès Présentation Cet ouvrage est le fruit d’une journée d’études « Mémoires du Goulag – Déportés politiques européens en URSS », organisée en novembre 2003 par le Centre de recherches sur le monde germanique de l’Université Paris X. Le projet de cette journée est né de ma rencontre avec Walter Ruge, un survivant communiste allemand du goulag né en 1915, dont le récit de vie, inédit en Allemagne, paraît en 2004 à Paris1. Depuis une quinzaine d’années, la perestroïka puis la fin de l’URSS ont permis l’ouverture d’archives qui éclairent un aspect fondamental de l’histoire européenne du XXe siècle : la persécution et la déportation d’exilés européens en URSS depuis les années 1930. Grâce à l’intervention d’historiens et de spécialistes de la littérature, français et étrangers, cette publication propose un bilan actuel sur les conflits de mémoire autour du goulag dans les pays européens. Les mémoires plurielles du goulag sont ici analysées à la lumière de nouveaux dépouillements d’archives comme de témoignages différés qui continuent d’être publiés dans de nombreux pays à l’heure actuelle. En France, cinquante ans après la mort de Staline, deux publications ont particulièrement attiré l’attention : d’une part la traduction de l’œuvre intégrale de Chalamov en français, d’autre part la parution du livre de photographies du Polonais Janusz Kizny. Mais si l’URSS puis la Russie continuent d’être, à juste titre, au cœur des débats et des bilans concernant le goulag, peu de recherches se sont intéressées aux ramifications nationales des conflits de mémoires autour de cette expérience. -

Deutsche Nationalbibliografie 2011 B 07
Deutsche Nationalbibliografie Reihe B Monografien und Periodika außerhalb des Verlagsbuchhandels Wöchentliches Verzeichnis Jahrgang: 2011 B 07 Stand: 16. Februar 2011 Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main) 2011 ISSN 1869-3954 urn:nbn:de:101-ReiheB07_2011-2 2 Hinweise Die Deutsche Nationalbibliografie erfasst eingesandte Pflichtexemplare in Deutschland veröffentlichter Medienwerke, aber auch im Ausland veröffentlichte deutschsprachige Medienwerke, Übersetzungen deutschsprachiger Medienwerke in andere Sprachen und fremdsprachige Medienwerke über Deutschland im Original. Grundlage für die Anzeige ist das Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek (DNBG) vom 22. Juni 2006 (BGBl. I, S. 1338). Monografien und Periodika (Zeitschriften, zeitschriftenartige Reihen und Loseblattausgaben) werden in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen (z.B. Papierausgabe, Mikroform, Diaserie, AV-Medium, elektronische Offline-Publikationen, Arbeitstransparentsammlung oder Tonträger) angezeigt. Alle verzeichneten Titel enthalten einen Link zur Anzeige im Portalkatalog der Deutschen Nationalbibliothek und alle vorhandenen URLs z.B. von Inhaltsverzeichnissen sind als Link hinterlegt. In Reihe B werden Medienwerke, die außerhalb des Ver- den, sofern sie eine eigene Sachgruppe haben, innerhalb lagsbuchhandels erscheinen, angezeigt. Außerhalb des der eigenen Sachgruppe aufgeführt, ansonsten unter der Verlagsbuchhandels erschienene Medienwerke die von Sachgruppe des Gesamtwerkes. Innerhalb der Sachgrup- gewerbsmäßigen Verlagen vertrieben werden, -

Die Ergebnisse Der Untersuchung
DIE ERGEBNISSE DER UNTERSUCHUNG Die vorliegende Untersuchung hat sich die Aufgabe gestellt, einen Beitrag zum Pro zeß des Wandels einer totalitär zu einer autoritär verfaßten Gesellschaft zu geben. Sie ist von der Absicht geleitet, empirisch erschlossenes Material einmal als solches auszu breiten, das heißt gesellschaftliche Strukturen und Prozesse realsoziologisch zu be schreiben. Zum anderen ist das empirische Material in einen Deutungszusammenhang gestellt worden, das heißt, es ist systematisch gegliedert, in korrelierbare Daten und Merkmale umgeformt und in ein Bezugssystem eingeordnet worden. über den bloßen Aufweis von Fakten soll diese Studie damit ebenso hinausgehen, wie beabsichtigt ist, in der Sowjet- und insbesondere in der DDR-Forschung bisweilen anzutreffende, empi risch nicht genügend abgesicherte Spekulationen zu vermeiden. Der damit beschrittene theoretische und methodische Weg ist als »kritisch-positiv« be zeichnet worden. Mit einer solchen Charakterisierung soll zum Ausdruck gebracht werden, daß es das Anliegen der vorliegenden Analyse eines autoritären Systems ist, über einen Teilbereich der Gesellschaft die realgesellschaftliche Wirklichkeit in ihrer Struktur und in ihren Tendenzen aufzuspüren und zu berücksichtigen. Darüber hinaus soll der Deutung dieser Wirklichkeit durch die in ihr selbst verwurzelten Denker Raum gegeben werden. Schließlich ist der Versuch unternommen worden, die Einzelanalysen in einen die marxistisch-leninistische Gesellschaftslehre berücksichtigenden Bezugsrah men einzuordnen. Vorstellung -

Leipziger Amtsblatt Nr. 07/2015
4. April 2015 Nummer 7 25. Jahrgang Siegfried Fairtrade Anker Dritter Teil von Wagnersers Leipzig möchte Stadtrat bewilligt „Ring des Nibelungen““ Hauptstadt des fairen weitere 1,9 Millionen Euro feiert Premiere Handels werden für Sanierung Seite 2 Seite 3 SeiteSeite 7 4 Leipzig bittet „Kopfkino“ zum Bürgerball Stadtgeschichte in 3D in Halle und Neue audiovisuelle Installation führt durch das restaurierte Stadtmodell Leipzig veranstaltet am 30. April aus Leipzig Anlass seines 1 000-jährigen Jubiläums Das Stadtmodell steht neu den „1. Leipziger Bürgerball – Ein Tau- an seinem angestammten Halle und Leipzig laden am send!“. Dazu laden die Veranstalter, der Platz: Seit dem 2. April 25. April zum alljährlichen Leipzig 2015 e. V. und die Saxonia-Cate- können Besucher des Stadt- nächtlichen Streifzug durch ring GmbH & Co. KG, ab 18 Uhr ins Neue geschichtlichen Museums ihre Museen ein. Unter Rathaus ein. Mit dem Bürgerball eröffnet wieder einen Blick auf dem Motto „Kopfkino“ die Stadt auch das längste Leipziger dieses einzigartige Zeug- beteiligen sich 86 Museen Bürgerfest. 19 Uhr wird OBM Burkhard nis der Stadtgeschichte Bild 203 und Sammlungen – das ist Jung die Ballgäste begrüßen und dann werfen. Erzählt wird diese neuer Rekord. Die Besucher soll ausgelassen getanzt werden. „The nach einer Verjüngungskur können ab 18 Uhr aus 321 Firebirds“, „The Butlers“, „The Hornets“ nun auch mit neuer Tech- Veranstaltungen wählen. und das Jugendsinfonieorchester spielen nik. Eine audiovisuelle Welche Erinnerungen und auf, dazu werden Tanzschulen Showein- Installation beleuchtet per Träume, Gedanken und lagen zeigen. Getränke und ausgewählte Knopfdruck mit 48-LED- Emotionen die Schätze Speisen sollen den Flanierball auch Spots markante Plätze und auslösen und ob es Orte gastronomisch zum Erlebnis werden Straßen und bietet dem mit geheimnisvoller Aura lassen. -
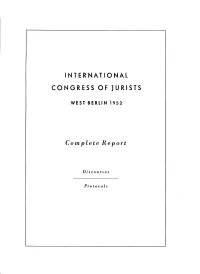
Complete Report
INTERNATIONAL CO N G RESS OF JURISTS WEST BERLIN 1952 Complete Report Discourses Pro tocols Printed by Rudolf Ofto, 63, Lutzowsfrcsse, Berlin W 35, Germony « The first greatINTERNATIONAL CONGRESS OF JURISTSfor the protection of Right against Systematic Injustice was recently held in West Berlin with the cooperation of Delegates from 43 countries, amongst whom were 31 Ministers and Statesmen, 32 Professors, 35 Presidents, Judges and Counsel in High Courts of Justice. The names of these Delegates warrant that the resolutions were passed by the Congress unprejudiced by political questions of the day and after scrupulous examination of the documentary material and the hearing of witnesses. The publication of this report is being done not for propaganda purposes, but with the object of spreading the truth in order to maintain and defend Law against an im minent danger not yet sufficiently understood by the Free World. Published by the International Commission- of Jurists 47, Buitenhof, The Hague, Netherlands Berlin■ Offices: 5, Lindenthaler Allee, Berlin-Zehlendorf-West, Germany i 1/0t f a k e tin likexhp to inform you that the Collection of Documents often referred to in this report as hearing the title “Injustice as a System” is in the original entitled “Injustice the Regime C ontents Page Page Part One: The Development of Public Law in Latvia, by M. C a k ste............................................................ 26 Preparation Legal Development in Estonia, , and Plenary Meetings of Congress by H. Mark ............................! ...................... ................ 27 FOURTH D A Y ................................................................... 30 IDEA AND PREPARATION ....................................... 1 Discussion and adoption of the Resolution of the Committee FIRST PLENARY MEETING...................................... -

Downloads Files/Hermann Flade.Pdf
Alfred Hausmann Lindenmahdstraße 6 86931 Stadtbergen/Leitershofen Tel. 0821/436675 eMail: [email protected] Aufsatzwettbewerb der Stadt Stadtbergen 2010 „Wiedervereinigung Deutschlands“ Thema: „Im Visier der Stasi“ Alfred Hausmann Todesurteil für Olbernhauer Schüler 2010 Gewidmet den Initiatoren und Teilnehmern der Freitag-Demonstrationen im Herbst 1989 in Olbernhau Am 25. August 2010 ging die folgende Meldung durch die deutsche Presse: Lothar de Maiziere (CDU), der letzte Ministerpräsident der DDR, hat gegenüber der Passauer Neuen Presse klar gestellt: „Ich lehne die Bezeichnung 'Unrechtsstaat' für die DDR ab.“ In diesem Sinn hatten sich vor ihm bereits Gesine Schwan, Erwin Sellering (beide SPD) und Luc Jochimsen (Die Linke) positioniert. Alle vier riefen mit ihren Äußerungen sowohl Protest als auch Beifall hervor. Das Thema „Sozialistischer Staat auf deutschem Boden“ löst auch zwanzig Jahre nach seinem Verschwinden Emotionen aus. Unrechtsstaat? Oder fortschrittlicher Staat mit Kinderkrankheiten? Der Blick auf Tausende von DDR-Schicksalen könnte diese Alternative einer Antwort nahe bringen. Eines von ihnen, das 1950/51 in unserer Partnerstadt Olbernhau seinen Lauf nahm, versuche ich nachzuzeichnen. 29. August 2010 4 von 13 Alfred Hausmann Am Morgen des 10. Januar 1951 stehen zahlreiche Bürger des 10.000 Einwohner zählenden Städtchens Olbernhau im sächsischen Erzgebirge auf dem Platz vor dem Ballhaus „Tivoli“. An der Fassade der Gaststätte ist ein Lautsprecher angebracht. Er überträgt das gesprochene Wort aus dem Saal für die in der Kälte Stehenden nach draußen. Im Inneren herrscht Enge: Betriebsbelegschaften und ausgesuchte SED- Genossen wurden herangeschafft, um eine Sitzung des Landgerichts Dresden mitzuerleben. Vor Gericht steht ein Gymnasiast, der 18-Jährige Hermann Joseph Flade aus Olbernhau. Das Ministerium für Staatssicherheit hat den Prozess in den Heimatort des Angeklagten verlegt. -

How the Germans Brought Their Communism to Yemen
Miriam M. Müller A Spectre is Haunting Arabia Political Science | Volume 26 This book is dedicated to my parents and grandparents. I wouldn’t be who I am without you. Miriam M. Müller (Joint PhD) received her doctorate jointly from the Free Uni- versity of Berlin, Germany, and the University of Victoria, Canada, in Political Science and International Relations. Specialized in the politics of the Middle East, she focuses on religious and political ideologies, international security, international development and foreign policy. Her current research is occupied with the role of religion, violence and identity in the manifestations of the »Isla- mic State«. Miriam M. Müller A Spectre is Haunting Arabia How the Germans Brought Their Communism to Yemen My thanks go to my supervisors Prof. Dr. Klaus Schroeder, Prof. Dr. Oliver Schmidtke, Prof. Dr. Uwe Puschner, and Prof. Dr. Peter Massing, as well as to my colleagues and friends at the Forschungsverbund SED-Staat, the Center for Global Studies at the University of Victoria, and the Political Science Depart- ment there. This dissertation project has been generously supported by the German Natio- nal Academic Foundation and the Center for Global Studies, Victoria, Canada. A Dissertation Submitted in (Partial) Fulfillment of the Requirements for the- Joint Doctoral Degree (Cotutelle) in the Faculty of Political and Social Sciences ofthe Free University of Berlin, Germany and the Department of Political Scien- ceof the University of Victoria, Canada in October 2014. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommer- cial-NoDerivs 4.0 (BY-NC-ND) which means that the text may be used for non- commercial purposes, provided credit is given to the author. -

Jews and the Monasteries of Germany
NEIGHBORS, PARTNERS, ENEMIES: JEWS AND THE MONASTERIES OF GERMANY IN THE HIGH MIDDLE AGES A Dissertation Submitted to the Graduate School of the University of Notre Dame in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy by John D. Young __________________________________ John Van Engen, Director Graduate Program in Medieval Studies Notre Dame, Indiana September 2011 © Copyright by John D. Young 2011 All rights reserved NEIGHBORS, PARTNERS, ENEMIES: JEWS AND THE MONASTERIES OF GERMANY IN THE HIGH MIDDLE AGES Abstract by John D. Young German-speaking lands in the twelfth and thirteenth centuries were home to the largest Jewish communities north of the Alps and Pyrenees and thus constituted key locations for Christian-Jewish interaction. This dissertation examines the monasteries of Germany—the primary centers of intellectual and cultural production in the high medieval Empire—as loci for that interaction. It explores both the social/economic and the cultural aspect of contact between monks and Jews. In the process, it challenges traditional interpretations of Christian-Jewish relations and helps to fill in the picture of the lives and activities of monks in this period. The study proceeds in three parts. Part one, comprising the first three chapters, examines the political context wherein Jews and monks interacted before investigating evidence of contact between Jews and monks in the social and economic spheres. This evidence demonstrates that Jewish communities and monasteries occupied similar John D. Young political positions in this society—due to their mutual reliance on the institution of privilege—and that they engaged frequently in business dealings with each other.