Internationales Bearbeitungsgebiet Hochrhein Bericht Zur
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Heimatmuseum Streuobstwiese Südbaden
Heimatmuseum Streuobstwiese Südbaden Natur genießen – Natur erhalten Streuobstbau ist ... Machen Sie mit! An dieser Stelle wollen wir Ihnen vor Ort einen ... eine Form des Obstbaus, bei welcher mit Für die Erhaltung der Streuobstwiesen kann je- Eindruck vermitteln von der Schönheit und Be- umweltverträglichen Bewirtscha ungsmetho- der einen Beitrag leisten. Der Einsatz lohnt sich deutung der Streuobstwiesen für unsere Natur den Obst auf hochstämmigen Baumformen er- auf jeden Fall – für die Natur und für Sie! und Landscha . Zahlreiche neu gep anzte und zeugt wird. Die Bäume stehen im Gegensatz zu Neue Bäume p anzen! schon seit vielen Jahren hier wachsende Apfel- niederstämmigen Plantagenobstanlagen häu g Wir zeigen Ihnen auf der nächsten Tafel welche und Birnensorten spiegeln eine Vielfalt, die es „verstreut“ in der Landscha . Sorten geeignet sind. zu erhalten gilt. Das „Heimatmuseum Streu- obst wiesen“ be ndet sich an drei verschiedenen Bäume durch P ege erhalten Stand orten: Obstbäume müssen vor allem anfangs ö ers ge- schnitten werden. B31 Bewusstes Einkaufen Färber © Alexander Lenzkirch Löngen Heimatmuseum Streuobstwiese Achten Sie beim Kauf von fri- Ewattingen B315 schem Obst oder von Obstpro- dukten, wie z.B. Sä en, auf Der NABU ist in Südbaden mit fast 5000 Mitgliedern einer der größten Umweltverbände in der Region. regionale Herkun und alte Er hat sich zum Ziel gesetzt, die großartigen Natur- Bonndorf B500 Sorten. Machen Sie einen schätze zwischen Rhein und Schwarzwald zu be- Südbaden wahren. Geschmackstest – es ist er- Der NABU möchte deshalb Menschen dafür begeistern, sich durch ge- staunlich, wie unterschied- meinschaftliches Handeln für die Natur einzusetzen. Informationen bei Heimatmuseum Streuobstwiese in Ortsrandlage. der Ortsgruppe NABU Südbaden, Habsburgerstr. -

Download (9MB)
Beiträge zur Hydrologie der Schweiz Nr. 39 Herausgegeben von der Schweizerischen Gesellschaft für Hydrologie und Limnologie (SGHL) und der Schweizerischen Hydrologischen Kommission (CHy) Daniel Viviroli und Rolf Weingartner Prozessbasierte Hochwasserabschätzung für mesoskalige Einzugsgebiete Grundlagen und Interpretationshilfe zum Verfahren PREVAH-regHQ | downloaded: 23.9.2021 Bern, Juni 2012 https://doi.org/10.48350/39262 source: Hintergrund Dieser Bericht fasst die Ergebnisse des Projektes „Ein prozessorientiertes Modellsystem zur Ermitt- lung seltener Hochwasserabflüsse für beliebige Einzugsgebiete der Schweiz – Grundlagenbereit- stellung für die Hochwasserabschätzung“ zusammen, welches im Auftrag des Bundesamtes für Um- welt (BAFU) am Geographischen Institut der Universität Bern (GIUB) ausgearbeitet wurde. Das Pro- jekt wurde auf Seiten des BAFU von Prof. Dr. Manfred Spreafico und Dr. Dominique Bérod begleitet. Für die Bereitstellung umfangreicher Messdaten danken wir dem BAFU, den zuständigen Ämtern der Kantone sowie dem Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz). Daten Die im Bericht beschriebenen Daten und Resultate können unter der folgenden Adresse bezogen werden: http://www.hydrologie.unibe.ch/projekte/PREVAHregHQ.html. Weitere Informationen erhält man bei [email protected]. Druck Publikation Digital AG Bezug des Bandes Hydrologische Kommission (CHy) der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (scnat) c/o Geographisches Institut der Universität Bern Hallerstrasse 12, 3012 Bern http://chy.scnatweb.ch Zitiervorschlag -
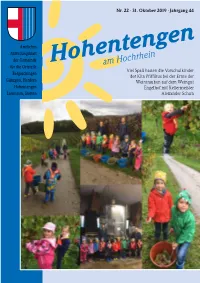
Am Hochrhein
Nr. 22 · 31. Oktober 2019 · Jahrgang 44 Amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinde Hohentengenam Hochrhein für die Ortsteile Viel Spaß hatten die Vorschulkinder Bergöschingen der Kita Pfiffikus bei der Ernte der Günzgen, Herdern Weintrauben auf dem Weingut Hohentengen Engelhof mit Kellermeister Lienheim, Stetten Alexander Schira Nr. 22 / 2019 Mitteilungsblatt Hohentengen am Hochrhein Seite 1 Gemeindeverwaltungsverband Küssaberg Drei Jahre nach dem unvergesslichen Abend mit Katja Riemann, Küssaberg und Hohentengen a. H. lädt das Casal Quartett aus Hohentengen erneut einen Gast in unser Dorf, der sonst auf den großen Bühnen der Welt zuhause ist. B E K A N N T M A C H U N G Fazil Say ist einer der faszinierendsten lebenden Pianisten. Am Dienstag, dem 19. November 2019, 18.00 Uhr Er ist ein Star der Sozialen Medien, zahllose Fans verfolgen ihn auf findet im Sitzungssaal des Rathauses Hohentengen eine öffentliche Verbandsversamm- Facebook, Twitter und Instragram. lung des Gemeindeverwaltungsverbandes statt. Am 08. November 2019 um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Die Bevölkerung ist hierzu freundlich eingeladen. Hohentengen Konzert mit dem Casal-Quartett und einem der Der Vorsitzende: weltbesten Pianisten Herrn Fazil Say gez. Benz Kartenvorverkauf direkt bei Edeka Wagner, Hauptstraße 14 in Hohentengen T A G E S O R D N U N G oder unter e-mail [email protected], Tel. 0 77 42 / 46 52 oder bei der Gemeindeverwaltung unter 07742 853-0 1. Wahl des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden des Gemeindeverwal- e-mail [email protected] tungsverbandes 2. Feststellung der Eröffnungsbilanz des Gemeindeverwaltungsverbandes zum 01. Ja- nuar 2019 Spielplatz in Bergöschingen 3. -

Die Burgen Und Schlösser Zwischen Wutachschlucht Und Hochrhein
Die Burgen und Schlösser zwischen Wutachschlucht und Hochrhein von Heinz Voellner Schriftenreihe „Heimat am Hochrhein" 1975 Herausgeber: Hochrhein-Geschichtsverein Waldshut Titelbild: Küssaburg aus einem Wandbild in den spätgotischen Räumen der neuen Prälatur im Kloster St. Georg, Stein am Rhein (1480-1516), Foto Konrad Sutter. Gesamtherstellung: H. Zimmermann KG, Druckerei und Verlag, Waldshut I Geschichtlicher Überblick Unsere so mannigfaltige Landschaft weist auch eine Vielzahl von Burgen und Schlössern auf, seien sie nun noch bewohnt, zu Ruinen zerfallen oder vom Erd- boden verschwunden und ihren ehemaligen Standort nur noch durch Urkunden, Flurnamen oder Spuren im Gelände verratend. Und jede sah anders aus, je nach ihrem Standort, ihrer Entstehungszeit, speziellen Aufgabe oder den finanziellen Mitteln ihrer Erbauer. Zu den noch bewohnten gehören die zwar nicht sehr großen, doch schönen Schlösser in Tiengen, Stühlingen, Gurtweil, Ofteringen, Bonndorf, Jestetten, Säckingen und Rötteln an der Rheinbrücke zum schweizerischen Städt- chen Kaiserstuhl, dazu auch Willmendingen bei Schwerzen, das äußerlich als ehe- maliges Schloß kaum noch zu erkennen ist. Mehr oder weniger umfangreiche Ruinen sind erhalten von der Küssaburg, Gutenburg, Weißenburg und Iburg, den Burgen Weißwasserstelz, Krenkingen, Boll, Hauenstein, Wieladingen, Mandach, Neukrenkingen, Roggenbach, Steinegg, Werrach und Bärenfels; von sehr vielen, über zwanzig sind es, kennen wir nur noch ihre Standorte - aber auch sie sind für den forschenden Wanderer und Geschichtsfreund oft von hohem und spannungs- geladenem Reiz. Insgesamt werden es im Kreis Waldshut über sechzig Burgen ge- wesen sein. Von wem und warum sind sie erbaut worden? Zur Beantwortung dieser Fragen ist es notwendig, zunächst ein wenig auf unsere Landschaft und ihre geschichtliche Ent- wicklung im Mittelalter einzugehen. -

Leitbild „Zukunft Naturraum Wutachschlucht“
Leitbild „Zukunft Naturraum Wutachschlucht“ Eine neue Balance zwischen Naturschutz und Nutzeransprüchen Präambel Eine neue Balance zwischen Natur - schutz und Nutzeransprüchen Das Leitbild für die „Zukunft Naturraum Wutach - schlucht“ entstand in zwei Zukunftswerkstätten, die im September 2013 und im Januar 2014 in Löffingen-Bach - heim durchgeführt wurden. Es berücksichtigt die Ergeb - nisse einer vorab durchgeführte Bürgerbefragung und unterlag einer einmaligen redaktionellen Bearbeitung durch eine Begleitkommission aus Vertretern der Land - kreise, Kommunen, Verbände und des Landes zwischen den beiden Werkstätten. Die hier vorliegende Fassung des Leitbilds mit den neun Visionen und Leitsätzen wurde am 17. Januar 2014 von den rund 70 Teilnehmenden der 2. Werkstatt zum Teil intensiv diskutiert und anschließend einvernehmlich verabschiedet. Das Leitbild hat das Ziel, eine neue Balance zwischen Naturschutz und Nutzer - ansprüchen in den Schutzgebieten zu verankern. 2 Uns verbindet mehr als uns trennt Die Einzigartigkeit des Naturraums Wutachschlucht zu schützen ist uns ein gemeinsames Anliegen. Wir sind fasziniert von der Vielfalt der Natur, der Flora und Fauna in den Naturschutzgebieten Wutachschlucht und Wutach - flühen sowie auf den Hochflächen und wollen sie weiter erhalten. Als Wildfluss ist die Wutach einmalig. Die Schlucht ist ein geologisches Bilderbuch, in der Erdgeschichte erkenn - bar wird. Der landschaftliche Wechsel von Schlucht und Hochebene macht die Vielfalt dieses Naturraums aus. Wir, die wir in diesem Naturraum leben und arbeiten, verbinden ein Heimatgefühl mit dieser Landschaft. Sie ist unsere Lebensgrundlage und wir identifizieren uns mit ihr. Die Naturschutzgebiete Wutachschlucht und Wutach - flühen bieten uns und unseren Gästen und Besuchern die Möglichkeit einzutauchen in eine „andere Welt“: wir schätzen die Stille, die Schönheit und die Naturerlebnisse, die sie uns schenken. -

Bevölkerung & Wirtschaft
2017 Statistik 2017 Statistik 2017 Statistik Herausgegeben vom Landratsamt Waldshut Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr Bevölkerung & Wirtschaft Bevölkerung und Wirtschaft im Landkreis Waldshut Statistik 2017 Herausgegeben vom Landratsamt Waldshut Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr Impressum Herausgeber Landratsamt Waldshut Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr Gartenstraße 7 79761 Waldshut-Tiengen Tel. 0 77 51 / 86 26 01 [email protected] Bearbeitung Alphatec Kommunikation, Wirtschaftsforschung, Technische Dokumentation Basler Straße 1 D-79639 Grenzach-Wyhlen Druck MBM Druck-Team GmbH Albtalstraße 24b D-79837 St. Blasien Bilder Titel, S. 15, 31, 59 Photo-Conrads Hauptstraße 25 D-79761 Waldshut-Tiengen Februar 2017 Vorwort Wir leben in aufregenden, ja vielleicht sogar aufgeregten Zeiten. Ganz gleich, ob Anschläge, Präsidentschaftswahlen, oder die Rosenkriege von mehr oder weniger bekannten Persönlichkeiten – alles scheint undifferenziert die gleichen heftigen Reaktionen auszulösen, die von der öffentlich zelebrierten Empörung über den Ruf nach sofortigen Gesetzesänderungen bis hin zum Shitstorm in den sozialen Medien reichen. Eine nüchterne Publikation wie die vorliegende Sta- tistik für den Landkreis Waldshut fällt vor diesem Hintergrund ein wenig aus dem Rahmen. Denn wenn diese 80 Seiten einen bescheidenen Beitrag zu aktuellen Diskussionen leisten können, dann sicher den der Versachlichung. Der Leser wird in den Statistiken keinen Weltuntergang finden, keinen Unter- gang des christlichen Abendlandes -

Förderverein Flyer
RESSEN KONTAKTAD 1. Vorsitzende Melanie Scheuble Prälatenweg 9, 79761 WT-Gurtweil Telefon 07741 | 835 30 46 [email protected] RDERVEREIN FÖ LE 2. Vorsitzende UTACH-SCHU Michaela Bielecki DER W Haben Sie an einer Mitgliedschaft im .V. Förderverein der Wutach-Schule Tiengen e.V. [email protected] TIENGEN E Interesse oder möchten Sie unsere Arbeit durch Spenden unterstützen? Kassiererin Dann senden Sie uns den umseitigen Abschnitt Roswitha Arnold bitte ausgefüllt und in einem Briefumschlag zu. [email protected] Wir sind für jede Unterstützung dankbar. Schriftführerin Der Mindestbeitrag beträgt 15. – s jährlich. Christine Wittig [email protected] ULE.DE WWW.WUTACH-SCH Beisitzerin Stefanie Reckermann [email protected] Beisitzerin Annette Dörflinger [email protected] . V . e Beisitzer n e g Alexander Lüttin n e 5 i n [email protected] r 1 T e e – g e d l n 3 e u n 1 i i h T . e - c r r Wutach-Schule t T S s e - W n v h r n Sonderpädagogisches Bildungs- und e c 1 t e e a 6 e t d d 7 Beratungszentrum für körperliche und r d u n 9 u ö W S 7 A F motorische Entwicklung Sudetenstr. 13 – 15, 79761 WT-Tiengen Telefon 07741 | 92 00-30 [email protected] EREIN DER EN... LÄRUNG ER FÖRDERV E.V. UNTERSTÜTZ ITRITTSERK D ULE TIENGEN WIR BE WUTACH-SCH die Wutach-Schule in der Name, Vorname wurde im Januar 1992 von Eltern aus der „Initiative Förderung ihrer Schülerinnen zur Errichtung einer Schule für Körperbehinderte und Schüler im Landkreis Waldshut“ und Mitarbeitern der Straße, Nr. -

Maßnahmenbericht Hochrhein
Maßnahmenbericht Hochrhein Die Position beträgt von links 2 cm und von oben 8,8 cm zum Hochwasserrisikomanagementplan Hochrhein Inhalt: Beschreibung und Bewertung der Hochwassergefahr und des Hochwasserrisikos Ziele des Hochwasserrisikomanagements Maßnahmen zur Erreichung der Ziele für die verantwortlichen Akteure Zielgruppen: Kommunen, Behörden, Öffentlichkeit FLUSSGEBIETSBEHÖRDE Regierungspräsidium Freiburg Referat 52 Gewässer und Boden 79083 Freiburg i. Br. www.rp-freiburg.de BEARBEITUNG Sönnichsen&Partner 32423 Minden www.soe-ing.de BILDNACHWEIS Deckblatt Regierungspräsidium Freiburg STAND 25.09.2014 Hochwasserrisikomanagementplanung in Baden-Württemberg Maßnahmenbericht Hochrhein Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 1 Einführung 7 2 Abgrenzung der relevanten Gewässer im Rahmen der vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos 10 3 Beschreibung der Hochwassergefahr und des Hochwasserrisikos 13 3.1 Hochwassergefahrenkarten 13 3.2 Hochwasserrisikokarten 16 3.3 Schlussfolgerungen aus den Gefahren- und Risikokarten 28 4 Ziele des Hochwasserrisikomanagements 51 4.1 Aufgabe und Vorgehen der Zielfestlegung 51 4.2 Ziele für die Vermeidung neuer Risiken 53 4.3 Ziele für die Verringerung bestehender Risiken 54 4.4 Ziele für die Verringerung nachteiliger Folgen während eines Hochwasserereignisses 55 4.5 Ziele für die Verringerung nachteiliger Folgen nach einem Hochwasserereignis 55 5 Maßnahmen und deren Rangfolge zur Erreichung der Ziele (Art. 7 Abs. 3 HWRM-RL, Anhang I.4) 57 5.1 Maßnahmen zur Erreichung der Ziele des Hochwasserrisikomanagements -

Landtag Von Baden-Württemberg Gesetzesbeschluss
Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15 / 4404 15. Wahlperiode Gesetzesbeschluss des Landtags Gesetz zur Neuordnung des Teil 2 Wasserrechts in Baden-Württemberg Bewirtschaftung von Gewässern Der Landtag hat am 27. November 2013 das folgende Abschnitt 1: Gemeinsame Bestimmungen Gesetz beschlossen: § 12 Grundsätze Artikel 1 § 13 Zuordnung der Gewässer zu Flussgebietseinhei- ten (zu § 7 Absatz 1 und 5 WHG) Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG) § 14 Benutzungen § 15 Alte Rechte und alte Befugnisse (zu § 20 WHG) INHALTSÜBERSICHT § 16 Verzicht auf Wasserbenutzungsrechte, -befugnisse und sonstige Vorhabenzulassungen Teil 1 § 17 Vorkehrungen bei Erlöschen von Wasserbenut- Allgemeine Bestimmungen, Gewässereinteilung, Eigentum zungsrechten, -befugnissen und sonstigen Vorha- benzulassungen § 1 Allgemeine Grundsätze § 18 Änderung von Wasserbenutzungsanlagen § 2 Gewässerbegriff, Anwendungsbereich (zu § 2 § 19 Rechtsverordnungen zur Gewässerbewirtschaf- WHG) tung (zu §§ 23 und 24 WHG) § 3 Einteilung der oberirdischen Gewässer § 4 Gebrauch und Einteilung der öffentlichen Ge- Abschnitt 2: Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer wässer § 5 Eigentumsverhältnisse am Bett der öffentlichen § 20 Gemeingebrauch (zu § 25 WHG) Gewässer § 21 Bestimmungen für Gemeingebrauch, Eigentümer - § 6 Öffentliches Eigentum am Bett der öffentlichen gebrauch und Anliegergebrauch sowie für das Gewässer Verhalten im Uferbereich (zu §§ 25 und 26 WHG) § 7 Uferlinie, Ufer § 22 Umtragen von Hindernissen § 8 Überflutung und Verlandung bei öffentlichen Ge- § 23 Mindestwasserführung, -

Petit Tour De Suisse Des Eaux Transfrontières
Petit tour de Suisse des eaux transfrontières On a coutume de dire que la Suisse est le château d'eau de l'Europe. En tout cas, chaque année, ce sont en moyenne quelque 52 milliards de mètres cubes d'eau qui sortent du périmètre national pour entrer dans un pays voisin. Mais il faut savoir aussi qu'un quart environ de ce volume provient de cours d'eau étrangers, tels l'Arve française ou les innombrables affluents allemands du bassin du Rhin avant sa sortie de Suisse. À regarder de près la frontière helvétique 1, on voit qu'un bon cinquième de son tracé se superpose à celui d'un cours d'eau, celui du Rhin en particulier, ou avec la ligne transversale de grands réservoirs transfrontières comme le Lac de Constance et le Léman (à quoi il faudrait ajouter un grand nombre de glaciers alpins dont la crête correspond souvent aux limites sud du pays, principalement entre le Valais et l'Italie). On trouvera ici un inventaire succinct des principaux cours d'eau suisses qui font partiellement office de frontière nationale, des points précis où certains d'entre eux pénètrent en Suisse et/ou en sortent, et de quelques-unes des particularités précisément liées au partage des eaux transfrontières. 2 En remontant le Rhin À tout seigneur tout honneur. Ce tour de Suisse commence par le Rhin, à Bâle, là où au rythme moyen de plus d'un million de litres par seconde sortent de Suisse les eaux provenant de plusieurs grands sous-bassins versants (Aar, Reuss, Limmat) qui recouvrent pas moins de 59 % du territoire national. -

The 1356 Basel Earthquake: an Interdisciplinary Revision
Research Collection Journal Article The 1356 Basel earthquake An interdisciplinary revision Author(s): Fäh, Donat; Gisler, Monika; Jaggi, Bernard; Kästli, Philipp; Lutz, Thomas; Masciadri, Virgilio; Matt, Christoph; Mayer-Rosa, Dieter; Rippmann, Dorothee; Schwarz-Zanetti, Gabriela; Tauber, Juerg; Wenk, Thomas Publication Date: 2009 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-b-000021256 Originally published in: Geophysical Journal International 178(1), http://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2009.04130.x Rights / License: In Copyright - Non-Commercial Use Permitted This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For more information please consult the Terms of use. ETH Library Geophys. J. Int. (2009) 178, 351–374 doi: 10.1111/j.1365-246X.2009.04130.x The 1356 Basel earthquake: an interdisciplinary revision Donat Fah,¨ 1 Monika Gisler,1 Bernard Jaggi,2 Philipp Kastli,¨ 1 Thomas Lutz,2 Virgilio Masciadri,3 Christoph Matt,4 Dieter Mayer-Rosa,5 Dorothee Rippmann,6 Gabriela Schwarz-Zanetti,1 Jurg¨ Tauber7 and Thomas Wenk8 1Swiss Seismological Service, ETH Zurich, CH-8092 Zurich, Switzerland. E-mail: [email protected] 2Basler Denkmalpflege, Unterer Rheinweg 26, CH-4058 Basel, Switzerland 3Klassisch-Philologisches Seminar, Universitat¨ Zurich, Ramistr.¨ 68, CH-8001 Zurich, Switzerland 4Archaologische¨ Bodenforschung des Kantons Basel-Stadt, Petersgraben 11, CH-4001 Basel, Switzerland 5Schwandenholzstrasse 260, 8046 Zurich, Switzerland 6Historisches Seminar, Universitat¨ Zurich, Karl Schmid-Strasse 4, CH-8006 Zurich, Switzerland 7Archaologie¨ und Museum Baselland, Amtshausgasse 7, CH-4410 Liestal, Switzerland 8Wenk Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik GmbH, Postfach 6063, CH-8023 Zurich, Switzerland Accepted 2009 January 26. Received 2009 January 26; in original form 2007 April 25 SUMMARY Within historical times one of the most damaging events in intra-plate Europe was the 1356 Basel earthquake. -
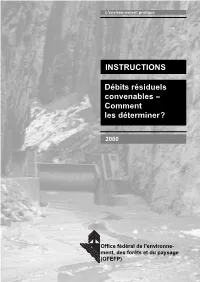
Débits Résiduels Convenables -- Comment Les Déterminer?
L'environnement pratique INSTRUCTIONS Débits résiduels convenables -- Comment les déterminer? 2000 Office fédéral de l'environne- ment, des forêts et du paysage (OFEFP) L'environnement pratique INSTRUCTIONS Débits résiduels convenables -- Comment les déterminer? 2000 Publié par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) Auteurs R. Estoppey, OFEFP, Berne Dr. B. Kiefer, Kiefer & Partners AG, Zurich M. Kummer, OFEFP, Berne S. Lagger, OFEFP, Berne H. Aschwanden, SHGN, Berne (chap. 7) Traduction B. Bressoud, Ardon Commande Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage Documentation 3003 Berne Fax + 41 (0)31 324 02 16 E-mail: [email protected] Internet: http://www.admin.ch/buwal/publikat/f/ Numéro de commande VU-2701-F © OFEFP 2000 Table des matières 3 TABLE DES MATIÈRES $9$17352326 ,1752'8&7,21 1.1 GÉNÉRALITÉS..................................................................................................................................7 1.2 OBJECTIF ET PRINCIPES DE LA FIXATION DE DÉBITS RÉSIDUELS CONVENABLES ......8 1.3 BASES LÉGALES..............................................................................................................................8 1.4 LE SYSTÈME DES DISPOSITIONS DE LA LEAUX SUR LES DÉBITS RÉSIDUELS................10 /¶$8725,6$7,21'(35e/Ê9(0(17'¶($8 2.1 PRÉLÈVEMENTS D’EAU SOUMIS À AUTORISATION ............................................................13 2.2 CONDITIONS POUR L’OCTROI DE L’AUTORISATION ...........................................................19