Die Geschichte Der Deutschen See- Und Marineflieger Von Dipl.-Ing
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Jet News 2/2003
Inhalt Jet News 2 / 2003 Inhalt Vorwort des Redakteurs ...............................................................2 Gefahr im Tornado ......................................................................5 Schäbigkeit kennt keine Grenzen ...................................................6 Nellis Flugunfall - Das Urteil ..........................................................7 Standpunkte des 1. Bundesvorsitzenden .........................................8 „...wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen…“ .................................9 Bye Bye MFG2 ..........................................................................10 Es hat sich einiges getan in der IGTH ............................................21 Beweisverwertungsverbot bei Flugunfällen .....................................22 Eurofighter - jetzt ist es offiziell ...................................................24 BMVg Referat ES und der §20a Soldatenversorgungsgesetz ..............26 JetPilotJobs ..............................................................................33 Vorbereitungsseminare für ausscheidende BO41 .............................34 VBSK Berufsunfähigkeitsversicherung ...........................................36 Wo ein Wille … da ein Weg ..........................................................38 Polen erhält alle MiG29 von Deutschland .......................................47 Hätte ich das doch früher gewusst!!! ............................................48 Oft sind es nur „Kleinigkeiten“ .....................................................51 -

Piloot & Vliegtuig
DUTCH AVIATION SUPPORT / Dutch Aviation MEDIA Chamber of Commerce: 08106154 P & V-AFM-Aranysas-Cockpit-TopguN-Interception-Aeronautica&Difesa-ATM-Fuerza-Aerea-LK-AFM-Ptisi-Letalo LUCKY SPOTTERS ON 100 YEARS GERMAN NAVY Lucky spotters on Nordholz Airday Hundred years of German naval aviation was remembered by with an Airday for the public at 18-08-2013 on the location of Nordholz-Spieka. In short, Vice Admiral / Naval Inspector Mr. Axel Schimpf stated: 'As the eyes, ears and tools of the seafaring units the 'Marineflieger' were an indispendable part of the flrrt, that was yesterday and that it is today'.Being one of several subjects in European aviation history marked by hundred years of existence the German Airday was unlike others not honoured with bright sunny weather but with continuous showering instead, and what a pity that fact was for the thousands of spectators and aviation enthousiasts! As a prelude to the Airday the Marineflieger organized at 17-08-2013 a spottersday for selected public and press, and for those lucky ones the sun appeared during the day every now and then and so enabling some good moments of photographic circumstances. Moving and shuffling The event was highlighted with two special painted Marineflieger Sea King and Lynx helicopters forming a pair with the same design of art. Also an Orion maritime patrol aircraft was painted with a blue band and 100 Jahre Marineflieger. This high profile presence for public spectators reveals it is important for the Marineflieger establishment to get attention of public and taxpayer. Hundred years of German naval aviation also indicates very much where to go in the coming years. -

Airbus Group Opens “Wings Campus” in Toulouse
Airbus Group Opens “Wings Campus” in Toulouse New office facilities provide modern and dynamic work spaces, driving creativity, integration and collaboration between teams and functions Concludes the integration of the former Paris and Munich Headquarter sites Honours European Aviation Pioneers Toulouse, 28 June 2016 – Airbus Group SE (stock exchange symbol: AIR) has today inaugurated its new headquarters facilities, called “Wings Campus”, adjacent to the airport in Toulouse-Blagnac, France. Housing 1,500 employees, the new campus is located at the heart of Airbus’s production and engineering activities and comprises the Group headquarters as well as integrated services buildings. From ground-breaking to the start of operations, construction works were completed within 25 months; the new facilities at the “Wings Campus” include a variety of modern features designed to enhance the working environment and work-life-balance such as collaborative office space, a 5,000 square meters canteen, a fitness centre, outdoor sports facilities, a Starbucks café and an outdoor WiFi connection. The energy-efficient buildings are heated and cooled using geothermal energy. “The Wings Campus, with all its new elements, stands for our commitment to innovation, internationalisation and sustainable growth,” said Tom Enders, Chief Executive Officer of Airbus Group, at the inauguration ceremony. “We strive to be a responsible, open-minded, innovative and future-oriented industry player – and want our employees to embrace this spirit. For that, we also must provide a state-of-the-art working environment. These new facilities are testament to this global commitment and I would like to express my sincere thanks to all who have contributed to this effort over the past two years. -

Die Bundeswehr Am Standort Cuxhaven/Nordholz
Rubriktitel Die Bundeswehr am Standort Cuxhaven/Nordholz Bundeswehrstandort | 1 Make your mission a success. Pollution control with the Dornier 228 NG. Please visit us at LIMA’13, 26 to 30 March 2013, Langkawi, Malaysia, Chalet CC06 View video RUAG Aerospace Services GmbH | RUAG Aviation P.O. Box 1253 | Special Airfield Oberpfaffenhofen | 82231 Wessling | Germany Phone +49 8153 30-2162 | [email protected] www.dornier228.com RZ Ins_Do 228NG_Pollution_205x195.indd 1 12.09.14 08:52 Grußwort des Standortältesten Herzlich Willkommen bei den Marinefliegern, als Standortältester Cuxhaven/Nordholz und Kommandeur des Marinefliegerkommandos heiße ich Sie herzlich willkommen. Mit dem Flugplatz Nordholz, der sich heute die „Heimat der Deut- schen Marineflieger“ nennen darf, ist nicht nur die über 100-jährige Geschichte der Marineflieger in Deutschland eng verbunden, son- dern auch eine über Jahre gewachsene gute Nachbarschaft zu den umliegenden Gemeinden im Landkreis Cuxhaven. Der Marinefliegerstützpunkt Nordholz, der alle fliegenden Waffen- systeme der Marine sowie den Kommandostab über das Marine- fliegergeschwader 5 und das Marinefliegergeschwader 3 „Graf Zeppelin“ beheimatet, ist zugleich einer der größten Arbeitgeber der Region. Viele unserer über 2000 Soldatinnen, Soldaten, sowie zivilen Mitar- beiterinnen Mitarbeiter stammen aus der Region oder haben diese zu ihrem neuen Lebensmittelpunkt gemacht. Nicht ohne Stolz können wir Marineflieger in Nordholz behaup- Wir Marineflieger fühlen uns mit der Region fest verbunden und ten, auf nur einem Flugplatz 4 Luftfahrzeugmuster gleichzeitig zu erfahren diese Verbundenheit auch im täglichen Umgang mit den betreiben, die allesamt seit vielen Jahren fast durchgehend in Aus- Menschen hier im Elbe-Weser Dreieck. landseinsätzen der Bundeswehr oder im Rahmen hoheitlicher Auf- gabenwahrnehmung wie den Such- und Rettungsdienst und die Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und nach alter Ölüberwachung über Nord- und Ostsee ihren Dienst versehen. -

Scope on German Naval Air Force
DUTCH AVIATION SUPPORT Chamber of Commerce: 08106154 Piloot en Vliegtuig – Aranysas – Cockpit – TopguN – AFM – Aeronautica&Difesa - AirFan Scope on German Naval Air Force (Nordholz) Scope on German Naval Air Force (Nordholz) The naval units with flying aircraft saw some reorganisation in the last years. Not only was there a major change with the disbandment of MFG-1 & 2 and giving up the role of anti-ship warfare by fast jets but also the anti submarine warfare task was boosted by acquiring modernised P-3C Orion’s. Today operational activities are concentrated in MFG-3 & MFG-5. While Marinefliegergeschwader 5 (MFG-5) is located at Kiel- Holtenau flying Sea King Mk. 41 in the SAR role, all other aircraft types in the inventory serve with MFG-3 at Nordholz. Units at Nordholz Nordholz Air Base is quite large with three ‘staffels’ (squadrons) and 4 types of aircraft organized in MFG-3 and named after ‘Graf Zeppelin’ the famous designer of airships. Nordholz will be the most important place for naval aviation in the next years and will see many flying activities. The third ‘staffel’ is equipped with the Sea Lynx Mk.88A (Super Lynx Mk.100) of which 22 where acquired since 1981 originally as Mk. 88 version. The helicopters are embarked on F-122, F-123 and F-124 frigates (two helicopters at one ship) for the ASW and ASuW role to form the ears and eyes around the ship and to watch or hunt submarines. For this last role the Lynx can use the dipping sonar and when necessary attack the submarine with two Mk.46 mod.2 torpedoes or depth charges. -
October 2017
AirPilot OCT 2017 ISSUE 23 Diary OCTOBER 2017 AI R PILOT 11th Pilot Aptitude Testing RAFC Cranwell 12th General Purposes & Finance Committee Cobham House THE HONOURABLE 26th Trophies & Awards Banquet Guildhall COMPANY OF AIR PILOTS NOVEMBER 2017 incorporating 4th Pilots Careers Live Sofitel Heathrow Air Navigators 4th Flying Club AGM White Waltham 9th Air Pilots Benevolent Fund Trustees Cobham House PATRON : His Royal Highness 10th Careers in Aerospace RAeS The Prince Philip 11th Lord Mayor’s Show Duke of Edinburgh KG KT 16th Scholarships Reception Cutlers Hall 16th General Purposes & Finance Committee Cobham House GRAND MASTER : 16th Court Cutlers Hall His Royal Highness The Prince Andrew Duke of York KG GCVO DECEMBER 2017 6th AST/APT meeting Cobham House MASTER : 14th General Purposes & Finance Committee Cobham House Captain C J Spurrier 14th Carol Service St. Michaels, Cornhill CLERK : Paul J Tacon BA FCIS Incorporated by Royal Charter. A Livery Company of the City of London. PUBLISHED BY : The Honourable Company of Air Pilots, Cobham House, 9 Warwick Court, Gray’s Inn, London WC1R 5DJ. VISITS PROGRAMME Please see the flyers accompanying this issue of Air Pilot or contact Liveryman David EDITOR : Curgenven at [email protected]. Paul Smiddy BA (Econ), FCA These flyers can also be downloaded from the Company's website. EMAIL: [email protected] Please check on the Company website for visits that are to be confirmed. FUNCTION PHOTOGRAPHY : Gerald Sharp Photography View images and order prints on-line. TELEPHONE: 020 8599 5070 GOLF CLUB EVENTS EMAIL: [email protected] Please check on Company website for latest information WEBSITE: www.sharpphoto.co.uk PRINTED BY: Printed Solutions Ltd 01494 478870 Except where specifically stated, none of the material in this issue is to be taken as expressing the opinion of the Court of the Company. -

Do 28D-2 SKYSERVANT
Dornier Do 28D-2 SKYSERVANT 04193-0389 2008 BY REVELL GmbH & CO. KG PRINTED IN GERMANY Dornier Do 28D-2 SKYSERVANT Dornier Do 28D-2 SKYSERVANT Mit einer zweimotorigen Weiterentwicklung unter der Bezeichnung Do 28A versuchte 1959 The Dornier Aircraft Company tried to build on the success of the single engine Do 27 by die Firma Dornier an die Erfolge der einmotorigen Do 27 anzuknüpfen. Aus Kostengründen developing a twin engine version designated Do 28A. On financial grounds they used about verwendete man etwa 80% der vorhandenen Do 27-Bauteile und verlegte die beiden 80% of available components from the Do 27 and repositioned both engines onto short stub Motoren an stummelförmigen Auslegern an die Rumpfseiten. Damit waren die Vorteile extensions on both sides of the fuselage. The advantages over the Do 27 however were too gegenüber der Do 27 jedoch zu gering um einen Erfolg auf dem Markt der Geschäfts- und few in order to achieve success in the freight and business aircraft market. The only answer Frachtflugzeuge zu erzielen. Der Ausweg war eine völlige Neukonstruktion unter was to a design completely new aircraft based on the initial concept. The Do 28D1 was devel- Beibehaltung der Grundidee. So entstand mit der Do 28D1 ein Flugzeug mit kastenförmigem oped, an aircraft with a box shaped fuselage and large twin loading doors. As with its pred- Rumpf und einer großen zweiteiligen Ladetür. Wie schon beim Vorgänger waren die beiden ecessor, the two powerful 378hp Lycoming IGSO-540-A1E piston engines were attached to 378PS starken Lycoming IGSO-540-A1E Kolbenmotoren an Auslegern auf den Rumpfseiten both sides of the fuselage on outriggers. -

© Dies Ist Ein Auszug Aus Einem Fachbuch, Welches Sie Hier Erwerben Können
Dies ist ein Auszug aus einem Fachbuch, welches Sie hier erwerben können: www.uhrenliteratur.de © www.uhrenliteratur.de Dies ist ein Auszug aus einem Fachbuch, welches Sie hier erwerben können: www.uhrenliteratur.de Military Timepieces Vol. II British Military Timepieces Watches and Clocks of Their Majesties Forces © www.uhrenliteratur.de Militäruhren Band II Uhren der britischen Streitkräfte Dies ist ein Auszug aus einem Fachbuch, welches Sie hier erwerben können: www.uhrenliteratur.deContent / Inhalt Preface A Trip to England to start this Project ............................................. 8 ........................................Es begann mit einer Reise nach England Part I. History of Navigation & the Observatories John Harrison, a Revolutionary of Time ....................................... 14 ................................................................Ein Revolutionär der Zeit Precision Pendulum Clocks of the Observatories ......................... 27 ..................................... Präzisions-Pendeluhren der Observatorien Astronomical regulator Edward John Dent & Co. No. 2010 ............................... 30 ................................Präzisions-Pendeluhr von Edward John Dent & Co. Nr. 201 Astronomical regulator Victor Kullberg No: 7361............................................... 32 ..................................... Regulator-Sekundenpendeluhr Victor Kullberg Nr. 7361 Captain Cook’s Pendulum Clocks ....................................................................... 36 ............................................... -

The JAPCC Interview with General Gorenc Air and Space Power in NATO
thalesgroup.com Everywhere it matters, / Autumn Winter 2014 we deliver SPACE Optimise solutions for telecoms, earth observation, navigation and research AEROSPACE Make air travel safer, smoother, cleaner and more enjoyable DEFENCE Improve decision-making and gain operational superiority SECURITY Protect citizens, sensitive data and infrastructure GROUND TRANSPORTATION Enable networks to run more swiftly and effi ciently The Journal of the JAPCC – Transforming Joint Air Power Air Joint Transforming – Journal of the JAPCC The © TSgt Cecilio Ricardo, US Air Force US Air Ricardo, Cecilio TSgt © Edition 19, Autumn / Winter 2014 Millions of critical decisions are made every day to PAGE PAGE PAGE protect people, infrastructure and nations. Thales is 6 16 43 at the heart of this. Our integrated smart technologies provide end-to-end solutions, enabling decision makers to deliver more eff ective The JAPCC Interview Air and Space Power Intellectual Interoper- responses, locally and globally. Everywhere, together with our customers, with General Gorenc in NATO – ability / Higher Education we are making a diff erence. Edition 19 Edition Commander USAFE-AFAFRICA, Future Vector Project Training and Partnership AIRCOM and Director JAPCC Development with Academia Corp14_English_C33465.035_297x210_May14_JAPCC_v1.indd 1 23/04/2014 11:15 Joint Air & Space Power Conference ‘Modern Chinese Warplanes’ It is challenging to fi nd published material that explores the current evolution of 18th –20th the third largest air force in the world. ‘Modern Chinese Warplanes’ by Andreas Rupprecht and Tom Cooper is a great collection of information about the todays largely unknown world air power. November The book starts off with a short history of the People’s Liberation Army Air Force (PLAAF) from its foundation in 1949 thru several phases up to present time. -
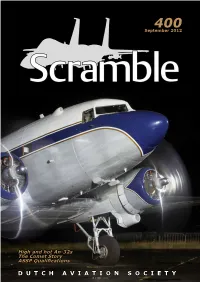
Scramble400 Preview.Pdf
400 September 2012 High and hot An-32s The Comet Story ASSP Qualifications DUTCH AVIATION SOCIETY Alpha Jet E135 has lost its prefix code 213 from Tours and is now only coded -RX. It has been seen previously at Mont de Marsan which is believed to be its new homebase. Jeroen Jonkers saw it on 19 July visiting Orange. The Marine National has two EC225s flying with 32F is the SAR role. When sufficient NH90s are delivered these two EC225s will be trans- ferred to the EH01.067 of the air force. EC225 2752 visited Carcassonne Salvaza on 23 July 2012 where Philippe Devos saw it. With Cambrai being closed as operational base and EC01.012 being disbanded a number of the based Mirage 2000 moved on to Orange. EC01.012 former 121/103-KN is now flying from Orange as 115-KN (26 July 2012, Jeroen Jonkers) Editorial Important dates Currently you are holding yet another historic issue of Scram- Scramble 401 ble in your hands – number 400! We have come a long way Deadline copy: 18 September 2012 from printing a handful of A4s with Amsterdam-Schiphol Deadline photos: 25 September 2012 movements to the Scramble as it is nowadays, packed full of Planned publication date: 9 October 2012 civil and military aviation news. And we won’t stop anytime soon, in fact we continue to expand into the digital age. As of Movements this number we are proud to announce that Scramble is avail- Contents able as a digital magazine too! It features everything that you Movements Netherlands..............................................................2 can read right now, but with all the pictures in colour. -
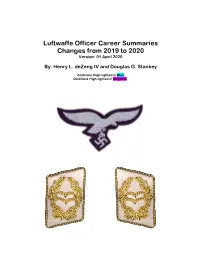
Luftwaffe Officer Career Summaries Changes from 2019 to 2020 Version: 01 April 2020
Luftwaffe Officer Career Summaries Changes from 2019 to 2020 Version: 01 April 2020 . By: Henry L. deZeng IV and Douglas G. Stankey Additions High-lighted in Blue Deletions High-lighted in Magenta. ABEL, Siegfried. (DOB: 21.08.14). 01.04.37 Ofhr., Aufkl.Gr. 112, promo to Lt.(RDA 01.04.36). 01.09.39 Lt., promo to Oblt.(Tr.O.), in Aufkl.Gr. 14. 01.40 Oblt., possibly acting Staka 2. (H)/Aufkl.Gr. 14. 05.03.40 with 2.(H)/Aufkl.Gr. 14 as an observer. 12.04.41 Oblt., with 2. (H)/Aufkl.Gr. 4 WIA- Hs 126 by MG fire vic Tobruk - hospitalized. 18.06.41 Oblt. in 2. (H)/Aufkl.Gr. 14, trf to the Oskar-Helenenheim in Berlin for treatment. 01.04.42 promo to Hptm. 04.09.42 trf to Erg.NAGr. 1942 appt instructor at the Aufkl.Erp.Stab Jüterbog-Damm. 23.03.43 trf from Erg.Nahaufkl.Gr. to RLM (L In 1) with temporary duty to Artillerieschule Jüterbog. 1943 with the RLM. 09.10.43 trf to FFS A 14 as Offz.z.b.V. 18.07.44 appt Aufsichts-Offz. LKS 4. 15.11.44 trf to 3./Erg.NAGr. 1944 trf to 3./Erg.Aufkl.G. 1 due to unit renaming. 1944 trf to OKL Gen.d.Aufkl. regarding Bildwesen. 30.01.45 appt Ic (Bild) of the Lw.Führungsstab I. ABELS, Hans-Joachim. (DOB: 21.06.14 in Zechlin). (W.B.K. Darmstadt). 1941 assigned to Lfl.Kdo. 2. 10.12.41 Furloughed for studies (to 15.02.42). -

Der Sowjetische Traum Vom Fliegen
Slavistische Beiträge ∙ Band 345 (eBook - Digi20-Retro) Robert Kluge Der sowjetische Traum vom Fliegen Analyseversuch eines gesellschaftlichen Phänomens Verlag Otto Sagner München ∙ Berlin ∙ Washington D.C. Digitalisiert im Rahmen der Kooperation mit dem DFG-Projekt „Digi20“ der Bayerischen Staatsbibliothek, München. OCR-Bearbeitung und Erstellung des eBooks durch den Verlag Otto Sagner: http://verlag.kubon-sagner.de © bei Verlag Otto Sagner. Eine Verwertung oder Weitergabe der Texte und Abbildungen, insbesondere durch Vervielfältigung, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verlages unzulässig. «Verlag Otto Sagner» ist ein Imprint der Kubon & Sagner GmbH. Robert Kluge - 9783954790791 Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 02:58:26AM via free access 00051915 S l a v i s t i c h e Be it r ä g e Begründet von Alois Schmaus Herausgegeben von Peter Rehder Beirat: Johanna Renate Döring-Smimov ־ Tilman Berger ■ Waller Breu Klaus Steinke ־ Miloš Sedmidubskÿ ־ Ulrich Schweier ־ Walter Koschmal ־ Wilfried Fiedler BAND 345 Bayerfscne etaatsbibiiothek München V erlag Otto Sagner M ünchen 1997 Robert Kluge - 9783954790791 Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 02:58:26AM via free access 00051915 Robert Kluge Der sowjetische Traum vom Fliegen Analyseversuch eines gesellschaftlichen Phänomens V e r l a g O t t o S a g n e r M ü n c h e n 1997 Robert Kluge - 9783954790791 Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 02:58:26AM via free access ISBN 3-87690-665-2 © Verlag Otto Sagner, München 1997 Abteilung der Firma Kubon & Sagner D-80328 München Robert Kluge - 9783954790791 Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 02:58:26AM 3 > ì> (0 ао via free access Идет без проволочек И тает ночь, пока Над спящим миром летчик Уходит в облака.