Der Kanon / [Hrsg
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

1 Recherchierte Dokumente
Herr der Bücher: Marcel Reich-Ranicki in seiner Frankfurter Wohnung MONIKA ZUCHT / DER SPIEGEL SPIEGEL-GESPRÄCH „Literatur muss Spaß machen“ Marcel Reich-Ranicki über einen neuen Kanon lesenswerter deutschsprachiger Werke SPIEGEL: Herr Reich-Ranicki, Sie haben für die an der Literatur interessiert sind. Gibt es um die Schule geht, für den Unterricht den SPIEGEL Ihren persönlichen literari- es überhaupt einen Bedarf für eine solche besonders geeigneter Werke. Die Frage, ob schen Kanon zusammengestellt, die Sum- Liste literarischer Pflichtlektüre? wir einen solchen Katalog benöti- me Ihrer Erfahrung als Literaturkritiker – Reich-Ranicki: Ein Kanon ist nicht etwa ein gen, ist mir unverständlich, denn für Schüler, Studenten, Lehrer und dar- Gesetzbuch, sondern eine Liste empfehlens- über hinaus für alle, werter, wichtiger, exemplarischer und, wenn Das Gespräch führte Redakteur Volker Hage. Chronik der deutschen Literatur Marcel Reich-Ranickis Kanon Johann Wolfgang von Goethe, Andreas Gryphius, 1749 –1832 1616 –1664 „Die Leiden des Gedichte jungen Werthers“, Gotthold Ephraim Lessing, „Faust I“, „Aus Walther von der Christian Hofmann Johann Christian 1729 –1781 meinem Leben. Das Nibe- Vogelweide, Martin Luther, von Hofmannswaldau, Günther, „Minna von Barnhelm“, Dichtung und lungenlied ca. 1170 –1230 1483 –1546 1616 –1679 1695 –1723 „Hamburgische Dramaturgie“, Wahrheit“, (um 1200) Gedichte Bibelübersetzung Gedichte Gedichte „Nathan der Weise“ Gedichte MITTELALTER16. JAHRHUNDERT 17. JAHRHUNDERT 18. JAHRHUNDERT 212 der spiegel 25/2001 Titel der Verzicht auf einen Kanon würde den der verfassten Rahmenrichtlinien und und auch die liebe Elke Heidenreich. Be- Rückfall in die Barbarei bedeuten. Ein Lehrpläne für den Deutschunterricht an merkenswert der Lehrplan des Sächsischen Streit darüber, wie der Kanon aussehen den Gymnasien haben einen generellen Staatsministeriums für Kultus: Da werden sollte, kann dagegen sehr nützlich sein. -

The University of Chicago Objects of Veneration
THE UNIVERSITY OF CHICAGO OBJECTS OF VENERATION: MUSIC AND MATERIALITY IN THE COMPOSER-CULTS OF GERMANY AND AUSTRIA, 1870-1930 A DISSERTATION SUBMITTED TO THE FACULTY OF THE DIVISION OF THE HUMANITIES IN CANDIDACY FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY DEPARTMENT OF MUSIC BY ABIGAIL FINE CHICAGO, ILLINOIS AUGUST 2017 © Copyright Abigail Fine 2017 All rights reserved ii TABLE OF CONTENTS LIST OF MUSICAL EXAMPLES.................................................................. v LIST OF FIGURES.......................................................................................... vi LIST OF TABLES............................................................................................ ix ACKNOWLEDGEMENTS............................................................................. x ABSTRACT....................................................................................................... xiii INTRODUCTION........................................................................................................ 1 CHAPTER 1: Beethoven’s Death and the Physiognomy of Late Style Introduction..................................................................................................... 41 Part I: Material Reception Beethoven’s (Death) Mask............................................................................. 50 The Cult of the Face........................................................................................ 67 Part II: Musical Reception Musical Physiognomies............................................................................... -

Der Kanon / [Hrsg
Inhalt Erich Fried Die Abnehmer (Einer nimmt uns das Denken ab) 19 Logos (Das Wort ist mein Schwert) 19 Die Maßnahmen (Die Faulen werden geschlachtet) .... 20 Angst und Zweifel (Zweifle nicht) . 21 Zur Sonne, zur Freiheit! (Ich will Freunde haben) .... 21 Bevor ich sterbe (Noch einmal sprechen) . 22 Was es ist (Es ist Unsinn) . 22 Für Karl Kraus (Du warst der Kläger) 23 Hans Carl Artmann die grüne mistel schweigt 24 wie der saft einer sehr süßen frucht . 24 im parke, wo die unhold weilen 25 Soldaten ach Soldaten ja 25 Ilse Aicbinger Widmung (Ich schreibe euch keine Briefe) 27 Briefwechsel (Wenn die Post nachts käme) 27 Friederike Mayröcker Gedicht mit Motto (ich habe Durst) 28 falsche Bewegung (gestern / beim Auseinander- / gehen) . 28 an eine Mohnblume mitten in der Stadt (aus meinen Köpfen sprieszt). 29 Ernst Jandl sommerlied (wir sind die menschen) 30 Ikarus (Er flog hoch) 30 zertretener mann blues (ich kann die hand nicht heben) . 30 lichtung (manche meinen) 31 ottos mops (ottos mops trotzt) . 31 vater komm erzähl vom krieg 32 glückwunsch (wir alle wünschen jedem) 32 an gott (daß an gott geglaubt) 33 der wahre vogel (fang eine liebe amsel) . 33 8 Inhalt Elisabeth Borebers eia wasser regnet schlaf. .................. 34 Vergessener Geburtstag (Wer hat auf meinem Stuhl) ... 35 Dagmar Nick Hybris (Wir sind nicht mehr die gleichen) ......... 36 Vision (Die Städte werden Asche sein) ........... 36 Ingeborg Bachmann Die gestundete Zeit (Es kommen härtere Tage) ...... 37 Alle Tage (Der Krieg wird nicht mehr). .......... 38 Die große Fracht (Die große Fracht des Sommers) .... 38 Früher Mittag (Still grünt die Linde) 39 Das Spiel ist aus (Mein lieber Bruder) 40 Es ist Feuer unter der Erde 42 Was wahr ist 42 An die Sonne (Schöner als der beachtliche) 43 Erklär mir, Liebe (Dein Hut lüftet sich) ......... -

Geschichte Der Deutschen Prosaliteratur – 5
Geschichte der deutschen Prosaliteratur – 5 Vorlesung SoSe 2007/2008 Mittwoch 16.00-18.00 Erzählliteratur der Goethezeit – Klassik / Romantik literaturhistorische Epochen = Konstrukte ‘Epochen’,‘Stilrichtunge n Überschneidungen Überlappungen Schwierigkeiten der Abgrenzung Goethezeit: Spätaufklärung Sturm und Drang Klassik Romantik teilw. Anfänge des sog. Vormärz / Biedermeier Erzählliteratur der Goethezeit – Klassik / Romantik Goethezeit: tiefgreifende Wandlungen der Individuumkonzeption französische Revolution: Umwälzungen und ihre Rückwirkungen philosophische Grundlagen (Kant, Fichte) unterschiedliche Auffassungen in Klassik und Romantik Klassik → verweist auf die Antike – Antike als Ideal (Wickelmann: „edle Einfalt”, „stille Größe”) Epoche der deutschen Literatur vs. überzeitliche Erscheinung als literaturgeschichtliche Epoche: Abgrenzungsfragen deutsche Klassik (Weimarer Klassik): Goethe, Schiller – Herder, Wieland griechische Antike als Vorbild – entwicklungsgeschichtliche Vorstellungen (Schiller: Über naive und sentimentalische Dichtung; Die Götter Griechenlands) teilweise aufklärerische Ideen – Erziehbarkeit des Menschen Humanitätsideal – Harmonie von Gefühl und Verstand, Individuum und Gemeinschaft Erziehung durch Kunst (Schiller: Über die ästhetische Erziehung des Menschen) allseitige Entwicklung der Persönlichkeit vs. Spezialisierung ästhetische Konzeption des Kunstwerks, der Gattungen Erzählliteratur der Goethezeit – Klassik / Romantik Romankonzeptionen: der Roman als Bildungsroman Goethe: „Wilhelm -

Bigge2007.Pdf
„ ... allerlei Sonstiges ... “ Auf den Spuren des Zauberberg von Thomas Mann im Prosawerk Max Frischs Vorgelegt von Barbara Bigge aus Essen Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Dr. phil. im Fach Germanistik am Fachbereich Geisteswissenschaften der Universität Duisburg-Essen Erstgutachter: Prof. Dr. Jochen Vogt Zweitgutachter: Prof. Dr. Dr. h.c. Hugh M. Ridley Tag der mündlichen Prüfung: 17. Oktober 2007 2 Inhalt 1 Vorbemerkungen .............................................................................. 4 1.1 Anmerkungen zur perspektivischen Ausrichtung ................................................ 6 Exkurs: Kulturwissenschaften im Rahmen dieser Arbeit .................................................................... 8 1.2 Erkenntnisinteresse.............................................................................................13 2. Theoretische, methodische und ‚persönliche’ Voraussetzungen..... 16 2.1 Intertextualität.....................................................................................................17 2.1.1 Die Forschungslage: Intertextualität gestern und (vor allem) heute .........................................19 2.1.2 Ausgewählte Konzepte zur Intertextualität ................................................................................25 2.1.2.1 Begrifflichkeiten und Kriterien verschiedener Provenienz......................................................27 2.1.2.2 Begrifflichkeiten und Kriterien bei Jörg Helbig .................................................................... -
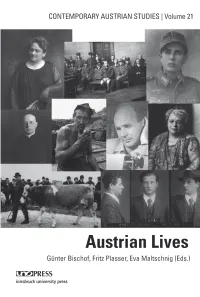
CAS21 for Birgit-No Marks
Austrian Lives Günter Bischof, Fritz Plasser, Eva Maltschnig (Eds.) CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | Volume 21 innsbruck university press Copyright ©2012 by University of New Orleans Press, New Orleans, Louisiana, USA. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All inquiries should be addressed to UNO Press, University of New Orleans, LA 138, 2000 Lakeshore Drive, New Orleans, LA, 70119, USA. www.unopress.org. Printed in the United States of America. Book and cover design: Lauren Capone Cover photo credits given on the following pages: 33, 72, 119, 148, 191, 311, 336, 370, 397 Published in the United States by Published and distributed in Europe University of New Orleans Press: by Innsbruck University Press: ISBN: 9781608010929 ISBN: 9783902811615 Contemporary Austrian Studies Sponsored by the University of New Orleans and Universität Innsbruck Editors Günter Bischof, CenterAustria, University of New Orleans Fritz Plasser, Universität Innsbruck Production Editor Copy Editor Bill Lavender Lauren Capone University of New Orleans University of New Orleans Executive Editors Klaus Frantz, Universität Innsbruck Susan Krantz, University of New Orleans Advisory Board Siegfried Beer Sándor Kurtán Universität Graz Corvinus University Budapest Peter Berger Günther Pallaver -

Wie Walter Moers Mithilfe Der Intertextualität Mit Der Grenze Zwischen Hoch- Und Trivialliteratur Spielt
University of Tennessee, Knoxville TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange Masters Theses Graduate School 12-2020 Das ist doch trivial! Wie Walter Moers mithilfe der Intertextualität mit der Grenze zwischen Hoch- und Trivialliteratur spielt Isabell Stoll University of Tennessee, Knoxville, [email protected] Follow this and additional works at: https://trace.tennessee.edu/utk_gradthes Part of the German Literature Commons Recommended Citation Stoll, Isabell, "Das ist doch trivial! Wie Walter Moers mithilfe der Intertextualität mit der Grenze zwischen Hoch- und Trivialliteratur spielt. " Master's Thesis, University of Tennessee, 2020. https://trace.tennessee.edu/utk_gradthes/5860 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange. It has been accepted for inclusion in Masters Theses by an authorized administrator of TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange. For more information, please contact [email protected]. To the Graduate Council: I am submitting herewith a thesis written by Isabell Stoll entitled "Das ist doch trivial! Wie Walter Moers mithilfe der Intertextualität mit der Grenze zwischen Hoch- und Trivialliteratur spielt." I have examined the final electronic copy of this thesis for form and content and recommend that it be accepted in partial fulfillment of the equirr ements for the degree of Master of Arts, with a major in German. Stefanie Ohnesorg, Major Professor We have read this thesis and recommend its acceptance: Adrian Del Caro, Maria Stehle Accepted for the Council: Dixie L. Thompson Vice Provost and Dean of the Graduate School (Original signatures are on file with official studentecor r ds.) Das ist doch trivial! Wie Walter Moers mithilfe von Intertextualität mit der ‚Grenze‘ zwischen ‚Hoch- und Trivialliteratur’ spielt A Thesis Presented for the Master of Arts Degree The University of Tennessee, Knoxville Isabell Stoll December 2020 ii Danksagung Vielen Dank an Frau Dr. -

Austrian Lives
Austrian Lives Günter Bischof, Fritz Plasser, Eva Maltschnig (Eds.) CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | Volume 21 innsbruck university press Copyright ©2012 by University of New Orleans Press, New Orleans, Louisiana, USA. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All inquiries should be addressed to UNO Press, University of New Orleans, LA 138, 2000 Lakeshore Drive, New Orleans, LA, 70119, USA. www.unopress.org. Printed in the United States of America. Book and cover design: Lauren Capone Cover photo credits given on the following pages: 33, 72, 119, 148, 191, 311, 336, 370, 397 Published in the United States by Published and distributed in Europe University of New Orleans Press: by Innsbruck University Press: ISBN: 9781608010929 ISBN: 9783902811615 Contemporary Austrian Studies Sponsored by the University of New Orleans and Universität Innsbruck Editors Günter Bischof, CenterAustria, University of New Orleans Fritz Plasser, Universität Innsbruck Production Editor Copy Editor Bill Lavender Lauren Capone University of New Orleans University of New Orleans Executive Editors Klaus Frantz, Universität Innsbruck Susan Krantz, University of New Orleans Advisory Board Siegfried Beer Sándor Kurtán Universität Graz Corvinus University Budapest Peter Berger Günther Pallaver -

Mittelalterrezeption Im Deutschen Südwesten
Sonderdrucke aus der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg VOLKER SCHUPP Mittelalterrezeption im deutschen Südwesten Originalbeitrag erschienen in: Hansmartin Schwarzmaier (Hrsg.): Das Mittelalterbild des 19. Jahrhunderts am Oberrhein. Ostfildern: Thorbecke, 2004, S. [9]-30 Mittelalterrezeption im deutschen Südwesten VON VOLKER SCHUPP Johannes Gut zum Gedächtnis' 1. Der Begriff der Rezeption, der bei unseren heutigen Problemen im Mittelpunkt steht, muß von dem üblichen der Literaturwissenschaft methodisch weitgehend ferngehalten werden. Es geht nicht vordringlich um die Erkenntnis des von der Aufnahme her gesteuerten künstlerischen Prozesses, sondern um das mehr oder weniger bewußte Aufgreifen von vorgänglich Gestaltetem oder Gelebtem. Dabei werden künstlerische und außerkünstle- rische Intentionen eine Rolle spielen, Moden und Aversionen. Die Sache ist uralt, ich denke, daß man auch die sogenannten Renaissancen hier zumindest als Systemvorbilder einbeziehen kann. Da die Konstanzer Schule den Anspruch erhoben hat, sich über die Re- zeption früheren, historischen Epochen der Literatur zu nähern, wird die Rezeptions- ästhetik gelegentlich berücksichtigt werden müssen, die ja mit einem Paradigmenwechsel einhergeht. Was man im Normalverstand als Rezeptionsforschung bezeichnet, geht angeblich auf Probleme zurück, die die Mittelalterforschung, insbesondere die Altgermanistik, in den 60/70er Jahren mit den aufsässigen Studenten gehabt hat. Es scheint mir aber nicht mög- lich, die Existenz dieses Forschungsfeldes allein auf die universitätspolitische Situation nach der Studentenrevolte zurückzuführen, die Denkform gehört in einen größeren Zu- sammenhang. Daß ein gewisser Anstoß von dort ausgegangen ist, wird man nicht abstrei- ten können. Ich habe es selbst miterlebt. Immer wieder wurde die Germanistik/Mediävi- stik aufgefordert, ihre Relevanz nachzuweisen, was ihr offensichtlich schwerfiel. Ein Ausweg war, das ganz Alte mit dem ganz attraktiven Neuen zu verbinden, was ja auch nicht so neu war, was aber weniger beachtet wurde. -

1 Zur Diskussion Gestellt – Marcel Reich-Ranickis Literaturkanon
Zur Diskussion gestellt – Marcel Reich-Ranickis Literaturkanon 1 „Literatur muss Spaß machen“ Marcel Reich-Ranicki über einen neuen Kanon lesenswerter deutschsprachiger Werke SPIEGEL: Herr Reich-Ranicki, Sie haben für den lichkeit der Wahl gibt. Aber bei den jetzigen vo- SPIEGEL Ihren persönlichen literarischen Kanon luminösen Listen sind alle überfordert - die Lehrer zusammengestellt, die Summe Ihrer Erfahrung als ebenso wie die Schüler. Diese Richtlinien und Literaturkritiker - für Schüler, Studenten, Lehrer Lehrpläne zeugen vor allem von einem: von Welt- und darüber hinaus für alle die an der Literatur fremdheit. interessiert sind. Gibt es überhaupt einen Bedarf SPIEGEL: Nennen Sie ein Beispiel. für eine solche Liste literarischer Pflichtlektüre? Reich-Ranicki: Der Bildungsplan für die Gymna- Reich-Ranicki: Ein Kanon ist nicht etwa ein Ge- sien in Baden-Württemberg ist von erschrecken- setzbuch, sondern eine Liste empfehlenswerter, der Vollständigkeit: Aus der Epoche nach 1945 wichtiger, exemplarischer und wenn es um die werden ganz einfach - jedenfalls entsteht dieser Schule geht, für den Unterricht besonders geeig- Eindruck - alle Autoren empfohlen, die in dieser neter Werke. Die Frage, ob wir einen solchen Ka- Zeit publiziert haben, einschließlich des mittler- talog benötigen, ist mir unverständlich, denn der weile zum Glück vergessenen Gerd Gaiser. Nichts Verzicht auf einen Kanon würde den Rückfall in gegen Ruth Rehmann oder Reinhold Schneider die Barbarei bedeuten. Ein Streit darüber, wie der oder Erich Loest: Aber ich erlaube mir die Kanon aussehen sollte, kann dagegen sehr nütz- schüchterne Frage, ob sie wirklich zum Kanon für lich sein. den Gymnasialunterricht gehören sollten. Das SPIEGEL: Wie lange kann ein solcher Kanon Gül- Kultusministerium von Sachsen-Anhalt nennt in tigkeit haben? Der Geschmack ändert sich doch - seinem "Lektüre- und Medienangebot" für den von Individuum zu Individuum, von Epoche zu Deutschunterricht an Gymnasien und Fachgym- Epoche. -

Para Entender Marcel Reich-Ranicki
138 Eggensperger, K. - Para entender Marcel Reich-Ranicki Para entender Marcel Reich-Ranicki [Understanding Marcel Reich-Ranicki] Klaus Eggensperger1 Abstract: The article presents the literary critic Marcel Reich-Ranicki and tries to explain his extraordinary success in Germany. It highlights some qualities of his criticism as well as his special relation to mass media and entertainment. Finally, by going into details of his biography, the text surveys the relation of the Polish-born Jewish critic with Germany and German culture. Key-words: literary criticism; German literature; German literary field; Reich-Ranicki Resumo: O artigo apresenta o crítico literário Marcel Reich-Ranicki e também procura explicar o fenômeno de seu sucesso na Alemanha. Aprofunda algumas particularidades de sua crítica, sua relação com a mídia de massas e o entretenimento. Finalmente investiga o percurso incomum de sua vida como crítico judeu das literaturas de língua alemã nascido na Polônia e sua relação com a cultura alemã. Palavras-chave: crítica literária; literatura alemã; campo literário alemão; Reich-Ranicki Introdução Quem conhece as críticas de Marcel Reich-Ranicki (1920-2013) pode achar estranho o título desta contribuição. Nenhum crítico literário que publicou em língua alemã é mais fácil de ser compreendido do que ele; escrever e falar ao alcance de todos foi um de seus preceitos. Como fenômeno sociocultural, porém, tem ocupado uma posição singular no campo literário e na esfera pública alemães. Tem sido uma estrela, um star da vida pública na Alemanha. O que quer dizer isso em termos da sociologia cultural? Uma pessoa pode se tornar star dentro da indústria cultural moderna a partir da segunda metade do século XIX. -

Kanonbildung in Europa
ULRICH SCHULZ-BUSCHHAUS Das Aufsatzwerk Institut für Romanistik | Karl-Franzens-Universität Graz Permalink: http://gams.uni-graz.at/o:usb-063-58 Kanonbildung in Europa Die Arbeit des Literarhistorikers umfaßt Tätigkeiten, die ihm manchmal Zweifel und ein schlechtes Gewissen eintragen, doch letzten Endes unvermeidlich sind. Er interpretiert, obwohl die gereizten Proteste „Against Interpretation“ seit langem zur Tradition der Avantgarde zählen; er vergleicht, obwohl man ihm gesagt hat, daß „comparaison“ nicht immer „raison“ ist; er periodisiert, obwohl er weiß, wie weit das Konstrukt der Epochenbegriffe sich vom historischen Fluß der Ereignisse zu entfernen pflegt. Eine weitere solcher Unvermeidlichkeiten stellt unter seinen Aktivitäten der Umgang mit dem oder einem Kanon dar. Was der Literarhistoriker auch tun mag, ist vom – sei’s noch so vagen – Bewußtsein kanonischer Geltungen geprägt und greift seinerseits – wenngleich noch so vermittelt – wiederum in dies Geflecht von Übereinkünften ein: zumeist als dessen Bestätigung und Stärkung, gelegentlich aber auch als Kontestation, ja Negation bestehender Geltungshierarchien. Eine vergleichbare Arbeit am Kanon betreibt indes wenigstens implizit jeder Literat – der nicht ausdrücklich theoretisierende kaum minder effektiv als der Verfasser einer Poetik oder eines Manifests. Dabei neigt man im Hinblick auf die Literatur des 20. Jahrhunderts dazu, als den idealtypischen Kanonbildner einen der Überlieferung zugewandten, zugleich kosmopolitisch und abendländisch empfindenden ‚poeta eruditus‘ anzusehen,