Bei Elbingerode, Lkr. Harz
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Abbenrode - Das Dorf an Der Ecker : Informationsschrift Über Die Ortsgeschichte Der Gemeinde Abbenrode Von Der Ersten Ansiedlung Bis Zur Gegenwart
Abbenrode - das Dorf an der Ecker : Informationsschrift über die Ortsgeschichte der Gemeinde Abbenrode von der ersten Ansiedlung bis zur Gegenwart. Hrsg. vom Rat der Gemeinde Abbenrode, erarb. vom Chronistenkollektiv. Abbenrode 1989. 53 S. - Bc 245 (G) - Abert, Paul: Durch den Harz. Leipzig 1926. VIII, 228 S. (Storm Reiseführer) - Ab 184 (K) - Archäologische Berichte aus Sachsen-Anhalt. Landesamt für archäologische Denk- malpflege Sachsen-Anhalt, Landesmuseum für Vorgeschichte. Halle (Saale) Erscheint jährl. 1993 (1994) 1994 (1996) 1995 (1996) - Ae 330 (K) - Heimatblätter der Kreises Artern. [Hrsg.: Kulturbund zur demokratischen Erneue- rung Deutschlands, Kreisleitung Sangerhausen in Verbindung mit dem Rat des Kreises, Abteilung Kultur, Sangerhausen]. Sangerhausen Auch u.d.T.: Heimatblätter des Kreises Sangerhausen. - Erschien mehrmals jährl. 6 (1954) 7-9, 13 (1955) 17, 18 (1956) - Ec 70 (K) - Zeitschrift des Vereins für Heimatkunde, Geschichte und Schutz von Artern e. V. - Aratora : (Neugründung 29.10.1990). Hrsg. vom Vorstand des Heimatvereins Ara- tora Artern e.V. Artern Erscheint jährl. 1 (1991) 4 (1994) 7 (1997) 2 (1992) 5 (1995) 8 (1998) 3 (1993) 6 (1996) - Ec 37 (G) - Aschersleben Schulprogrammschriften des Gymnasiums 1831 - 1910 - Ea 65-67 (K) - Die 150jährige Geschichte des Wasserheilbades Bad Lauterberg im Harz : Wirkung und Hoffnung - das ganzheitliche Gesundheitsprinzip Sebastian Kneipps bleibt immer gültig. Hrsg. vom Kneippverein Bad Lauterberg im Harz e.V. Bad Lauterberg [1989?] - Bh 207 (K) - Heimatbuch und Wanderführer für Bad Sachsa. [Zsgest. von Hans Horn und F. W. Biertimpel-Gallen]. Osterode/Harz 1950. 75, [16] S. - Bg 38 (K) - Blankenburg Schulprogrammschriften des Gymnasiums 1841 - 1915 - Bd 103 / Bd 132 (K) - Der Kurgast : amtliche Kurzeitung des Heilbades Blankenburg, Harz. -
Wernigerode Castle
Landmark 8 Wernigerode Castle ® On the 17th of November, 2015, during the 38th UNESCO General Assembly, the 195 member states of the United Nations resolved to introduce a new title. As a result, Geoparks can be distinguished as UNESCO Global Geoparks. Among the fi rst 120 UNESCO Global Geoparks, spread throughout 33 countries around the world, is Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen. UNESCO-Geoparks are clearly defi ned, unique areas, in which locations and landscapes of international geological importance are found. They are operated by organisations which, with the involvement of the local population, campaign for the protection of geological heritage, for environmental education and for sustainable regional development. 22 Königslutter 28 ® 1 cm = 16,15 miles 20 Oschersleben 27 18 14 Goslar Halberstadt 3 2 8 1 QuedlinburgQ 4 OsterodeOsterodedee a.H.a.Ha 9 11 5 131 15 16 6 10 17 19 7 Sangerhausen NordhausenNdh 12 21 As early as 2004, 25 Geoparks in Europe and China had founded the Global Geoparks Network (GGN). In autumn of that year Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen became part of the network. In addition, there are various regional networks, among them the European Geoparks Network (EGN). These coordinate international cooperation. In the above overview map you can see the locations of all UNESCO Global Geoparks in Europe, including UNESCO Global Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen and the borders of its parts. Historism 1 Wernigerode Castle Originally, a medieval fortress crowned the promontory of the Agnesberg. After the devastating ravages of the 30-Years-War (1618 – 1648), the work of reconstructing the fortress as a Baroque residence castle began under the Count ERNST OF STOLBERG-WERNIGERODE (1716 – 1778). -

Förderverein Der Freiwilligen Feuerwehr Heimburg E
Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Heimburg e. V. Kontakt: Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Heimburg e. V. Heimburg Am Teiche 6 38889 Blankenburg (Harz) Wenn Sie Fragen haben, dann sprechen Sie uns gerne an! Der Vorstand 1. Vorsitzender: Markus Sonnberger Handy: 0160/5532433 2. Vorsitzender: Henning Arndt Handy: 0151/54611496 Kassenwartin: Jana Hädicke Schriftführer: Frank Engelmann Spendenkonto Bankverbindung Harzer Volksbank eG IBAN: DE25 8006 3508 4104 7540 00 Wenn Sie unserem Verein eine Spende zukommen lassen, wird Ihnen selbstverständlich eine Spendenbescheinigung ausgestellt. Förderungsaktivitäten und Vorhaben u.a. Liebe Gäste, Freunde und Förderer, finanzielle und materielle Unterstützung Der Vorstand und der Beirat der Freiweilligen Ortsfeuerwehr Heimburg der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Heimburg e. V. Heimburg e. V. unterstützt und fördert die Beteiligung an diversen Veranstaltungen Freiwillige Feuerwehr Heimburg und das Feuerlöschwesen sowie die Stärkung des Ausstattung des Gerätehauses, der Brandschutzgedankens in Heimburg. Fahrzeuge und der Kleidung Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Die vollständige Satzung des Vereins können Sie unter der Rubrik Vereine auf der Homepage des a) die Herstellung und Beschaffung von Ortsteils Heimburg unter www.heimburg-harz.de. Arbeits-, Informations- und Schulungs- einsehen. material, Hier finden Sie auch einen Aufnahmeantrag sowie die Beitragsordnung des Fördervereins. b) Gewinnung von interessierten Einwohnern -

K1b L Ö SUNG 1. in Welcher Stadt Wurde
K1b L Ö S U N G 1. In welcher Stadt wurde Heinrich IV. geboren? Goslar Am 11. November 1050 wurde der erste männliche Nachfahre (Heinrich IV.) und heißersehnter Thronfolger des Sachsenkaisers Heinrich III. und Agnes von Poitou aus Aquitanien in Goslar geboren. 2. Welche beiden Persönlichkeiten spielten beim Kniefall von Chiavenna die entscheidenden Rollen? Heinrich der Löwe Friedrich I. Barbarossa Der Kniefall von Chiavenna 1176 Kaiser Friedrich Barbarossa wollte die frühere Macht des Römerreiches wiederherstellen, stieß jedoch auf den erbitterten Widerstand der oberitalienischen Städte, die von Papst Alexander III. unterstützt wurden. Für seine Hilfe hatte er dem Braunschweiger Fürsten, „Heinrich, der Löwe“, das Herzogtum Bayern als Lehen zugesprochen. Als Friedrich erneut Hilfe erbat, verlangte sein Vetter Heinrich dafür Goslar und den Rammelsberg; der Kaiser lehnte ab. Heinrich war daraufhin nicht zur Heerfolge bereit. Später wurde der mächtige Heinrich verbannt und ging zu seinem Schwiegervater, dem König von England. Auch das bayrische Lehen wurde ihm wieder abgenommen. So endete der Streit der beiden überragenden politischen Figuren des 12. Jahrhunderts zugunsten des Kaisers. 3. Welche beiden großen Persönlichkeiten der damaligen Zeit trafen sich in Goslar zur Weihe der Stiftskirche St. Simon und Judas Thaddäus (Goslarer Dom)? Papst Victor II. Heinrich III. Kaiser Heinrich III. aus dem Hause der Salier empfing Papst Viktor II., der mit großem Gefolge anreiste. In Anwesenheit vieler Bischöfe wurde die Weihe des Domes vorgenommen. Heinrich III. residierte damals in der Kaiserpfalz und befand sich auf dem Höhepunkt seiner Macht. Sein Reich umfasste Deutschland, Italien und Burgund, und sein Einfluss reichte weit in die östlichen Länder. Wenige Wochen später jedoch starb er auf einer Jagd im Harz. -
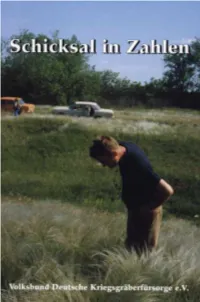
Layout-A K T. MD
Schicksal in Zahlen Informationen zur Arbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. Herausgegeben vom: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. Werner-Hilpert-Straße 2, 34112 Kassel Internet: www.volksbund.de E-Mail: [email protected] Redaktion und Gestaltung: AWK-Dialog Marketing 6. Auflage - (61) - April 2000 Druck: Graphischer Großbetrieb Pössneck Fotos: Nagel (1), Kammerer (3), Volksbund Archiv Titelbild: Mitarbeiter des Volksbundes suchen in der Steppe von Wolgograd - dem ehemaligen Schlachtfeld von Stalingrad - nach den Gräbern deutscher Soldaten. 2 Aus dem Inhalt Gedenken und Erinnern ..................................... 3 Seit 80 Jahren ein privater Verein ...................... 8-36 Gedenken an Kriegstote ..................................... 8 Sorge für Kriegsgräber ........................................ 11 Ein historisches Ereignis .................................... 37-38 Volkstrauertag ..................................................... 39-44 Totenehrung .......................................................... 40 Aus Gedenkreden ................................................ 41 Zentrales Mahnmal .............................................. 45 Rechtliche Grundlagen ...................................... 48-59 Umbettung von Gefallenen ............................... 60-63 Deutsche Dienststelle ......................................... 64 Gräbernachweis .................................................... 66-72 Grabschmuck ........................................................ 70 Gräbersuche im -

Schule Träger ESF-Programmschulen Und
ESF-Programmschulen und Projektträger im Landkreis Harz Stand: November 2019 Schule Träger IB Mitte gGmbH, NL Sachsen-Anhalt, Kinder- und Berufsbildende Schulen "Geschwister Scholl" Standort Halberstadt Jugendhilfezentrum Harz IB Mitte gGmbH, NL Sachsen-Anhalt, Kinder- und Berufsbildende Schulen "J.P.C. Heinrich Mette" Quedlinburg Jugendhilfezentrum Harz IB Mitte gGmbH, NL Sachsen-Anhalt, Kinder- und Berufsbildende Schulen Landkreis Harz Jugendhilfezentrum Harz Bosseschule Quedlinburg AWO Kreisverband Harz e.V. IB Mitte gGmbH, NL Sachsen-Anhalt, Kinder- und Europa- und Ganztagsschule "August Bebel" Blankenburg Jugendhilfezentrum Harz Fallstein-Gymnasium Osterwieck Gemeinnützige Paritätische Sozialwerke - PSW GmbH Caritasverband für das Bistum Magdeburg, Dekanat Förderschule "Albert Schweitzer" Halberstadt Halberstadt Caritasverband für das Bistum Magdeburg, Dekanat Förderschule "David-Sachs-Schule" Quedlinburg Halberstadt Förderschule "Pestalozzi" Wernigerode Gemeinnützige Paritätische Sozialwerke - PSW GmbH IB Mitte gGmbH, NL Sachsen-Anhalt, Kinder- und Goethe-Sekundarschule Ilsenburg Jugendhilfezentrum Harz Seite 1 ESF-Programmschulen und Projektträger im Landkreis Harz Stand: November 2019 Schule Träger Grundschule "Albert Klaus" Badersleben AWO Kreisverband Harz e.V. Grundschule "Am Regenstein" Blankenburg Gemeinnützige Paritätische Sozialwerke - PSW GmbH Grundschule "Aue-Fallstein" Hessen Gemeinnützige Paritätische Sozialwerke - PSW GmbH Grundschule "Auf den Höhen" Thale Sozialzentrum Bode e. V. Grundschule "Dr. Wilhelm Schmidt" -

Stadt Blankenburg (Harz) 06
Teil II – Umweltbericht Seite: 1. Einleitung ……………………………………………………………………….. 2 1.a. Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele der 2.Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Blankenburg (Harz) (Angaben zum Standort, Art und Umfang der Änderungen, Bedarf an Grund und Boden) ……………………………………………………. 2 1.b. Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen und ihre Bedeutung für den Bauleitplan (Fachplanungen; Fachgesetze, u.a. Verordnungen und Satzungen, z. B. über Schutzgebiete oder Klimaschutz) ………………………… 4 2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen ……………………...... 4 2.a. Bestandsaufnahme und Bewertung (Situation, Vorbelastung, Empfindlichkeit) ……………………………………... 4 2.a.1. Schutzgut Mensch ……………………………………………………………….. 4 2.a.2. Schutzgut Tiere und Pflanzen …………………………………………………… 4 2.a.3. Schutzgut Boden ………………………………………………………………… 5 2.a.4. Schutzgut Wasser ………………………………………………………………... 6 2.a.5. Schutzgut Klima/Luft ……………………………………………………………. 6 2.a.6. Schutzgut Landschaft ……………………………………………………………. 7 2.a.7. Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter ………………………………………. 7 2.a.8. Wechselwirkungen ………………………………………………………………. 8 2.b. Prognosen zur Entwicklung des Umweltzustandes (Entwicklung bei Durchführung der Planung, Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung) ……………………………… 9 2.c. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen ………………………………………………. 9 2.c.1. Schutzgut Mensch ……………………………………………………………….. 10 2.c.2. Schutzgut Tiere und Pflanzen …………………………………………………… 10 2.c.3. Schutzgut Boden ………………………………………………………………… -
Derenburg-Elbingerode.Indd
Von der Pfalz Derenburg in den am Weg Deutscher Kaiser und Könige ® www.harzregion.de Reddeber Minsleben Derenburg Silstedt B 6n Osterholz WERNIGERODE Benzigerode B 81 ® Heimburg B 6n B 244 Michaelstein BLANKENBURG B 27 Eggeröder Elbingerode Brunnen B 27 Hüttenrode Rübeland Bode B 81 Almsfeld Rappbode- Wendefurth Stausee Das Titelbild des fünften in der königsblauen Serie „Natur erleben am Weg Deutscher Kaiser und Könige“ erschienen Faltblatts des Regionalverbandes Harz zeigt einen Blick vom Agnesberg über Derenburg auf den Harz. Allein dieser Blick macht Lust, sich auf eine Wanderung in den Naturpark Harz zu begeben. Unsere Karte zeigt den Verlauf des beschriebenen Teilabschnitts des insgesamt 550 km langen Geschichts- pfades „Wege Deutscher Kaiser und Könige des Mittelalters im Harz“. Wir haben den Namen in Anführungszeichen gesetzt, weil die von den Harz klub- zweigvereinen ausgeschilderte Wander- route nicht überall dem ursprünglichen Verlauf der mittelalterlichen Wege folgt. Spurensuche Wege Deutscher Kaiser und Könige des Mittelalters im Harz Phantasie sollte haben, wer sich heutzutage auf die „Wege Deutscher Kaiser und Könige des Mittelalters im Harz“ begibt. Weder wird uns Einlass und Schutz geboten in der Pfalz Derenburg, noch können wir das Schloss Elbingerode besichtigen. Letzteres wurde bereits im Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) bis auf die Grundmauern zerstört. Der parkartig gestaltete Schlossberg von Elbingerode im Harz eignet sich aber wenigstens als Zielpunkt einer erlebnis- reichen Wanderung. Ausgangspunkt der Wanderung -

Coleopterologische Neu- Und Wiederfunde in Sachsen-Anhalt
© Entomologische Nachrichten und Berichte; downloadEntomologische unter www.biologiezentrum.at Nachrichtenund Berichte, 45,2001/1 37 M. Jung, Athenstedt Coleopterologische Neu- und Wiederfunde in Sachsen-Anhalt Zusammenfassung Seit dem Erscheinen des 1. Nachtrages zum aktuellen Käferverzeichnis von Deutschland wurden durch Eigenaufsammlungen und durch Auswertung umfangreichen Materials des Landesamtes für Um weltschutz Sachsen-Anhalt zahlreiche Arten für Sachsen-Anhalt wiedergefunden. 30 Arten sind neu für Sachsen- Anhalt. Die Chrysomelide Longitarsus languidus wurde erstmals sicher für Deutschland nachgewiesen. Summary New and re-records of Coleoptera in Saxony-Anhalt, Germany.- Since the publication of the first supplement to the beetle checklist of Germany, numerous species have been re-recorded through personal collecting and based on an examination of the material under the care of the Landesamt for Umweltschutz Saxony- Anhalt. 30 species are reported from Saxony-Anhalt for the first time. The first confirmed German record of the chrysomelid Longitarsus languidus ist presented. Seit dem Erscheinen des Verzeichnisses der Käfer ver und Dr. L othar Z erche , DEI Eberswalde für die Deutschlands (K öhler & K lausnitzer 1998) sind Überprüfung bzw. Determination fraglichen Materials. knapp zwei Jahre vergangen. In der Zwischenzeit konn Die Belege befinden sich alle in coll. Jung . ten für das Bundesland Sachsen-Anhalt zahlreiche Ar Auch für die bereits erschienenen Familienbearbeitun ten nach 1950 erstmals wieder nachgewiesen werden, gen innerhalb der Roten Listen Sachsen-Anhalts sind eine ganze Reihe wäre neu für Sachsen-Anhalt, wird diese Nachweise von großer Bedeutung. Mehrere erst aber bereits bei B orchert (1951) in der Käferfauna des mals nachgewiesene Arten sind neu aufzunehmen, bei Magdeburger Raumes für das jetzige Sachsen-Anhalt den Wiedernachweisen ist der Status 0 (verschollen) gemeldet. -

The Natural History of Ooliths: Franz Ernst Brückmann's Treatise of 1721
The Natural History of Ooliths: Franz Ernst Brückmann’s Treatise of 1721 and its Significance for the Understanding of Oolites ROBERT V. BURNE1, J. CHRIS EADE2, & JOSEF PAUL3 1RESEArcH SCHOOL OF EARTH SCIENCES, THE AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY, CANBERRA ACT, AUSTRALIA. E-MAIL: [email protected] 2VISITING FELLOW, CENTRE FOR ASIAN SOCIETIES AND HISTORIES. THE AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY, CANBERRA ACT 0200, AUSTRALIA. E-MAIL: JCEADE@ GMAIL.COM 3ABT. SEDIMENTOLOGIE, UMWELTGEOLOGIE, GEOWISSENSCHAFTLICHES ZENTRUM DER UNIVERSITÄT, GOLDSCHMIDT-STR. 3, 37077 GÖTTINGEN. E-MAIL: JPAUL@ GWDG.DE Schlüsselwörter: Oolithe, Brückmann Keywords: Oolites, Brückmann Zusammenfassung Abstract Franz Brückmann schrieb 1721 seine erste Abhandlung Franz Brückmann wrote his treatise on oolites in 1721. über Oolithe. Wir stellen hier eine Übersetzung des lateinischen We present here an English translation of his Latin text which Originaltextes ins Englische vor. Brückmann beschreibt die describes the following topics; derivation of the name “oolith” Herkunft des Namens Oolith und seine Synonyme; interpretiert and its synonyms; interpretation as accumulations of fish-eggs; Oolithe als Ansammlung von Fisch-Eiern; klassifiziert sie classification as stones; occurrence and diversity; environments als Steine; gibt Auftreten und Häufigkeit an; erklärt das of deposition and processes of lithification; explanations for Ablagerungsmilieu und Prozesse der Versteinerung und die the large quantities of eggs found; evidence for their biological große Menge der gefundenen Eier; beweist ihre biologische origin; evidence for their biological associations; the distinction Herkunft und ihre biologischen Beziehungen; unterscheidet die between ooliths and pisoliths; and localities of occurrence. We Oolithe von den Pisolithen und gibt Orte an, wo sie gefunden provide a commentary on Brückmann’s text, and then review werden. -

Genome-Wide Patterns of Selection in 230 Ancient Eurasians
SUPPLEMENTARY INFORMATION doi:10.1038/nature Archaeological context for 83 newly reported ancient samples Overview This note provides archaeological context information for the 83 samples for which genome-wide data is presented for the first time in this study. Descriptions of the context for the remaining ancient samples analyzed in this study have been published in previous publications. Specific references for each sample are given in Supplementary Data Table 1. Anatolia Neolithic (n=26 samples) Since the 1950’s, central and southeastern Anatolia have been the subject of archaeological research focused on the origins of sedentism and food-production. The Marmara region of northwestern Anatolia, the location of the to archaeological sites that are the sources of the Anatolian samples in this study (Mente!e Höyük and Barcın Höyük) was for a long time considered to be a region where early agricultural development had not occurred. Systematic multidisciplinary research in the eastern Marmara region started at the end of the 1980s under the auspices of the Netherlands Institute for the Near East, Leiden (NINO) and its annex in "stanbul, the Netherlands Institute in Turkey (NIT). The first excavations were at Ilıpınar Höyük near "znik Lake. These were followed by excavations at Mente!e and Barcın, situated near an ancient lake in the basin of Yeni!ehir. These sites have provided key data on early farming communities, their environmental settings, and their cultural development over more than a thousand years, from 6600 calBCE (Barcın) to 5500 calBCE (Ilıpınar). A fourth important site in the same region, Aktopraklık, is being excavated by the Prehistory Department of Istanbul University. -

Amtsblatt Erscheint Monatlich Kostenlos in Einer Auflagenhöhe Von 13.000 Exemplaren
MTSBLATT DER STADT A BLANKENBURG (HARZ) Nr. 08/10 Blankenburg (Harz), 28. August 2010 Jahrgang 1 Blankenburger Stadtrat beschließt Haushaltskonsolidierung Liebe Blankenburgerinnen und Blankenburger, Beispielen finden Sie im Internet auf der waltung. Aber es hilft keine Schuldzuweisung Homepage der Stadt Blankenburg (Harz). und Jammern, die Stadt muss mit den Mit- es gibt für einen Bürgermeister sicherlich Und hier ist nun die besonders ärgerliche Si- teln, die sie erhält oder erwirtschaftet, aus- schönere Aufgaben, als seinen Bürgern ein tuation für Verwaltung und Stadtrat, beson- kommen; sie muss auch jetzt weiter investie- Haushaltskonsolidierungskonzept zumuten ders aber für mich. Ich hatte bei allen Diskus- ren, Pflichtaufgaben erfüllen, soziale Aufgaben zu müssen. Aber auch unangenehme Dinge sionen während der Eingemeindungsphase leisten, reparieren oder Ziele umsetzen kön- gehören nun einmal zum Leben und deshalb versprochen, die Steuern sind für 10 bzw. 5 nen. Dieser Verantwortung mussten wir, mus- möchte ich Sie aus erster Hand informieren. Jahre fest. Dies wurde auch so in die Verträge ste ich als Bürgermeister, gerecht werden. Der Stadtrat hat in einer Sondersit- Die Gemeinden wären bei weiterer zung am 19. August 2010 einen Sa- Selbständigkeit (ohne Eingemein- nierungsplan für den Haushalt un- dung) sicher auch zu Steuererhö- serer Stadt bis zum Jahre 2017 be- hungen gezwungen gewesen, da die schlossen. Er hat dies mit sehr großer äußeren Wirkungen keine andere Mehrheit (24 Ja- und 3 Nein-Stim- Wahl lassen. men) und in sachlicher, konstruktiver Dies wurde getan, gemeinsam und Atmosphäre getan. Dies hat gezeigt, mit Blick in die Zukunft. Unser Kon- dass auch in einer schwierigen Lage solidierungskonzept ist inzwischen der Stadtrat Verantwortung in großer von der Kommunalaufsicht geprüft Gemeinsamkeit übernimmt und dass und genehmigt worden, die Stadt ist die uns Blankenburgern früher nach- damit weiter handlungsfähig.