Derenburg-Elbingerode.Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
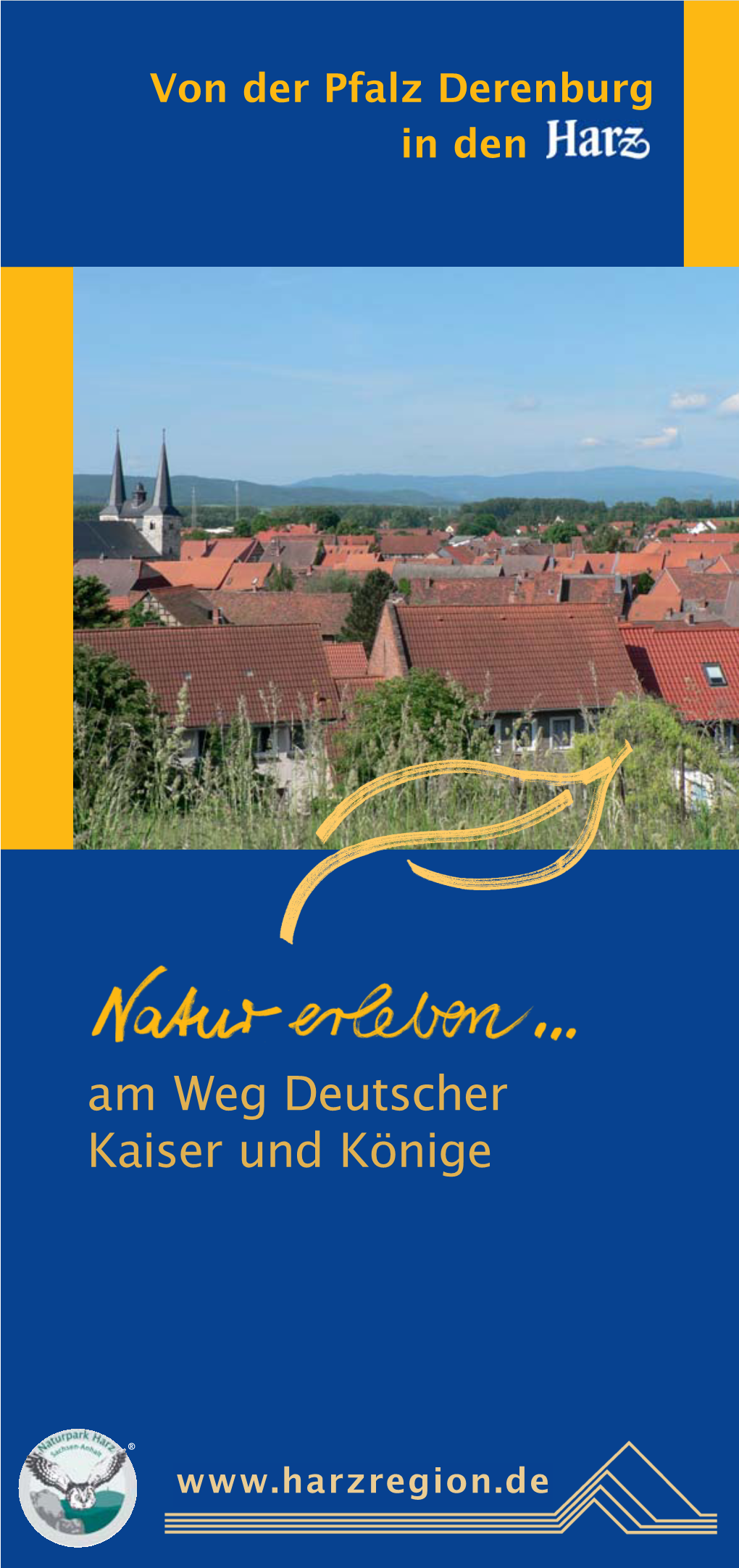
Load more
Recommended publications
-

Broschüre – Die Justiz in Sachsen-Anhalt
DIE JUSTIZ in Sachsen-Anhalt Inhalt Die Justiz in Sachsen-Anhalt 2 Die Justiz in Sachsen-Anhalt Vorwort Vorwort 3 1 Die Verfassungsgerichtsbarkeit 4 2 Die ordentliche Gerichtsbarkeit 6 Nr. Inhaltsverzeichnis Seite 3 Die Verwaltungsgerichtsbarkeit 10 Vorwort Seite 3 4 Die Sozialgerichtsbarkeit 12 5 Die Arbeitsgerichtsbarkeit 14 1 Die Verfassungsgerichtsbarkeit Seite 4 6 Die Finanzgerichtsbarkeit 16 7 Die Staatsanwaltschaften 18 2 Die ordentliche Gerichtsbarkeit Seite 6 Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 8 Die Justizvollzugsbehörden 20 3 Die Verwaltungsgerichtsbarkeit Seite 10 9 Der Soziale Dienst der Justiz 22 eine der Grundsäulen unseres demokratisch verfassten Gemeinwesens ist ein funkti- 10 Ehemalige Städte und Gemeinden 4 Die Sozialgerichtsbarkeit Seite 12 onierender Rechtsstaat. Für ihn arbeiten Gerichte und Staatsanwaltschaften, um dem und ihre jetzigen Bezeichnungen 24 Recht Geltung zu verschaffen. 11 Zuordnung der Städte und Gemeinden zu den Bezirken der Gerichte und 5 Die Arbeitsgerichtsbarkeit Seite 14 Staatsanwaltschaften 61 Ihnen liegt hier eine Broschüre vor, die für jede Stadt und Gemeinde in Sachsen-An- halt auflistet, welches Gericht beziehungsweise welche Staatsanwaltschaft für den 12 Anschriftenverzeichnis der Gerichte und 6 Die Finanzgerichtsbarkeit Seite 16 jeweiligen Ort zuständig ist. Die Gerichtsstrukturen orientieren sich an den Verwal- Justizbehörden des Landes Sachsen-Anhalt 76 tungseinheiten, wie sie die Kreisgebietsreform aus dem Jahr 2007 vorgibt. Sie als 87 Impressum 7 Die Staatsanwaltschaften Seite 18 Bürger finden damit eine Behörden- und Justizstruktur vor, die überschaubar und einheitlich ist. 8 Die Justizvollzugsbehörden Seite 20 Die vorliegende Broschüre soll Ihnen helfen, den grundsätzlichen Aufbau des „Dienst- leistungsbetriebes Justiz“ besser zu verstehen. Sie beinhaltet Informationen zu allen 9 22 Der Soziale Dienst der Justiz Seite Gerichten und Staatsanwaltschaften in unserem Bundesland. -

Tourenplan Papierbehälter 120 L / 240 L Altpapier 22
TOURENPLAN Papierbehälter 120 l / 240 l Altpapier 22 07.01. Tour 1: Stadtgebiet Blankenburg A 03.02. lbert-Schneider-Straße, Albrechtstraße, Alte Halberstädter Straße, Amalienstraße, Am Hang, Am Helsunger Weg, Am Schäferplatz, Amselweg, 03.03. Am Thie, An der Wasserstelle, Asternweg, Badegasse, Bahnhofstraße, 31.03. Bährstraße, Bartholomäikirchhof, Bäuersche Straße, Bergstraße, Birkental, Registerfeld 28.04. Börnecker Straße, Dr.-Jasper-Straße, Elisabethstraße, Fichtestraße, Finkenherd, 27.05. Fliederweg, Forstmeisterweg, Friedrich-August-Straße, Gärtnerweg, Gehren komplett, Georg-Schultz-Straße, Georgstraße, Gewerbegebiet 23.06. Lerchenbreite, Gnauck-Kühne-Straße, Großvaterweg, Grüne Gasse, 21.07. Harlippenstraße, Harzstraße, Hasselfelder Straße, Heidelberg, Heinrichsweg, In die Papierbehälter gehören: 18.08. Helenenstraße, Helsunger Straße, Herderstraße, Herwegstraße, Herzogstraße, Briefumschläge, Broschüren, Bücher, Eierschachteln aus Pappe, 15.09. Herzogsweg, Hinter dem Rathaus, Hohe Straße, Hospitalstraße, Kataloge, Prospekte, Schreibpapier, Schulhefte, Verpackungen 13.10. Husarenstraße, Kallendorfer Weg, Karlstraße, Katharinenstraße, aus Karton, Papier und Pappe, Zeitschriften, Zeitungen. Knockestraße, Krumme Straße, Kuno-Rieke-Straße, Lange Straße, 10.11. Lessingplatz, Lessingstraße, Lindestraße, Liststraße, Löbbeckestraße, Bitte beachten Sie, dass der Behälter nicht ausschließlich mit 08.12. Lühnergasse, Lühnertorplatz, Mahnerstraße, Marienstraße, Markt, Katalogen und Büchern befüllt wird, da dieser sonst zu schwer ist Marktstraße, -

Bürger-Nachrichtenbürger-Nachrichten Der SPD-Ortsverein Im Dialog * Jahrgang 7 * Ausgabe 1 * Juni 2009 40 Leere Stühle
Bürger-NachrichtenBürger-Nachrichten Der SPD-Ortsverein im Dialog * Jahrgang 7 * Ausgabe 1 * Juni 2009 40 leere Stühle ...warten im Rathaussaal unserer Stadt darauf, nach der Kom- munalwahl von den neu gewählten Mitgliedern des Stadtrates besetzt zu werden. Die Parteien und Vereinigungen haben ihre Listen und Programme aufgestellt und die Wahlberechtigten müssen am 07. Juni entscheiden, wer - in den bescheidenen Grenzen der kommunalen Selbstverwaltung - die Geschicke der Stadt einschließlich der Ortschaften in den nächsten fünf Jahren bestimmen soll. Welche neuen Mehrheiten und Bünd- nisse wird es geben? www.spd-wernigerode.de Seite 1 Freie Wahlen – ein demokratisches Grundrecht Liebe Bürgerinnen und Bürger, bereits zum 5. Mal nach der politischen Wende 1989/90 finden am 7. Juni 2009 freie Kommunalwah- len statt - also die Wahlen zum Stadtrat, zu den Ort- schaftsräten Minsleben, Silstedt, Schierke und Benzin- gerode sowie zur Europawahl. Dass wir wirklich aus- wählen können, zeigt die große Anzahl von Kandida- tinnen und Kandidaten, die von den Parteien und Wäh- lervereinigungen nominiert wurden. Insgesamt kandi- dieren für den Stadtrat Wernigerode 101, für den Ort- schaftsrat Minsleben acht, für den Ortschaftsrat Sils- tedt sieben, für den Ortschaftsrat Schierke zwölf, für den Ortschaftsrat Benzingerode neun Bürgerinnen und Bürger. Allein schon diese große Anzahl von Kandidatinnen und Kandidaten unterstreicht die hohe Bereitschaft unter den Bürgerinnen und Bürgern, für die Selbstverwaltung unserer „Bunten Stadt am Harz" und ihrer Ortsteile persönlich politische Verant- wortung zu übernehmen. Für diese Bereitschaft möchten wir diesen Damen und Herren herzlich danken. Die Persönlichkeiten, die sich zur Wahl der 40 Sitze im Stadtrat und der 28 Sitze in den Ortschaftsräten bewerben, haben ein breites Votum der Wählerinnen und Wähler verdient. -

Rettungsdienstbereichsplan Vom
Rettungsdienstbereichsplan Landkreis Harz (Lesefassung – beinhaltet die 1. Satzung zur Änderung der Satzung vom 10.11.2016, die 2. Satzung zur Änderung des Rettungsdienstbereichsplanes vom 14.12.2017 sowie die 3. Satzung zur Änderung des Rettungsdienstbereichsplanes vom 15.03.2018) Rettungsdienstbereichsplan für den Landkreis Harz Präambel Auf Grundlage der §§ 8, 45 Abs. 2 Ziffer 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) i.V.m. § 7 Abs. 2 des Rettungsdienstgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (RettDG-LSA) vom 18.12.2012 (GVBl. LSA S. 624) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Kreistag des Landkreises Harz am 03.12.2014 zur Sicherstellung des bedarfsgerechten und flächendeckenden Rettungsdienstes für den Rettungsdienstbereich Landkreis Harz nachfolgenden Rettungsdienstbereichsplan als Satzung beschlossen: § 1 Aufgaben, Geltungsbereich, Trägerschaft Der Rettungsdienst ist gem. § 2 Abs. 2 RettDG LSA als Bestandteil der Daseinsvorsorge eine öffentliche Aufgabe der Gesundheitsvorsorge und der Gefahrenabwehr und wirkt beim Katastrophenschutz mit. Er umfasst die Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung, der qualifizierten Patientenbeförderung sowie der rettungsdienstlichen Bewältigung eines Ereignisses mit einer großen Anzahl von erkrankten oder verletzten Personen. Auf der Grundlage des § 7 Abs. 2 RettDG LSA ist zur Gewährleistung der flächendeckenden Versorgung für jeden Rettungsdienstbereich ein Rettungsdienstbereichsplan als Satzung zu beschließen und in regelmäßigen Zeitabständen fortzuschreiben. Der vorliegende Rettungsdienstbereichsplan regelt die bedarfsgerechte rettungsdienstliche Infrastruktur und die wirtschaftliche und effiziente Durchführung eines flächendeckenden Rettungsdienstes im Landkreis Harz. Der Rettungsdienstbereichsplan gilt für den Rettungsdienstbereich Harz, der das Gebiet des Landkreises Harz umfasst. In ihm werden grundsätzliche Festlegungen zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Rettungsdienstes im Landkreis Harz getroffen. -

1/110 Allemagne (Indicatif De Pays +49) Communication Du 5.V
Allemagne (indicatif de pays +49) Communication du 5.V.2020: La Bundesnetzagentur (BNetzA), l'Agence fédérale des réseaux pour l'électricité, le gaz, les télécommunications, la poste et les chemins de fer, Mayence, annonce le plan national de numérotage pour l'Allemagne: Présentation du plan national de numérotage E.164 pour l'indicatif de pays +49 (Allemagne): a) Aperçu général: Longueur minimale du numéro (indicatif de pays non compris): 3 chiffres Longueur maximale du numéro (indicatif de pays non compris): 13 chiffres (Exceptions: IVPN (NDC 181): 14 chiffres Services de radiomessagerie (NDC 168, 169): 14 chiffres) b) Plan de numérotage national détaillé: (1) (2) (3) (4) NDC (indicatif Longueur du numéro N(S)N national de destination) ou Utilisation du numéro E.164 Informations supplémentaires premiers chiffres du Longueur Longueur N(S)N (numéro maximale minimale national significatif) 115 3 3 Numéro du service public de l'Administration allemande 1160 6 6 Services à valeur sociale (numéro européen harmonisé) 1161 6 6 Services à valeur sociale (numéro européen harmonisé) 137 10 10 Services de trafic de masse 15020 11 11 Services mobiles (M2M Interactive digital media GmbH uniquement) 15050 11 11 Services mobiles NAKA AG 15080 11 11 Services mobiles Easy World Call GmbH 1511 11 11 Services mobiles Telekom Deutschland GmbH 1512 11 11 Services mobiles Telekom Deutschland GmbH 1514 11 11 Services mobiles Telekom Deutschland GmbH 1515 11 11 Services mobiles Telekom Deutschland GmbH 1516 11 11 Services mobiles Telekom Deutschland GmbH 1517 -

Geologischen Karte
‘. i "W" Vs“??? H 14‘.) 22..“ . 49/3 . 5‘006“ Erläuterungen Geologischen Karte V011 Preußen und benachbarten Bundesstaaten. IIerausgegeben von der Königlich Preußischen Geologischen Landesanstalt Lieferung 174. Blatt Vienenburg. Gradabteilung 56, N0. 2. Geologisnh bearbeitet und erläutert durch H. Schroeder. \J\\\\}’\/ \4\/\‚\/\ \4\.\/\\ „xvxx \\I\‘ BERLIN. Im Vertrieb bei der Königlichen Geologischen Landesanstalt Berlin N. 4, Invalidenstraße 44. 1912. C „i; aaaaaaaaaaaaaan Königliche Universitäts— Bibliothek zu Göttingen. Geschenk g des Kgl. Ministeriums der geistlichen, Unterrichts— und Med.-Angelegenheiten zu Berlin. ä 19 1.3 Ü.raaa Blatt Vienenburg. 0 Gradabteilung 56 (Breite 221—5, Länge 280(29 0), Blatt Nr. 2. Geologisch bearbeitet und erläutert durc'h H. Schroodor. SUB Göttlngen 7 209 629 223 i l n ‚‘J ‚1|, ‘ 1|; l I f l‘vl " 3‘W2 'l|I “. 1» (l “Ä „ w L, H: [l “ „b ‘l ' „u ‘ ‘ Ä ‘ 'I l v“l l i ' I1:. ‚' ll'v l J 5a.‘l ‘s l II III H ‘ Oberflächengestaltung. Blatt Vienenburg liegt zum größten Teil in der Provinz Hannover und zum kleineren Teil mit dem östlichen Drittel in der Provinz Sachsen. Im Süden gehören die Gemeinden Har- lingerode, Schlewecke, Westerode, Bettingerode und eine YVald- parzelle >>Unterer Schimmerwald<< zu Braunschweig. Die Oberflächengestaltung des Blattes Vienenburg wird durch den Gegensatz einmal der alluvialen breiten Talsohlen zu den diluvialen Terrassenfläbhen und dann durch den Ge- gensatz beider zu den über sie herausragenden, aus älteren Gesteinen bestehenden Höhenr-ücken charakterisiert. Der größte Teil des Blattes gehört dem z. T. fast ebenen oder nur flachwelligen Gebiet an, das in geologischer Hinsicht als \subherzyne Kreidemulde bezeichnet wird. -

Strukturerfassung in Ausgewählten Waldgesellschaften Im Nationalpark Harz (Sachsen-Anhalt)
Mitt. florist. Kart. Sachsen-Anhalt (Halle 2005) 10: 3-28 3 Strukturerfassung in ausgewählten Waldgesellschaften im Nationalpark Harz (Sachsen-Anhalt) Gunter Karste, Rudolf Schubert, Hans-Ulrich Kison und Uwe Wegener 1 Einleitung Die Ausweisung von Nationalparken innerhalb der mitteleuropäischen Kulturlandschaft bietet die einmalige Chance, Strukturveränderungen in anthropogen überprägten aber auch in den Resten naturnaher Lebensräume zu erfassen. Vor allem Pflanzengesellschaften als wichtige Strukturkomponenten der Ökosysteme geben wichtige Hinweise zum Zustand der verschiedenen Lebensraumtypen (Ellenberg 1996). Re gelmäßige pflanzensoziologische Untersuchungen können somit quantitative wie qualitative Veränderungen in den Lebensräumen aufzeigen. Dazu wurden zunächst die Farn- und Blüten pflanzen des Nationalparks Hochharz erfasst (K iso n & W e rn e c k e 2004) und darüber hinaus flächendeckend die Pflanzengesellschaften. Im Ergebnis der Vegetationskartierung konnte u. a. festgestellt werden, dass ein Nebeneinan der von großflächigen Fichtenmonokulturen und einer Vielzahl kleinflächiger Relikte der natür lichen Waldgesellschaften existiert. Die im Zuge der Vegetationskartierung erfassten Reste naturnaher Pflanzengesellschaften können als Leitgesellschaften gesehen werden, die Prog nosen zu einer möglichen Naturdynamik erlauben. Auch wenn wir annehmen, dass die Reste naturnaher Pflanzengesellschaften optimal an ihren Standort angepasst sind und damit möglicherweise einen gewissen Konkurrenzvorteil gegen über den anthropogen geprägten -

Niedeckens Stefanie Heinzmann •Jamie-Lee
AMTSBLATT STADT WERNIGERODE Tickets SAMSTAG 03.09.2016 ab 13,20 Euro 16 bis 23 Uhr an allen bekannten im Bürgerpark Vor ver kaufs stellen! Wernigerode NIEDECKENS STEFANIE HEINZMANN •JAMIE-LEE Wernigerode, 30. Juli 2016 24. Jahrgang // Nr. 08/16 MDR HARZ OPEN AIR geht in die fünfte Runde ... Die Besetzung für das MDR HARZ OPEN AIR am Samstag, den 3. September 2016 im Bürgerpark Wernigerode steht. Bei dem vermutlich größten Event in Wernigerode sind in diesem Jahr neben Haupt-Act NIEDECKENS BAP auch STEFANIE HEINZMANN und JAMIE-LEE sowie 108 FAHRENHEIT anzutreffen. NIEDECKENS BAP IST HÖHEPUNKT DES ABENDS STEFANIE HEINZMANN WEITERE HÖHEPUNKTE Seit mehr als 40 Jahren besteht die Kölsch-Rock- Stefanie Heinzmann sang drei Jahre in der Band Außerdem an Bord ist die Leipzig-Dresdner Band band und gehört damit zu den erfolgreichsten BigFish, bis die Schweizerin 2008 durch eine Cas- 108 FAHRENHEIT. Das Publikum kann sich auf eine deutschen Bands. Ihren ersten Hit feierten sie 1980 ting Show entdeckt wurde. Seitdem begeistert sie deutschsprachige Musikmischung aus Rock, Pop, mit »Wahnsinn«. Es folgten mehr als 18 Studioal- mit ihrer soulig, rockigen Musik. 2015 erschien ihr Acoustic, Country und Folk freuen. ben. Im März 2012 erhielt Wolfgang Niedecken viertes Studioalbum »Chance Of Rain«. Mit der Damit auch Familien und Kinder auf ihre Kos- den Musikpreis »Echo« für sein Lebenswerk. Auf Single »In The End« feierte sie im letzten Jahr ihr ten kommen, sorgt die Band PLANET Ö mit ihren dem neusten Album »Lebenslänglich« fließen jede Comeback. originellen, witzigen und manchmal auch ernsten Menge positive Erfahrungen ein, die Wolfgang Kinderliedern für gute Stimmung. -

WANDERN IM HARZ WANDERN (Hier Fehlt N Ch Die
WANDERN IM HARZ WANDERN (hier fehlt n ch die Harzklub Tanne) IM HARZ Wander e Wanderungen für fürjedermann jederma 2019/20205 Fe ruar 20 is Dezem er von März 20195 bis März 2020 5 mit Wan erf rer mit Wanderführern derder Harzklub-ZweigvereineHarzkl -Zwei erei e WanWanderungenderungen unter fachkundigerf chkundi er Führung Führung Herausgeber: Harzklub e.V. HerAmausge Alten er: Bahnhof Harzkl 5a e V 38678Ba Clausthal-Zellerfeldfstraße 5a Cla st al-Zellerfeld Tel. 0 53 23 / 8 17 58 • Fax 0 53 23 / 8 12 21 Tel : 0 53 23 / 8 17 58 • Fax 0 53 23 / 8 12 21 Homepage: www.harzklub.de HomE-Mail:epage: ttp://[email protected] arz lu e E-Mail: i f @ arzkl de Titelfoto: Zweigverein Lamspringe Wo steht was? Vorwort 4 Allgemeine Harzklub-Termine 8 Tipps für alle 13 Mehrtages- und Wochenendwanderungen 17 Regelmäßig wiederkehrende Wanderungen 17 Wanderungen am Grünen Band 19 Tageswanderungen 20 Sonntagswanderungen im Karstgebiet 112 Was bietet und leistet der Harzklub? 121 Hinweise und Auskünfte 124 Orientierung 128 UTM-Daten 129 Wanderheime des Harzklubs 131 Wander-Fitness-Pass und Deutsches Wanderabzeichen 133 Harzklub-Hauptverein 134 Ansprechpartner der Zweigvereine 137 Wandergaststätten 143 Beitrittserklärung mit Abo-Bestellung "Der Harz" 153 Wanderheft „Wanderungen für jedermann 2019“ mit dem Harzklub e.V. Vorwort des Präsidenten - 30 Jahre „Freier Brocken“ Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde, sehr geehrte Freunde des Harzes, der Harzklub e.V. ist mit seinen 87 Zweigvereinen und 13.000 ehrenamtlichen Mitgliedern flächendeckend im gesamten Harz, in den drei Bundesländern Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aktiv. Seit der Gründung im Jahre 1886 war und ist es der Harzklub, welcher die Grundlagen dafür geschaffen hat, dass der Harz zu einer attraktiven Wanderregion wurde. -

DWT 2014 - MI 06 Durch Sagenumwobene Bergwildnis Zum Höchsten Berg Norddeutschlands
Wandern, Mountainbiking DWT 2014 - MI 06 Durch sagenumwobene Bergwildnis zum höchsten Berg Norddeutschlands Länge: 14 km Start: • Wernigerode OT Hasserode – Haltestelle der Buslinien 1 Steigung:+ 1065 m / - 0 m und 4 (Floßplatz) - UTM: 32 U 0620090 5742340 Dauer: ca. 9 Stunden Ziel: Wernigerode - Hauptbahnhof Überblick im Brockenbett, das der Ilse. Die abgerundete Kuppe des Brockens ist baum frei, aber mit Harzklub-Wandertipp zum Deutschen Wandertag 2014. Zwergstrauchheide bewachsen. Hinweis: Die Wanderführer behalten sich vor, beim offiziellen DWT-Termin die Tour bei Bedarf zu modifizieren. Nebenkuppen des Brockens sind unter anderem die Heinrichshöhe (ca. 1045 m) im Südosten, der Königsberg (1033,5 m) im Südwesten und der Kleine Brocken (1018,4 m) im Norden. Der Brocken und sein Umfeld, das Brockenmassiv, bestehen aus geologischer Sicht vorwiegend aus Granit (dem so genannten Brockengranit), einem plutonischen Gestein. Die Granitplutone des Harzes, der Brocken-, der Ramberg- und der Oker-Pluton, entstanden gegen Ende der plattentektonisch verursachten Harz-Gebirgsbildung Brockenkuppe im Oberkarbon vor rund 293 Millionen Jahren. Zunächst drangen basische Gesteinsschmelzen in die überlagernden Tourbeschreibung Sedimente ein, kristallisierten dort aus und bildeten Gabbro- und Dioritmassive, beispielsweise den Harzburger Gabbro. Floßplatz – Steinerne Renne – Hölle – Steilaufstieg zum Etwas später stiegen kieselsäurereiche, granitische Renneckenberg – Brocken 1141 m – Besuch des Schmelzen auf, die zum Teil in Hohlräume und Fugen der Brockenmuseums – Brockenrundweg – Rückfahrt mit der älteren Gesteine eindrangen, sich aber überwiegend durch Harzer Schmalspurbahn – Dampflok – nach Wernigerode Hbf. Aufschmelzen der vorhandenen Sedimente Platz schufen. Im Grenzbereich zwischen Granit und Nebengestein, der Der Brocken ist mit 1141,1 m ü. NN der höchste Berg im sogenannten Kontaktzone, können vielfältige Übergänge Norden Deutschlands und des Mittelgebirges Harz. -

The Lohmeyer Families !"#$%&'#()*+,+&#-+).*"*&#/01234050670
The Lohmeyer Families !"#$%&'#()*+,+&#-+).*"*&#/01234050670# Reflecting on the meaning of the surname, it is possible that different Lohmeyer families arose simultaneously and independently from each other in different places. “Loh” means ‘forest’, specifically ‘oak forest’. Lohmeyer is therefore the farmer whose farm is located in or at the forest edge. A thousand years ago, the land on the lower Weser river was all covered with forest. When the Saxons came to cultivate the land, they first needed to burn and clear the forest before the land could be made arable. In northern Westfalia, even today2, there are often no closed villages, but every farm is located centrally to its landholdings, often ! hour from his nearest neighbour. Certainly, the word “loh” is purely of lower saxon origin3. The families named Lohmeyer, Lohmeier and Lomeier must therefore all originate from the Provinces Westfalia and Hannover and I have been successful in localising most of the families to that area, eight families even to the region close to Minden on the Weser. It is therefore not impossible that, had church records survived the time of the 30 Years War and had they existed before the ‘Bauernkriege’4, one might be able to prove a closer linkage between some of these families. To date, I am aware of the following 16 Lohmeyer families:5 1. MY father was originally ‘königlich dänischer Landbauinspektor’ and later ‘königlich preussischer Baurat für das Herzogtum Lauenburg’6, not to be confused with Carl Lohmeier, who was ‘Landbauinspektor’ of the Grand-Duke of Mecklenburg-Strelitz, lived about 40 years earlier and who belonged to Family 7. -
Wernigerode Castle
Landmark 8 Wernigerode Castle ® On the 17th of November, 2015, during the 38th UNESCO General Assembly, the 195 member states of the United Nations resolved to introduce a new title. As a result, Geoparks can be distinguished as UNESCO Global Geoparks. Among the fi rst 120 UNESCO Global Geoparks, spread throughout 33 countries around the world, is Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen. UNESCO-Geoparks are clearly defi ned, unique areas, in which locations and landscapes of international geological importance are found. They are operated by organisations which, with the involvement of the local population, campaign for the protection of geological heritage, for environmental education and for sustainable regional development. 22 Königslutter 28 ® 1 cm = 16,15 miles 20 Oschersleben 27 18 14 Goslar Halberstadt 3 2 8 1 QuedlinburgQ 4 OsterodeOsterodedee a.H.a.Ha 9 11 5 131 15 16 6 10 17 19 7 Sangerhausen NordhausenNdh 12 21 As early as 2004, 25 Geoparks in Europe and China had founded the Global Geoparks Network (GGN). In autumn of that year Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen became part of the network. In addition, there are various regional networks, among them the European Geoparks Network (EGN). These coordinate international cooperation. In the above overview map you can see the locations of all UNESCO Global Geoparks in Europe, including UNESCO Global Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen and the borders of its parts. Historism 1 Wernigerode Castle Originally, a medieval fortress crowned the promontory of the Agnesberg. After the devastating ravages of the 30-Years-War (1618 – 1648), the work of reconstructing the fortress as a Baroque residence castle began under the Count ERNST OF STOLBERG-WERNIGERODE (1716 – 1778).