Diplomarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Download (2216Kb)
A Thesis Submitted for the Degree of PhD at the University of Warwick Permanent WRAP URL: http://wrap.warwick.ac.uk/150023 Copyright and reuse: This thesis is made available online and is protected by original copyright. Please scroll down to view the document itself. Please refer to the repository record for this item for information to help you to cite it. Our policy information is available from the repository home page. For more information, please contact the WRAP Team at: [email protected] warwick.ac.uk/lib-publications ‘AN ENDLESS VARIETY OF FORMS AND PROPORTIONS’: INDIAN INFLUENCE ON BRITISH GARDENS AND GARDEN BUILDINGS, c.1760-c.1865 Two Volumes: Volume I Text Diane Evelyn Trenchard James A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Warwick, Department of History of Art September, 2019 Table of Contents Acknowledgements ………………………………………………………………. iv Abstract …………………………………………………………………………… vi Abbreviations ……………………………………………………………………. viii . Glossary of Indian Terms ……………………………………………………....... ix List of Illustrations ……………………………………………………………... xvii Introduction ……………………………………………………………………….. 1 1. Chapter 1: Country Estates and the Politics of the Nabob ………................ 30 Case Study 1: The Indian and British Mansions and Experimental Gardens of Warren Hastings, Governor-General of Bengal …………………………………… 48 Case Study 2: Innovations and improvements established by Sir Hector Munro, Royal, Bengal, and Madras Armies, on the Novar Estate, Inverness, Scotland …… 74 Case Study 3: Sir William Paxton’s Garden Houses in Calcutta, and his Pleasure Garden at Middleton Hall, Llanarthne, South Wales ……………………………… 91 2. Chapter 2: The Indian Experience: Engagement with Indian Art and Religion ……………………………………………………………………….. 117 Case Study 4: A Fairy Palace in Devon: Redcliffe Towers built by Colonel Robert Smith, Bengal Engineers ……………………………………………………..…. -

The International Society for Iranian Studies
THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR IRANIAN STUDIES www.iranianstudies.com ISIS Newsletter Volume 36, Number 1 May 2015 EDITOR’S NOTE Dear ISIS Members, The new year has begun with hopeful news of an agreement on the repercussions on the work of our organization and its members in the United States, in Iran, and beyond. It has also begun with new leadership at ISIS, as incoming president Touraj Atabaki has taken the reins from Mehrzad followed by excerpts of speeches given at the recent symposium honoring Professor Ehsan Yarshater on the occasion of his 95th birthday, a highly vivid report of the recently held symposium “Hedayat in Mumbai,” research, member and dissertation news, a list of recently published monographs in Iranian Studies, and much more. We hope you will enjoy the many contributions so generously provided by members of our vibrant community. Finally, a friendly reminder that members can now submit panel, roundtable and paper abstracts for the ISIS 2016 Conference to be held in Vienna by logging in to the ISIS website and following the instructions for submission and conference pre-registration. Warm regards, Mirjam Künkler, Princeton University PRESIDENT’S NOTE It has been a privilege to be trusted by the members of the International Society for Iranian Studies to assume the position of the Presidency of an academic institution, which, with nearly fifty years of history, stands out as one of the oldest associations of its kind in West Asian studies. It is also a privilege to assume the position of the Presidency of the society, when the past-president, in this case my good friend Mehrzad Boroujerdi, has left a management system that eases my tasks enormously. -
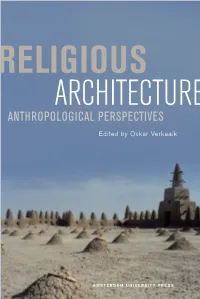
RELIGIOUS Architecture
RELIGIOUS RELIGIOUS Religious Architecture: Anthropological Perspectives develops new anthropological perspectives on religious architecture, including mosques, churches, temples and synagogues. Borrowing from a range of theoretical perspectives on space-making and material religion, this volume looks at how religious buildings take their RELIGIOUS place in opposition to the secular surroundings and the neoliberal city; how they, as evocations of the sublime, help believers to move beyond the boundaries of modern subjectivity; and how international heritage status may conflict with their function as community centres. The volume includes contributions from a range of anthropologists, ARCHITECTURE ARCHITECTURE social historians, and architects working in Brazil, India, Italy, Mali, the Netherlands, Russia, Spain, and the UK. ANTHROPOLOGICAL PERSPECTIVES Oskar Verkaaik is Associate Professor of Anthropology at the Edited by Oskar Verkaaik University of Amsterdam. “Compelling and thought provoking collection of essays by anthropologists on religious architecture that shed new theoretical light on the relation between the material and immaterial in the realm of religion in our so-called secular world.” Jojada Verrips, em. professor of Cultural anthropology, University of Amsterdam Verkaaik (ed.) Verkaaik ISBN 978 90 8964 511 1 AMSTERDAM UNIVERSITY PREss • www.AUP.NL AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS religious architecture Religious Architecture.indd 1 26-08-13 20:32:52 Religious Architecture.indd 2 26-08-13 20:32:52 Religious Architecture Anthropological Perspectives Edited by Oskar Verkaaik Religious Architecture.indd 3 26-08-13 20:32:52 Cover illustration: View across the Mosque’s roofscape of skylights or vents and towering pinnacles (Trevor Marchand) Cover design: Studio Jan de Boer, Amsterdam Lay-out: V3-Services, Baarn Amsterdam University Press English-language titles are distributed in the us and Canada by the University of Chicago Press. -

Austria Kultur International Jahrbuch Der Österreichischen Auslandskultur 2015
Austria Kultur International Jahrbuch der Österreichischen Auslandskultur 2015 Austria Kultur International Jahrbuch der Österreichischen Auslandskultur 2015 Austria Kultur International Jahrbuch der Österreichischen Auslandskultur 2015 Svenja Deininger, Untitled, Öl auf Leinwand, 53 x 43 cm, 2015 Inhalt Die Auslandskultur – Grundlage für gute internationale Beziehungen Sebastian Kurz, Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres 13 Die Auslandskultur 2015 – Im kulturellen Dialog aufeinander zugehen Teresa Indjein, Leiterin der Kulturpolitischen Sektion im BMEIA 15 Europäische Kulturdiplomatie. Chancen und Herausforderungen Martin Rauchbauer, Abteilung für multilaterale Kulturpolitik im BMEIA 19 Vier Jahre Einsatz für Menschrechte, Bildung und Schutz des Welterbes: Österreichs Mitgliedschaft im UNESCO-Exekutivrat 2011–2015. Ein Resümee Harald Stranzl, Botschafter an der Ständigen Vertretung Österreichs bei der UNESCO in Paris 23 KULTURELLE NACHBARSCHAFT Nähe, die gepflegt werden muss – Kulturarbeit in Tschechien Natascha Grilj, Direktorin des Österreichischen Kulturforums Prag 29 Kulturjahr Österreich – Serbien 2015 Nicolaus Keller, Direktor des Österreichischen Kulturforums Belgrad 33 60 Jahre Zagreb, 50 Jahre Warschau – Erfolgreiche Jahrzehnte der Auslandskulturarbeit in der Nachbarschaft Georg-Christian Lack, Direktor des Österreichischen Kulturforums Zagreb Martin Meisel, Direktor des Österreichischen Kulturforums Warschau 37 SPRACHE, WISSENSCHAFT UND BILDUNG Das Österreich Institut: Sprache als Kulturgut Katharina Körner, Geschäftsführerin -

Universalmuseum Joanneum Presse Michael Kienzer Biografie
Universalmuseum Joanneum Presse Universalmuseum Joanneum [email protected] Mariahilferstraße 4, 8020 Graz, Austria Telefon +43-316/8017-9211 www.museum-joanneum.at Michael Kienzer Biografie Michael Kienzer wurde am 21.6.1962 in Steyr, Oberösterreich, geboren. 1970 übersiedelt er nach Graz, wo er von 1977-1979 die Kunstgewerbeschule besucht und bei Josef Pillhofer studiert. Von 1979-1982 lebt er in Berlin, wo er im Kunst- und Kulturzentrum Kreuzberg mitarbeitet. Drei Jahre später, 1985, hat er seine erste Einzelausstellung in der Galerie Peter Pakesch in Wien, stellt das erste Mal in der Neuen Galerie in Graz aus und erhält seine ersten Preise. Von 1987–1989 entwirft er einige Bühnenbilder. Michael Kienzer ist seit den 1980er-Jahren in zahlreichen nationalen und internationalen Einzel- und Gruppenausstellungen vertreten, begleitet von regelmäßigen Preisverleihungen, wie zum Beispiel dem Otto-Mauer-Preis 2001. Preise & Stipendien 2011 International Studio & Curatorial Program (ISCP), New York 2010 Anerkennungspreis des Landes Niederösterreich für Kunst im öffentlichen Raum 2008 Viktor-Fogarassy-Preis, Graz 2001 Otto-Mauer-Preis, Wien 2000 Kunstpreis der Stadt Graz 1997 Rom-Stipendium des BKA, Wien 1993 Hauptpreis beim österreichischen Grafikwettbewerb Innsbruck Preis für bildende Kunst der Diözese Graz-Seckau 1992 Staatsstipendium für bildende Kunst 1989 Förderungspreis des Landes Oberösterreich für bildende Kunst 1985 Förderungspreis des Landes Steiermark für zeitgenössische Kunst (3. Rang) Förderungspreis der Stadt Graz für Kunst -

Pubdat 248970.Pdf
Diplomarbeit Büro sucht Anschluss Einbindung eines Bürohauses in sein städtebauliches Umfeld ausgeführt zum Zwecke der Erlangung des akademischen Grades eines Diplom-Ingenieurs unter der Leitung von Univ.Prof. Dipl.-Arch. Astrid Staufer Mitbetreuung Univ.Ass. Dipl.-Arch. Ivica Brnic E253 Institut für Architektur und Entwerfen E253/4 Abteilung für Hochbau und Entwerfen eingereicht an der Technischen Universität Wien Fakultät für Architektur und Raumplanung von Christian Fuchs 0105640 Wehlistraße 57/12/37 1200 Wien Wien, am 04.04.2014 2 Abb.1: „Peripherie mit Tram und Kran“, Mario Sironi, 1921 „Eine Welt, die Platz für die Öffentlichkeit haben soll, kann nicht nur für eine Generation errichtet oder nur für die Lebenden geplant sein; sie muss die Lebensspanne sterblicher Menschen übersteigen.“ Hannah Arendt 3 Office seeks Connection Integration of an Officebuilding in its urban environment In order to maximize the profitability of office buildings , real estate material appearance of such buildings and the associated quali- investors hold small plots together to large surface areas . The- ties not only embody entrepreneurial ideologies , but also convey re arise impenetrable , oversized „lumps„ or „Klumpen“1 that no an atmosphere that contributes positively to the quality of work. longer integrate in the specified city structures and thus extend In the 18th and 19th Centuries in Vienna built factory buildings footpaths and block visual axis. were carried out primarily in exposed brick construction, under the influence of the architect Ludwig Förster. Brick is always brought As a strategy to deal with such dimensions, the design insinuates in conjunction with manual labour, not least because of the mode to typical Viennese architectural shapes: the court house and the of production and its use on the site. -

Pressemappe Impulstanz2019.Pdf
Presseinformation Pressekontakt Theresa Pointner, Almud Krejza & Zorah Zellinger ImPulsTanz – Vienna International Dance Festival Museumstraße 5/21 1070 Wien, Austria T +43.1.523 55 58-34 T +43.1.523 55 58-35 F +43.1.523 55 58-9 [email protected] impulstanz.com Laufend aktualisierte Presseinformationen, -texte und -fotos zu unserem Festivalprogramm finden Sie in unserem Pressebereich auf der ImPulsTanz-Website. impulstanz.com/presscontact Pressetexte Hier finden Sie eine Auswahl der aktuellen Pressetexte, die Sie als PDF herunterladen können. impulstanz.com/pressfiles Pressefotos In diesem Bereich steht Ihnen eine Auswahl an Fotos des diesjährigen Performance- und Workshop- Programms zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass die Fotos nur im Zusammenhang mit ImPulsTanz und unter Angabe des Copyrights verwendet werden dürfen. Sollten Sie an weiterem Fotomaterial interessiert sein, wenden Sie sich bitte an uns. impulstanz.com/presspictures Presseakkreditierungen Es gibt die Möglichkeit, per Online-Formular einen Antrag auf Akkreditierung für das ImPulsTanz Festival 2019 zu stellen. Bitte füllen Sie dieses aus und senden Sie es gemeinsam mit den genannten Unterlagen ab. Wir werden uns nach Ansicht und Bearbeitung Ihrer Unterlagen mit Ihnen in Verbindung setzen. impulstanz.com/mediaaccreditation 11 Juli — 11 August 2019 1 Inhaltsverzeichnis Presseinformation 1 Inhaltsverzeichnis 2 Spielplan 5 Compagnie Übersicht 14 Spielstätten 17 Vorverkauf & Tageskassen 18 ImPulsTanz Performances 19 ImPulsTanz X Museum 21 Grußworte 22 [8:tension] Young Choreographers’ Series 23 Compagnies A-Z 25 Artists 25 Agudo Dance Company 26 Alleyne Dance 31 [8:tension] Eric Arnal-Burtschy 36 Simone Aughterlony, Petra Hrašćanec & Saša Božić 39 Jérôme Bel 44 Jonathan Burrows 50 Dimitri Chamblas & Boris Charmatz / Terrain 54 [8:tension] Tatiana Chizhikova & Roman Kutnov 60 Steven Cohen 63 Claire Croizé & Matteo Fargion / ECCE vzw 69 Ivo Dimchev 74 Cie. -

Vienna International Dance Festival Impulstanz – Young Choreographers’ IMMER Award Ceremony WIDER
IMPULSTANZ – YOUNG CHOREOGRAPHERS’ AWARD CEREMONY Such Sweet Thunder © James Bantone Pain Threshold © Gerhard F. Ludwig Why We Fight © Sebastien de Buyl Time to Time © Rusted Rustam So, 11. August, 21:00 Kasino am Schwarzenbergplatz hosted by Riem Higazi SUASH © Luc Depreitere ’d he meant vary a shin’s © Jose Figueroa SOFTLAMP.autonomies © Ian Douglas BLINK - mini unison intense lamentation © Thomas Lender Andrade © Clara Hermans Ask the oracle - the future is now © Mira Kandathil, Annina Machaz © Yoshiko Kusano © Yoshiko Mademoiselle x © Alan Proosa HATE ME, TENDER HATE Vienna International Dance Festival ImPulsTanz – Young Choreographers’ IMMER Award Ceremony WIDER BRAV! DEN GARTEN ALS WOHNRAUM ENTDECKEN Kritische Meinungen Hosted by Riem Higazi und Kommentare. GARTENARCHITEKTUR BAUMSCHULE 11. August 2019 21:00CONCEPT STORE Jede Woche. Hauptstraße 18 3441 Zöfing / Tulln Kasino am Schwarzenbergplatzwww.kramerundkramer.at Wir betreuen Ihr Projekt von der ersten Idee bis zum letzten Grashalm. Beratung, Planung und Umsetzung sowie auch Pflege und Betreuung kommen aus einer Hand. Unser Concept-Store bietet ein breites Sortiment an exklusiven Outdoor-Möbel, besonderen Pflanzen, hochwertigen Pflanzgefäßen und originellen Accessoires. [8:tension] 2019 Young Choreographers‘ Series ImPulsTanz – Young Choreographers’ Award Ceremony Tanzt! Tanzt!! Dance! Dance!! Jannis Niewöhner als / as Beat in Beat DE EN Nicht ganz so dystopisch wie die Grimme- Not quite as dystopian as the Grimme Preis-gekrönte Serie Beat entwickelt sich die Award-winning series Beat unfolds the [8:tension] Young Choreographers’ Series [8:tension] Young Choreographers’ Series 2019. Allerdings mindestens so spannend 2019. However, at least as thrilling and mu- und musikalisch, so aufregend klug und sical, as excitingly smart and ecstatic. -

K Kunstbericht 2005
k Kunstbericht 2005 Bericht über die Kunstförderung des Bundeskanzleramts Struktur der Ausgaben Förderungen im Detail Serviceteil Glossar zur Kunstförderung k Kunstbericht 2005 Bericht über die Kunstförderung des Bundeskanzleramts Struktur der Ausgaben Förderungen im Detail Serviceteil Glossar zur Kunstförderung k Inhalt Vorwort des Staatssekretärs für Kunst und Medien Seite 5 I Struktur der Ausgaben Seite 11 II Förderungen im Detail Seite 57 III Serviceteil Seite 89 IV Glossar zur Kunstförderung Seite 137 Register Seite 175 Vorwort vereinbart. Einen wichtigen Schritt ropa war und ist ein Kontinent, der bei diesen Bemühungen stellten die sich besonders durch seine Kreativität europäischen Kulturministertreffen und Innovationskraft auszeichnet. it dem Kunstbericht 2005 wird dar, die im Jahr 2000 in Wien mit der Mbereits der sechste Rechen Konferenz „Interregionale kulturelle nnerhalb eines halben Jahrzehnts schaftsbericht vorgelegt, der in meine Zusammenarbeit in Südosteuropa Ihaben wir hervorragende und stabile Zuständigkeit als Staatssekretär für und dem Mittelmeerraum“ gestartet Beziehungen zu unseren nahen und Kunst und Medien fällt. Auf den ersten wurden. Der damals begonnene Dia weiter entfernten Nachbarn aufgebaut. Blick ist Förderungspolitik gleichbe log wurde mit der Konferenz „Creative Sie haben dazu beigetragen, dass wir deutend mit finanziellen Transferleis Europe. Kultur und Wirtschaft im im Rahmen unseres EU-Ratsvorsitzes tungen und somit von der Höhe jener 21. Jahrhundert“ fortgesetzt, die im die Konferenz „Content als Wettbe Mittel abhängig, die wir zur Verfügung November 2001 in Innsbruck statt werbsfaktor – Stärkung der europäi haben. In Zeiten der Konsolidierung fand. Mit Peter Weibel als Kurator schen Kreativwirtschaft im Lichte der des öffentlichen Haushalts und der wurde eine Ausstellungsserie mit i2010 Strategie“, die Anfang März Strukturreform des Sozialstaats ste Kunst aus Mittel-, Ost- und Südost 2006 in der Wiener Hofburg stattfand, hen zwar nach wie vor erfreulich hohe europa initiiert. -

Religious Architecture: Anthropological Perspectives
UvA-DARE (Digital Academic Repository) Religious architecture: anthropological perspectives Verkaaik, O. Publication date 2013 Document Version Final published version Link to publication Citation for published version (APA): Verkaaik, O. (2013). Religious architecture: anthropological perspectives. Amsterdam University Press. http://www.oapen.org/search?identifier=456162 General rights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Disclaimer/Complaints regulations If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl) Download date:01 Oct 2021 RELIGIOUS RELIGIOUS Religious Architecture: Anthropological Perspectives develops new anthropological perspectives on religious architecture, including mosques, churches, temples and synagogues. Borrowing from a range of theoretical perspectives on space-making and material religion, this volume looks at how religious buildings take their RELIGIOUS place in opposition to the secular surroundings and the neoliberal city; how they, as evocations of the sublime, help believers to move beyond the boundaries of modern subjectivity; and how international heritage status may conflict with their function as community centres. -

Spirituality and Religion Past, Present and Future
SPIRITUALITY AND RELIGION PAST, PRESENT AND FUTURE Dr. Priya Ranjan Trivedi Dr. Markandey Rai fo'o fgUnw fo|kihB Vishwa Hindu Vidyapeeth New Delhi 1 Published by Vishwa Hindu Vidyapeeth Priyaranjan Dham, Indraprasthapeeth A 14-15-16, Paryavaran Complex New Delhi - 110030 JULY 2018 Printed in India Data has been collected for the Book “Spirituality and Religion Interface” from different sources. The Publishers are thankful to all those who have supported this cause. The publishers also show gratitude to them. Printed at Green Graphics, New Delhi - 110030, India 2 CONTENTS Page No. Preface 5 Chapter 1 Spirituality 6 Chapter 2 Religion 19 Chapter 3 Scope of Spirituality 42 Chapter 4 Scope of Religion 51 Chapter 5 Neo-Vedanta 58 Chapter 6 Esotericism 69 Chapter 7 Spiritual But Not Religious 73 Chapter 8 Catholic Spirituality 75 Chapter 9 Christian Mysticism 81 Chapter 10 Five Pillars of Islam 101 Chapter 11 Sufism 106 Chapter 12 Jihad 142 Chapter 13 Buddhism 155 Chapter 14 Hinduism 200 Chapter 15 Hindustan 227 Chapter 16 Orientalism 229 Chapter 17 Sanātanī 242 Chapter 18 Hindu Reforms Movements 244 Chapter 19 Hindu Denominations 246 Chapter 20 Purusārtha 255 Chapter 21 Diksha 260 Chapter 22 Dharma 262 Chapter 23 Artha 274 Chapter 24 Kama 278 Chapter 25 Moksha 283 Chapter 26 Ishvara 295 Chapter 27 God in Hinduism 302 Chapter 28 Ahimsa 307 Chapter 29 Vegetarianism and Religion 317 Chapter 30 Cattle in Religion 329 Chapter 31 Sattvic Diet 338 Chapter 32 Mitahara 341 Chapter 33 Śruti 344 3 Chapter 34 Smriti 348 Chapter 35 Hindu Scriptures 352 -

Paradise Lost Se
PARADISE LOST ? Jim Markland 2 August 2018 Preface Over many years a long and deep relationship was carved out between Cheltenham and British India. Investigating this can be a fascinating and rewarding experience. The many connections that resulted provide portals to what at times was the colourful exotic world of Mughals and Maharajahs and, at others, one in which great adventures and sometimes dreadful tragedies unfolded. The story here is hopefully a useful starting point for anyone wishing to explore those paths. Welcome to a world long gone! Here the term Anglo-Indian is used for consistency with some older usage to denote British people who served in India. In India that same term could be used to denote people of mixed race. India of course, in the context of this document, means a territory far larger than the current boundaries of that country. Hiding in Plain Sight So much of our history happened overseas. That is true, however, unlike some of its former colonies, Britain has never been good at remembering those who served overseas. As far as Cheltenham is concerned overseas means one place in particular …. India …and with that The Honourable East India Company; an organisation whose tentacles, at times, reached across all the oceans from New England to Nootka Sound. Yet Cheltenham, indeed, seems to have done its best to forget those many Anglo- Indians, distinguished or otherwise, who came to take its waters as a restorative, to sojourn or to live in the town whether during the times of the Company or later during the Raj.