Bis 29 Md.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Intensivversorgung Tracheotomierter Patienten Mit Und Ohne Beatmung – Bedarfsgerechtigkeit Regionaler Angebote
Intensivversorgung tracheotomierter Patienten mit und ohne Beatmung – Bedarfsgerechtigkeit regionaler Angebote Susanne Stark, Yvonne Lehmann, Michael Ewers Working Paper No. 19-01 Berlin, April 2019 Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft Zitierhinweis: Stark S, Lehmann Y, Ewers M (2019): Intensivversorgung tracheotomierter Patienten mit und ohne Beatmung – Bedarfsgerechtigkeit regionaler Angebote Working Paper No. 19-01 der Unit Gesundheitswissenschaften und ihre Didaktik. Berlin: Charité – Universitätsmedizin Berlin Impressum: Working Paper No. 19-01 der Unit Gesundheitswissenschaften und ihre Didaktik Berlin, April 2019 ISSN 2193-0902 Charité – Universitätsmedizin Berlin Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft CVK – Augustenburger Platz 1 13353 Berlin | Deutschland Tel. +49 (0)30 450 529 092 Fax +49 (0)30 450 529 900 http://igpw.charite.de Intensivversorgung tracheotomierter Patienten mit und ohne Beatmung Abstract Tracheotomierte Patienten mit und ohne Beatmung benötigen aufgrund ihrer komplexen Prob- lem- und Bedarfslagen häufig eine multiprofessionelle, auf Integration und Kontinuität ange- legte Intensivversorgung. Diese geht mit hohen Anforderungen an die fachliche Expertise, Ko- ordination und Kooperation der beteiligten Sektoren, Organisationen und Professionen einher. Vorliegenden Erkenntnissen zufolge werden diese hohen Anforderungen noch selten erfüllt. Patienten und Angehörige, aber auch Versorgungskoordinatoren und Fallmanager haben oft- mals erhebliche Probleme, bedarfsgerechte Versorgungsangebote ausfindig -

I DDR-Elitens Højborg
Kristeligt Dagblad Lørdag 5. april 2014 Denne side er redigeret af Mie Petersen Rejser&Kultur | 23 I DDR-elitens højborg I det tidligere Østtyskland boede eliten i villaerne ved Majakowskiring i Berlin. Bag skarpt bevæbnede vagter og høje mure levede de adskilt fra folket AF JENS MALLING ter kontrollerede mange gan- Ved festlige lejligheder som række rykkede derefter ind i vandledes området til et me- [email protected] ge stemplede og underskrev- den 1. maj eller Østtysklands villaerne på Majakowskiring, re normalt boligkvarter. Man- ne besøgstilladelser. En høj nationaldag, den 7. oktober, herunder et stort antal Stasi- ge år efter kunne man dog Ved første øjekast synes der mur omkransede området og har de måske delt en flaske af medarbejdere. stadig støde ind i det heden- ikke at være andet at komme forhindrede adgang for kam- den udmærkede DDR-cham- DDR begyndte at slå gangne Østtysklands aller- efter i villakvarteret end ren merater, der ikke var så højt pagne Rotkäppchen – som sprækker i slutningen af mest prominente personager idyl. Det fremstår fredfyldt og oppe i samfundshierarkiet. stadig er i produktion – med 1980’erne, og den folkelige på de hyggelige villaveje. harmonisk. Russerne tog også initiativ deres hustruer. revolution, der brød ud i maj Manden, der kortvarigt hav- At dømme efter husenes til at omdøbe vejene i kvarte- 1989, markerede, at den pri- de generalsekretærposten ef- størrelse residerer her Berlins ret efter kulturpersonlighe- Det gode sammenhold var vilegerede kommunistiske ter Honecker, Egon Krenz, bedre borgerskab. Skiltene der i deres hjemland. Således dog truet. Opstande mod de livsstil i kvarteret var ved at blev tvunget ud af sit hjem på ved siden af dørklokkerne hedder de stadig Boris-Pa- kommunistiske regimer i være omme. -

Kiezspaziergang Mit Fotograf Andreas Mühe Wie Die Geschichte Verrinnt in Niederschönhausen
Der Tagesspiegel • Kiezspaziergang mit Fotograf Andreas Mühe: Wie die Geschichte verrinnt in Niederschönhausen 13.12.2017 17:04 Uhr Kiezspaziergang mit Fotograf Andreas Mühe Wie die Geschichte verrinnt in Niederschönhausen Wo einst die SED-Spitze residierte und über Flugzeuglärm gestritten wird: Ein Kiezspaziergang mit dem Fotografen Andreas Mühe. Angie Pohlers Ansichtssache. Andreas Mühe lebt seit etwa 15 Jahren in Pankow, nicht weit vom Schloss Schönhausen entfernt.Foto: Agnieszka Budek Andreas Mühe hat es nicht leicht an diesem Tag im Schlosspark Schönhausen, mitten in Pankow – eine Hand hält das Handy ans Ohr, die zweite versucht, das Ziehen und Zerren am anderen Ende der Leine auszugleichen. Mühe stemmt seine Stiefel in den Boden, damit Ruby ihn nicht umreißt. „Ich weiß nicht, ob man sich einen Hund zulegen sollte.“ Er dachte, es sei einfacher. „Für so ein Tier braucht es sehr viel Zeit, Ausdauer, Arbeit.“ Dabei hat er hat in seinen 38 Lebensjahren ja schon größere Aufgaben gemeistert. Zuallererst: Sich neben dem Schauspielervater Ulrich Mühe zu etablieren, seine eigene künstlerische Ausdrucksform zu finden, nämlich die analoge Fotografie mit der Großbildkamera. Gelernt hat er bei Ali Kepenek in Berlin und bei Anatol Kotte in Hamburg, als wichtigen Förderer nennt er F.C. Gundlach. Und wenn man schon bei den großen Namen ist, dann müssen auch die genannt werden, die er vor der Linse hatte: Helmut Kohl am Brandenburger Tor, inszeniert wie das Schlusstableau eines Heldenepos. Angela Merkel am Ufer, vom Betrachter abgewandt. Irgendwann bezeichnete man ihn als „Kanzlerinnenfotograf“. Seiner Kunst wird das nicht gerecht. Nun zeigt die Villa Grisebach Mühes Weihnachtsbaum-Serie. Hier geht es abermals um deutsche Befindlichkeiten und Traditionen – in diesem Fall sehr persönliche. -

Sandra Klaus
Vom späten Historismus zur industriellen Massenarchitektur Städtebau und Architektur in den nordöstlichen Berliner Außenbezirken Weißensee und Pankow zwischen 1870 und 1970 unter besonderer Betrachtung des Wohnungsbaus Band I: Textband Inauguraldissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Philosophie an der Philosophischen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald vorgelegt von Sandra Klaus Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Philosophische Fakultät Caspar-David-Friedrich-Institut, Bereich Kunstgeschichte Dekan: Prof. Dr. Thomas Stamm-Kuhlmann 1. Gutachter: Prof. em. Dr. Bernfried Lichtnau, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 2. Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Johannes Cramer, Technische Universität Berlin Tag der Disputation: 03.09.2015, unter Leitung von PD Dr. phil. Robert Riemer Greifswald, Januar 2015 1 S. Abb. IX und XCIII Anmerkung der Verfasserin: Sofern dies möglich war, wurden die Publikationsgenehmigungen des in der Arbeit verwendeten Abbildungsmaterials vor der Veröffentlichung eingeholt. Sollten weitere, bisher nicht berücksichtigte Urheberrechtsansprüche bestehen, können Sie mich gerne kontaktieren unter [email protected]. 2 Inhalt Band I Seite 1. Einleitung .......................................................................................................................................... 6 1.1 Intentionen und Zielstellungen ................................................................................................. 6 1.2 Literatursituation und Forschungsstand .................................................................................. -

Tätigkeitsbericht Bundesstiftung Zur Aufarbeitung Der SED-Diktatur
Tätigkeitsbericht Bundesstiftung zur Aufarbeitung2007 der SED-Diktatur Bundesunmittelbare Stiftung des öffentlichen Rechts Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur Ein Portrait in Zahlen Seit 1998, dem Gründungsjahr der Bundesstiftung wurden insgesamt mehr als 1.600 Ausstellungen, Publikationen, Konferenzen, Veranstaltungen und Dokumentarfilme zur Auseinandersetzung mit den kommunistischen Diktaturen in Deutschland und Europa realisiert 213 Bücher konnten mit Druckkostenzuschüssen der Bundesstiftung erscheinen 22,5 Mio. Euro an Fördermitteln wurden ausgereicht. 300 Förderanträge werden jedes Jahr an die Bundesstiftung gerichtet. Von ihnen können rund 160 neue Projekte aus den unterschiedlichsten Bereichen gefördert werden 5,5 Mio. Euro wurden insgesamt für die Unterstützung der Beratung und Betreung von Opfern der SED-Diktatur bereitgestellt 50 Mio. Euro hätte die Bundesstiftung seit 1998 an Fördermitteln benötigt, um alle bei ihr eingereichten Anträge fördern zu können 69 Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler haben seit 2001 ein Stipendium zur Erarbeitung ihrer Dissertation erhalten. 36.000 Bücher zur Geschichte von Repression in sowie Opposition und Widerstand gegen kommunistische Diktaturen sowie zur Dokumentation der Auseinandersetzung mit Diktaturen weltweit sind in der Stiftungsbibliothek verfügbar 40.000 Blatt des »Archivs unterdrückter Literatur« befinden sich im Archiv der Bundesstiftung 3.600 Kunstwerke von Roger Loewig werden im Archiv der Bundesstiftung aufbewahrt und in Ausstellungen zugänglich gemacht 20.000 Photos sind im Stiftungsarchiv verfügbar 618 Erinnerungsorte an die kommunistische Diktatur in der SBZ/DDR und die deutsche Teilung verzeichnet die Bundesstiftung Aufarbeitung bundesweit in ihrer Dokumentation »Orte des Erinnerns« mit 300 Partnerinstitutionen und Organisationen in der Bundesrepublik und in der Welt unterhält die Bundesstiftung Kooperationsbeziehungen 9.000 Nutzer besuchen jeden Monat die Website der Bundesstiftung und nutzen ihre Angebote unter www.bundesstiftung-aufarbeitung.de 4,9 Mio. -

Berlin District Centres of Adult Education
Urban Sustainability, Orientation Theory and Adult Education Infrastructure in the District – A Common Approach in the Case of the Berlin District Centres of Adult Education vorgelegt von Frau Dipl.-Ing. Anastasia Zefkili von der Fakultät VI Planen Bauen Umwelt der Technischen Universität Berlin zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Ingenieurwissenschaft -Dr.-Ing. – genehmigte Dissertation Promotionsausschuss: Vorsitzender: Prof. Henckel Berichter: Prof. Pahl-Weber Berichter: Dr. Dienel Tag der wissenschaftlichen Aussprache: 10.09.2010 Berlin 2011 D 83 Acknowledgements The present work would not be possible without the support of a number of people with whom I had the pleasure to cooperate. I would like to express my gratitude to the experts and to the employees of the Berlin Volkshochschule, who dedicated their time and shared their knowledge and experience for the purpose of the current research. I would also like to thank my supervisors, Prof. Elke Pahl-Weber and Dr. Hans- Liudger Dienel, for their support, as well as Prof. Hartmut Bossel for his comments on my work. Furthermore, I am grateful to the Bakala Foundation for the financing of my studies and to the Women's Affairs Office for the Central University Administration for their support towards the conclusion of my thesis. In particular, I would like to thank Dr. Marcello Barisonzi, who supported me with technical advice and read my thesis. Contents 1 Introduction 1 1.1 Adult Education in Sustainable District Development . 1 1.2 Urban Issues at the District Level . 4 1.3 Trends in Adult Education . 10 1.3.1 Educational Infrastructure in the District . -

Berlin Pankow 2018 – 2019 Informationen Aus Dem Rathaus Information from Town Hall RAUM ZUM LEBEN
Berlin Pankow 2018 – 2019 Informationen aus dem Rathaus Information from Town Hall www.berlin.de/pankow RAUM ZUM LEBEN Mit Fingerspitzengefühl und über 20 Jahren Markterfahrung entwickeln wir Räume zum Leben: Wohn- und Büroimmobilien, Schulen, Sporthallen, KiTas und Seniorenwohnen. situs.de Liebe Pankowerinnen und Pankower, Dear Residents of Pankow, dear sehr geehrte Gäste unseres Bezirkes, Guests of our District, Pankow wächst an allen Ecken und Enden, die Einwohnerzahl Pankow is growing everywhere you look and its population of von 400.000 ist längst überschritten. Dies hat für uns alle 400,000 has long been exceeded. This has caused “growing „Wachstumsschmerzen“ zur Folge. Die Verwaltung kann bei der pains” for all of us. The administration has bare-ly been able Gewinnung notwendigen Personals, der Sanierung und dem to keep up with recruiting the necessary personnel or the Neubau kommunaler Einrichtungen nur schwer mithalten, oft mit renovation and new construction of community facilities, unangenehmen Folgen für Sie als Kunden unserer Ämter oder often with unpleasant consequences for you as a client of our Eltern von Kita- und Schulkindern. offices or as parents of children in childcare centres and in Dennoch ist die Entwicklung unseres Bezirkes insgesamt äußerst school. positiv. Wichtige Projekte kommen voran, die Grundsatzverein- Nevertheless, the development of our district is extremely barung zum Pankower Tor, die Machbarkeitsstudie zum Neubau positive overall. Important projects are making progress: the einer Schule und des Multifunktionsbades auf dem Freibadge- basic agreement on the Pankower Tor [Pankow Gateway], lände, eine Mobilitätsuntersuchung sowie die Beteiligungsver- the feasibility study on the construction of a new school and fahren zu den Wohnungsbauprojekten seien hier beispielhaft the multi-purpose pool in the outdoor pool area, a mobility genannt. -

Udo Lindenberg: Sonderzug Nach Pankow
Udo Lindenberg: Sonderzug nach Pankow Udo Lindenberg hatte in einem Radiointerview am 5. März 1979 seinen Wunsch geäußert, für seine Fans ein Konzert in Ostberlin veranstalten zu wollen. Das Interview wurde in der DDR im Originalton aufgezeichnet und einen Tag später als Information dem Chefideologen und Kulturverantwortlichen der SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) vorgelegt. Dieser schrieb am 9. März 1979 handschriftlich auf die Information: „Auftritt in der DDR kommt nicht in Frage“. Lindenberg war über diese Ablehnung verärgert, doch gelang es ihm für einige Jahre nicht, seinen Plan umzusetzen. Dann kam er Anfang 1983 auf die Idee, als Reaktion auf diese Ablehnung einen deutschen Text auf Glenn Millers Swing-Klassiker Chattanooga Choo Choo zu verfassen. Der deutsche Text des Liedes richtet sich in ironischer Weise direkt an den damaligen Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker. Dieser wird respektlos als verknöcherter und scheinheiliger Mann bezeichnet, der offiziell die Ideologie der Regierung präsentiere, aber innerlich ein Rocker sei und heimlich West-Radio höre. Der Bezug zum Berliner Bezirk Pankow im Titel beruht auf der Tatsache, dass das dort gelegene Schloss Schönhausen von 1949 bis 1960 Sitz des Präsidenten sowie anschließend bis 1964 des Staatsrates der DDR war. Auch danach hatten viele Angehörige der DDR-Regierung und ranghohe Mitarbeiter anderer Behörden ihren Wohnsitz in Pankow, unter anderem am Majakowskiring. Pankow wurde in der Zeit des Kalten Krieges als Synonym für „Regierungssitz der sowjetisch besetzten Zone“ benutzt. Zum Schluss der Aufnahme ist eine Bahnhofsdurchsage in Russisch zu hören. Der Originaltext lautet: „Towarischtsch Erich! Meshdu protschim, werchownij sowjet ne imejet nitschewo protiw gastrolej Gospodina Lindenberga w GDR!“, auf Deutsch übersetzt: „Genosse Erich, im Übrigen hat der Oberste Sowjet nichts gegen ein Gastspiel von Herrn Lindenberg in der DDR!“ Diese Passage sollte darauf hinweisen, dass ohnehin wesentliche Entscheidungen der DDR in der Sowjetunion getroffen würden. -

Die Neue Dauerausstellung Im Bundesarchiv-Militärarchiv
Die neue Dauerausstellung im Bundesarchiv-Militärarchiv Im Zuge der konzeptionellen Vorbereitung des „Tages der Archive“ im Bundesarchiv- Militärarchiv erschien es dem zuständigen Projektteam erforderlich, die bestehende Dauerausstellung im Untergeschoss des Benutzungszentrums neu zu gestalten. Diese sollte am „Tag der Archive“ erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die Notwendigkeit einer Dauerausstellung liegt zum einen in der Bedeutung des Militärarchivs an sich, zum andern im hohen Besucheraufkommen. Regelmäßig werden sowohl Studenten als auch Besuchergruppen von Einheiten und Dienst- stellen der Bundeswehr durch die Abteilung geführt. Die hierfür vorhandenen, an die jeweilige Klientel angepassten PowerPoint-Vorträge ermöglichen zwar eine grund- sätzliche Faktenvermittlung zu Aufgaben, Arbeitsweise und Organisation des Militär- archivs, eine tiefergehende Auseinandersetzung mit den Beständen ist dabei jedoch nicht möglich. Auch die bestehende, in den Jahren 1996/97 gestaltete Dauerausstellung genügte diesen Anforderungen nicht. Runderneuerung Die Neugestaltung der Dauerausstellung erforderte eine völlige Neukonzeption der eigentlichen Ausstellung und die Neugestaltung von Ausstellungsraum, Vitrinen und Schautafeln. Dies alles musste mit geringen finanziellen Mitteln realisiert werden. Um der neuen Ausstellung einen angemessenen Rahmen zu geben, war auch ein Neuanstrich des Raumes nötig. Angelehnt an das „Corporate Design“ des Bundes- archivs wurde für den Bezug der Vitrinen und Schautafeln ein dunkelblauer Dekomolton-Stoff -
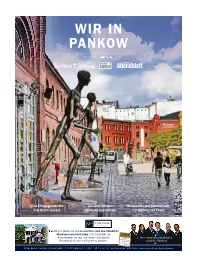
Wir in Pankow
WIR IN PANKOW EINE BEILAGE VON EineErfolgsgeschichte: Orte zumErholen: Sehenswert und unterhaltsam: Der Bezirkwächst. Die Parksund Gärten. Die MuseenundFeste. 2IWIR IN PANKOW FREITAG, 23.MÄRZ 2018 IVERLAGSBEILAGE Eine wachsende Großstadt Seit2001bildenPankow,Weißensee und Prenzlauer Bergeinen gemeinsamen Bezirk–mehr als 400000 Menschenwohnen dort THINKSTOCK.DE/ISTOCK/HANOHIKI Einidealer OrtfürsFeierabendbier,die Karaoke-Show oder dasgemeinsame Picknick:der Mauerpark. enn es um ein Ranking Dazu bildet vor allem Prenzlauer winziger Teil eines Flächenbe- alten Bewohner zogen besonders netto über die Runden kommen. der größten deutschen Berg mit seiner engen Bebauung zirks, der von der Stadtmitte in viele Menschen aus der Europäi- Gutverdienende Pankower,deren W Nettoeinkommen bei mehr als Städte gehen würde, und seiner Kultur- und Kneipen- Prenzlauer Berg bis draußen nach schen Union in den Bezirk–vor dann läge Pankow auf Platz 16. szene einen lebendigen Kontrast. Buch reicht. allem in den Prenzlauer Berg. 4500 Euro im Monat liegt, machen Denn mehr als 400000 Men- Längst kommen auch viele Tou- Insgesamt kam fast jede zweite nur 8,4 Prozent der Haushalteaus. schen leben mittlerweile in dem Ein Bezirk, drei Teile risten in den Bezirk, vor allem in Person, die in den vergangenen 60 Prozent der angebotenen Ei- Berliner Bezirk. Das sind immer- Pankow ist nach wie vor dreige- die Gegend rund um den Kollwitz- sieben Jahren nach Pankow zog, gentumswohnungen werden mit hin fast 60000 mehr als noch vor teilt. Auf der einen Seite gibt es platz in Prenzlauer Berg.Vor fast aus dem Ausland. In Prenzlauer einem Preis von mehr als3000 zehn Jahren. Damit hat Pankow den quirligen, hippen und zum Teil 20 Jahren warder damalige US- Berg waren es sogar 73 Prozent Euro aufden Markt gebracht, sechs als erster der zwölf Berliner Bezirk mit vielen Klischees belegten Sze- amerikanische Präsident Bill Clin- Prozent liegen über 5000 Euro. -

Tourismusmarketing-Konzept Für Den Bezirk Pankow
Tourismusmarketing-Konzept für den Bezirk Pankow Endbericht Juli 2005 REPPEL + LORENZ TOURISMUS-BERATUNG Tempelhofer Ufer 23 / 24 Tel. 0 30 / 21 45 87 - 0 [email protected] 10963 Berlin Fax 0 30 / 21 45 87 - 11 www.reppel-lorenz.de Gesellschaft für innovative Qualifizierung und Beratung mbH Muskauer Str. 24 Tel. 030 - 611 34 29 [email protected] 10997 Berlin Fax 030 - 611 35 29 www.iq-consult.com Tourismusmarketing-Konzep t Pankow: Endbericht Inhalt 1. Vorbemerkung ...................................................................................... 6 2. Touristische Rahmenbedingungen und Angebotsfaktoren ................... 7 2.1. Allgemeine Daten, Fakten und Lage .......................................... 7 2.2. Ortsbild....................................................................................... 7 2.3. Verkehr ..................................................................................... 12 2.4. Touristisches Informations- und Leitsystem ............................ 13 3. Touristische Themen........................................................................... 15 3.1. Sehenswürdigkeiten.................................................................. 15 3.2. Kulturstandort Pankow............................................................. 17 3.2.1. Museale Einrichtungen ................................................ 17 3.2.2. Multifunktionale Kultur- und Veranstaltungsorte ....... 19 3.2.3. Weitere Kultureinrichtungen ....................................... 21 3.2.4. Veranstaltungen .......................................................... -

Pankow Impressum
Willkommen in Pankow Impressum Herausgeber mediaprint infoverlag gmbh. Änderungswünsche, Anregungen und Ergänzungen für die nächste Auflage dieser Broschüre nimmt der Verlag entgegen. Titel, Umschlaggestaltung sowie Art und Anordnung des Inhalts sind zu gunsten des jeweiligen Inhabers dieser Rechte urheberrechtlich geschützt. Nachdruck und Übersetzungen in Print und Online sind – auch auszugsweise – nicht gestattet. Texte: Christiane Flechtner, mediaprint infoverlag gmbh Fotos: Christiane Flechtner, mediaprint infoverlag gmbh, Daniel Prusseit, Seite 14 (Bornholmer Brücke), Seite 19 (Alte Mälzerei), Ralf Grömminger, Seite 24 (Arnold-Graffi-Haus), BBB GmbH, Seite 24 (Torhaus Campus Berlin-Buch), diego [email protected], Seite 50 Verlag: mediaprint infoverlag gmbh Lechstraße 2 D-86415 Mering Tel. +49 (0) 8233 384-0 Fax +49 (0) 8233 384-103 [email protected] www.mediaprint.info www.alles-deutschland.de www.total-lokal.de 13187150/ 2. Auflage / 2011 Liebe Neu-Pankowerinnen und Neu-Pankower Ich darf Ihnen gegenüber meine Freude zum Aus- Für unsere älteren Bürger haben wir ebenfalls ein druck bringen, dass Sie sich entschlossen haben, vielfältiges Angebot vorrätig. Ganz besonders darf zukünftig in diesem Bezirk zu wohnen und/oder ich auf den quicklebendigen Ortsteil Prenzlauer Berg auch zu arbeiten. Selbst wenn ich davon ausgehen hinweisen, der mit seiner bunten Palette an gastro- kann, dass Sie sich schon ein wenig mit dem Bezirk nomischen und kulturellen Möglichkeiten nicht nur befasst haben, darf ich Ihr Interesse noch auf einige die Bundeskanzlerin und Bundeskanzler anzieht, Dinge richten. sondern auch Präsidenten aus Europa und Übersee. In diesem Ortsteil ist fast alles fußläufig bzw. mit Pankow ist heute mit über 360 000 Menschen der Fahrrad oder Tram sowie S- und U-Bahn erreich- einwohnerstärkste Berliner Bezirk.