Geologischen Karte
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Self-Perception of Chronic Physical Incapacity Among the Labouring Poor
THE SELF-PERCEPTION OF CHRONIC PHYSICAL INCAPACITY AMONG THE LABOURING POOR. PAUPER NARRATIVES AND TERRITORIAL HOSPITALS IN EARLY MODERN RURAL GERMANY. BY LOUISE MARSHA GRAY A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy at the University of London. University College, London 2001 * 1W ) 2 ABSTRACT This thesis examines the experiences of the labouring poor who were suffering from chronic physical illnesses in the early modern period. Despite the popularity of institutional history among medical historians, the experiences of the sick poor themselves have hitherto been sorely neglected. Research into the motivation of the sick poor to petition for a place in a hospital to date has stemmed from a reliance upon administrative or statistical sources, such as patient lists. An over-reliance upon such documentation omits an awareness of the 'voice of the poor', and of their experiences of the realities of living with a chronic ailment. Research focusing upon the early modern period has been largely silent with regards to the specific ways in which a prospective patient viewed a hospital, and to the point in a sick person's life in which they would apply for admission into such an institution. This thesis hopes to rectif,r such a bias. Research for this thesis has centred on surviving pauper petitions, written by and on behalf of the rural labouring poor who sought admission into two territorial hospitals in Hesse, Germany. This study will examine the establishment of these hospitals at the onset of the Reformation, and will chart their history throughout the early modern period. Bureaucratic and administrative documentation will be contrasted to the pauper petitions to gain a wider and more nuanced view of the place of these hospitals within society. -
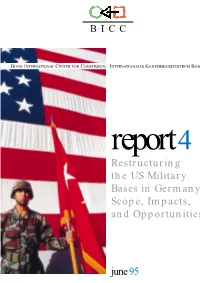
Restructuring the US Military Bases in Germany Scope, Impacts, and Opportunities
B.I.C.C BONN INTERNATIONAL CENTER FOR CONVERSION . INTERNATIONALES KONVERSIONSZENTRUM BONN report4 Restructuring the US Military Bases in Germany Scope, Impacts, and Opportunities june 95 Introduction 4 In 1996 the United States will complete its dramatic post-Cold US Forces in Germany 8 War military restructuring in ● Military Infrastructure in Germany: From Occupation to Cooperation 10 Germany. The results are stag- ● Sharing the Burden of Defense: gering. In a six-year period the A Survey of the US Bases in United States will have closed or Germany During the Cold War 12 reduced almost 90 percent of its ● After the Cold War: bases, withdrawn more than contents Restructuring the US Presence 150,000 US military personnel, in Germany 17 and returned enough combined ● Map: US Base-Closures land to create a new federal state. 1990-1996 19 ● Endstate: The Emerging US The withdrawal will have a serious Base Structure in Germany 23 affect on many of the communi- ties that hosted US bases. The US Impact on the German Economy 26 military’syearly demand for goods and services in Germany has fal- ● The Economic Impact 28 len by more than US $3 billion, ● Impact on the Real Estate and more than 70,000 Germans Market 36 have lost their jobs through direct and indirect effects. Closing, Returning, and Converting US Bases 42 Local officials’ ability to replace those jobs by converting closed ● The Decision Process 44 bases will depend on several key ● Post-Closure US-German factors. The condition, location, Negotiations 45 and type of facility will frequently ● The German Base Disposal dictate the possible conversion Process 47 options. -

Malteser-Rettungswache Wird Von Fischbach Nach Eppstein Verlegt
Auflage 17.700 Erscheint wöchentlich donnerstags in allen Haushalten Ausgabe 10 / 9. März 2017 Ihr SEAT-Partner für Kelkheim In der Stadt Kelkheim seit mehr als 43 Jahren zuverlässig wöchentlich Sodener Straße 1 61462 Königstein/Ts. mit Berichten und Fotos Tel. 06174 - 2993-939 www.marnet.seat.de NachrichtenNachrichten und und Meinungen Meinungen für für die die Stadt Stadt Kelkheim Kelkheim mit mit den den StadtteilenStadtteilen Hornau,Hornau, Münster, Fischbach,Fischbach, Ruppertshain, Ruppertshain, Eppenhain Eppenhain und und der der Gemeinde Gemeinde Liederbach Liederbach Malteser-Rettungswache wird von Fischbach SIMPLY CLEVER nach Eppstein verlegt Der Einsatz von Rettungsfahrzeugen der Malte- ser im Bereich von Kelkheim, Eppstein und der nordwestlichen Hofheimer Stadtteile wird vom Herbst 2018 an in Eppstein beginnen. An der Fischbacher Straße wird eine neue Rettungswa- che entstehen. Der Stützpunkt im Bürgerhaus Kelkheim-Fischbach entspricht nicht mehr den heutigen Standards, heißt es in einer Pressemit- teilung des Main-Taunus-Kreises. „Die Sanitä- Ihr Partner in Hofheim. ter können in diesem Gebiet noch schneller zum Göthling & Kaufmann Automobile GmbH Einsatzort kommen als bisher“, sagt dazu Landrat Niederhofheimer Str. 60, 65719 Hofheim am Taunus Michael Cyriax. Tel.: 06192 80708-0, www.goethling-kaufmann.de Die Kosten des Neubaus auf einem von einem Pri- vateigentümer gekauften Grundstück werden auf rund 1,7 Millionen Euro beziffert. Wie Cyriax erläutert, hatte der Kreis den neu- en Standort nach „einsatztaktischen Gesichts- punkten“ gesucht – Gesichtspunkte waren unter anderem die Lage sowie die Zu- und Abfahrts- möglichkeiten. Nachdem in Fischbach kein ge- eigneter Ausweichstandort gefunden wurde, stieß der Kreis mit Unterstützung der Stadt Eppstein auf das Grundstück an der Fischbacher Stra- ße. -

Low Flow and Drought in a German Low Mountain Range Basin
water Article Low Flow and Drought in a German Low Mountain Range Basin Paula Farina Grosser * and Britta Schmalz Chair of Engineering Hydrology and Water Management, Technical University of Darmstadt, 64287 Darmstadt, Germany; [email protected] * Correspondence: [email protected]; Tel.: +49-6151-16-20863 Abstract: Rising temperatures and changes in precipitation patterns in the last decades have led to an increased awareness on low flow and droughts even in temperate climate zones. The scientific community often considers low flow as a consequence of drought. However, when observing low flow, catchment processes play an important role alongside precipitation shortages. Therefore, it is crucial to not neglect the role of catchment characteristics. This paper seeks to investigate low flow and drought in an integrative catchment approach by observing the historical development of low flows and drought in a typical German low mountain range basin in the federal state of Hesse for the period 1980 to 2018. A trend analysis of drought and low flow indices was conducted and the results were analyzed with respect to the characteristics of the Gersprenz catchment and its subbasin, the Fischbach. It was shown that catchments comprising characteristics that are likely to evoke low flow are probably more likely to experience short-term, seasonal low flow events, while catchments incorporating characteristics that are more robust towards fluctuations of water availability will show long-term sensitivities towards meteorological trends. This study emphasizes the importance of small-scale effects when dealing with low flow events. Keywords: low flow; drought; catchment characteristics; low flow indices; drought indices; trend analysis; low mountain range catchment Citation: Grosser, P.F.; Schmalz, B. -

Three Württemberg Communities, 1558-1914 *
Community Characteristics and Demographic Development: Three Württemberg Communities, 1558-1914 * Sheilagh Ogilvie, Markus Küpker, and Janine Maegraith Faculty of Economics University of Cambridge * Acknowledgements: We would like to thank Roland Deigendesch, Timothy Guinnane, and Daniel Kirn for their stimulating comments on an earlier version of this paper, but absolve them from responsibility for any errors that might remain. We also gratefully acknowledge the financial support of the Leverhulme Trust (Research Grant F/09 722/A) and the Economic and Social Science Research Council (RES-062-23-0759). Abstract Demographic behaviour is influenced not just by attributes of individuals but also by characteristics of the communities in which those individuals live. A project on ‘Economy, Gender, and Social Capital in the German Demographic Transition’ is analyzing the long- term determinants of fertility by carrying out family reconstitutions of three Württemberg communities (Auingen, Ebhausen, and Wildberg) between c. 1558 and 1914. A related project on ‘Human Well-Being and the “Industrious Revolution”: Consumption, Gender and Social Capital in a German Developing Economy, 1600-1900’ is using marriage and death inventories to investigate how consumption interacted with production and demographic behaviour in two of these communities. This paper examines the historical, political, institutional, geographical, and economic attributes of the communities analyzed in these projects and discusses their potential effects. The aim is to generate testable hypotheses and relevant independent variables for subsequent econometric analyses of demographic behaviour. JEL Classifications: N0; N33; N43; N53; N63; N73; N93; J1; J13; O13; O15 Keywords: economic history; demography; fertility; gender; social capital; institutions; politics; geography; occupational structure; Germany Table of Contents List of Maps i List of Tables ii List of Figures iii List of Abbreviations iv Coinage, Weights, and Measures v 1. -

Die Geplante B8-Westumgehung Kelkheim-Königstein Würde Im Dichtbesiedelten Rhein-Main-Gebiet Landschaftlich Und Ökologisch W
Die geplante B8-Westumgehung Kelkheim-Königstein würde im dichtbesiedelten Rhein-Main-Gebiet landschaftlich und ökologisch wertvollstes Gebiet zerstören, darunter 160 000 Quadratmeter Wald und Streuobstwiesen Verfasserin: Dr. Claudia Weiand (BUND Königstein / Glashütten) Fotos: Thomas Gerber (BUND Königstein / Glashütten) Anhang: Dr. Richard Grimm (Stadtältester Stadt Königstein i.Ts. – Aktionsgemeinschaft Lebenswertes Königstein) Die Infrastruktur der Region würde durch den Wegfall der Erholungsfunktion im Trassenbereich dauerhaft Schaden nehmen. Die neue B8 würde den Stadtteil Königstein- Schneidhain mit seiner gewachsenen und erhaltenswerten Struktur (Wohngebiet, Kindergarten, Grundschule) einer stetig wachsenden Verkehrsbelastung aussetzen. Blick von der Burg Königstein in Richtung Westen: Ungefährer Verlauf der B8-Westumgehung, Teilstück von ca. 2 km Länge Vorgeschlagene Trassenvarianten Alle geplanten B8-Trassen berühren ein ökologisch äußerst wertvolles Gebiet. Der „Raumwiderstand“ erweist sich als „hoch“, „sehr hoch“ bzw. „besonders hoch“ Keine der geplanten Trassenvarianten lässt sich in diesem Raum umweltverträglich gestalten. Die einzige Alternative ist der Umbau der bestehenden Straßen (s. Umbau Kreisel in Königstein). Die B8 Westumgehung verknüpft künftig mit negativen Folgen die Autobahnen A66, A3 und A5. Nach Einführung der LKW-Maut wird hier dem Schwerlastverkehr ein Schleichweg geboten, der schon heute für Ortskundige attraktiv ist. Königsteiner Wohngebiete die zusätzlicher Schwerlastverkehrsbelastung ausgesetzt wären: -

Kelkheimer in Zeitung Allen Haushalten Ausgabe 20 / 21
SeiteAuflage 5 - Nummer 16.000 14 Erscheint wöchentlich freitagsKelkheimer in Zeitung allen Haushalten Ausgabe 20 / 21. Mai4. April2021 2019 IST EBENDIE NICHTNEUEN Im SIND DA In der Stadt Kelkheim ALLES Innenteil! seit mehr als 47 Jahren WURST zuverlässig wöchentlich DIE NEUEN TUTTO- mit Berichten und Fotos WEINE SIND AM START. 6+1 AUF (FAST) ALLE WEINE Nachrichten und Meinungen für die Stadt Kelkheim mit den Stadtteilen Münster, Mitte, Hornau, Fischbach, Ruppertshain und Eppenhain Ein leuchtendes Frühlingsgelb: Rapsblüten % chnabel Fachmarkt & Meister Fassaden Anstriche & Tapeten Gardinen & Markisen Parkett, Fliesen, Teppich www.schnabel-kelkheim.de / 06195-6868 IMMOBILIE VERKAUFEN – JETZT MIT SICHERHEIT! 06174 96100 claus-blumenauer.de Der Raps steht derzeit in voller Blüte und betört mit seinem Duft. Foto: Peter Hillebrecht WIR HABEN WEITERHIN FÜR SIE GEÖFFNET! Wenn die Kelkheimer Zeitung auf Papier mit blüten. Dieses Mal nur nicht als ganzes Feld ten Kopf der Zeitung und das Bild wecken Duftstoffen gedruckt würde, würde dem Be- fotografi ert, sondern der Fotograf spielte et- Erinnerungen an die Zeit, da die „Kelkheimer Esstischgruppe 'Paulo' Ausziehbarer Tisch und acht Stühle. trachter jetzt ein Duft entgegen strömen, der was mit dem Teleobjektiv, so dass sich die- Zeitung“ auf gelbem Papier gedruckt wurde. Tisch- und Stuhlgestelle aus schwarzem Aluminium, die Bienen bei wärmerem Wetter in Massen ses Ratebild ergab. Es soll dem Betrachter als Daher auch bei vielen Lesern heute noch die Tisch mit Keramikplatte. 180-240 x 100 cm anlockt. Beim Spaziergang in Kelkheims Ge- Zeichen des Frühlings – wenn er tatsächlich eigentlich nur liebevolle Bezeichnung „Gel- markung sieht man diese Blüten auch und noch richtig kommt – entgegen leuchten. -

Bus Linie 815 Fahrpläne & Karten
Bus Linie 815 Fahrpläne & Netzkarten 815 Eppstein-Vockenhausen Schulzentrum Im Website-Modus Anzeigen Die Bus Linie 815 (Eppstein-Vockenhausen Schulzentrum) hat 2 Routen (1) Eppstein-Vockenhausen Schulzentrum: 07:03 - 07:55 (2) Kelkheim (taunus)-eppenhain: 12:17 - 15:20 Verwende Moovit, um die nächste Station der Bus Linie 815 zu ƒnden und, um zu erfahren wann die nächste Bus Linie 815 kommt. Richtung: Eppstein-Vockenhausen Schulzentrum Bus Linie 815 Fahrpläne 13 Haltestellen Abfahrzeiten in Richtung Eppstein-Vockenhausen LINIENPLAN ANZEIGEN Schulzentrum Montag 07:03 - 07:55 Kelkheim (Taunus)-Eppenhain Dienstag 07:03 - 07:55 Schulweg, Germany Mittwoch 07:03 - 07:55 Kelkheim (Taunus)-Ruppertshain am Rosenwald Am Rosenwald, Germany Donnerstag 07:03 - 07:55 Kelkheim (Taunus)-Ruppertshain Zauberberg Freitag 07:03 - 07:55 L 3369, Germany Samstag 07:03 - 07:55 Kelkheim (Taunus)-Ruppertshain Altes Rathaus Sonntag Kein Betrieb L 3016, Germany Kelkheim (Taunus)-Ruppertshain Wiesenstraße Robert-Koch-Straße, Germany Bus Linie 815 Info Kelkheim (Taunus)-Fischbach Friedhof Richtung: Eppstein-Vockenhausen Schulzentrum Stationen: 13 Kelkheim (Taunus)-Fischbach Bürgerhaus Fahrtdauer: 30 Min Langstraße 1a, Germany Linien Informationen: Kelkheim (Taunus)- Eppenhain, Kelkheim (Taunus)-Ruppertshain am Kelkheim (Taunus)-Fischbach Taunusstraße Rosenwald, Kelkheim (Taunus)-Ruppertshain Sodener Straße 42b, Germany Zauberberg, Kelkheim (Taunus)-Ruppertshain Altes Rathaus, Kelkheim (Taunus)-Ruppertshain Kelkheim (Taunus)-Fischbach Staufenstraße Wiesenstraße, Kelkheim -

Stadt Kelkheim (Taunus)
Stadt Kelkheim (Taunus) Amt für Planen und Bauen Kelkheim den 11.05.2020 Begründung zum Bebauungsplan 66/13 "Altenhainer Straße – Am Hohenstein" der Stadt Kelkheim in der Gemarkung Fischbach Übersichtsskizze Gliederung 1. Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes ............................. Seite 3 2. Lage im Stadtgebiet / Bestandssituation .................................................................. Seite 3 3. Erfordernis der Planaufstellung – Planungsziele ..................................................... Seite 3 4. Planungsrechtliche Vorgaben und Berücksichtigung von Fachplanungen .............. Seite 3 5. Bebauungsplanverfahren .......................................................................................... Seite 4 6. Begründung der Planinhalte ..................................................................................... Seite 5 6.1 Planungsrechtliche Festsetzungen ............................................................................ Seite 5 6.2 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen ..................................................................... Seite 5 7. Auswirkungen des Bebauungsplanes ....................................................................... Seite 6 7.1 Flächenbilanz ........................................................................................................... Seite 6 7.2 Belange von Umwelt, Natur und Landschaft ........................................................... Seite 6 7.3 Ver- und Entsorgung, wasserwirtschaftliche Belange ............................................ -

Leben in Kelkheim (Taunus)
LEBEN IN KELKHEIM (TAUNUS) TIPPS UND INFORMATIONEN Handwerker- und Gewerbeverein e.V. Frankfurter Straße 77 65779 Kelkheim Telefon: 0 61 95 / 23 12 Kelkheimer Möbeltage im September mit verkaufsoffenem Sonntag Bornemann Holunder Hof Lange Innenausbau Stelzer Einrichtungshaus, Poliform Studio Einrichtungshaus und Küchenstudio Einrichtungshaus, Innenausbau Die Meisterwerkstatt Hornauer Straße 55 Bahnstraße 19 Massivholzspezialist für Möbel mit Geschichte Tel. 0 61 95 / 99 64 00 Tel. 0 61 95 / 99 25-50 von Modern bis Klassisch Frankfurter Straße 21, Tel. 0 61 95 / 20 00 Fischbacher Straße 3-7, Tel. 0 61 95 / 28 12 www.lange-innenausbau.de Sa. bis 16 Uhr geöffnet Gebrüder Wolf Einrichtungshaus Sven´s Naturholzmöbel Friebe Möbelwerkstatt Roser de Sede Studio Kompetenz in Massivholzmöbeln Wir machen IHRE MÖBEL Innenausbau – Bibliotheken und Einrichtungshaus/Innenausbau Bahnstraße 20 Zimmereinrichtungen, Einzelmöbel, Bücherwände nach Maß zwischen Kelkheim und Fischbach Tel. 0 61 95 / 90 10 20 Einbauschränke Ergänzungen zu vorhandenen Möbeln Tel. 0 61 95 / 91 05 91 Frankfurter Straße 77, Tel. 0 61 95 / 23 12 [email protected] Hauptstraße 20, Tel. 0 61 95/ 90 22 22 Bad Studio Bender Krampe Küchenstudio Merry Old England Zerwes Spezialist für kleine Bäder SieMatic Premium-Partner Innenausbau Antiquitäten und englische Lebensart Frankenallee 8 Frankfurter Straße 87 Einbauschränke ca. 1200 qm Ausstellung Zufahrt über Höchster Straße Tel. 0 61 95 / 70 99 66 Frankfurter Straße 97 Frankfurter Straße 11+4 Telefon: 0 61 95 / 6 70 79 www.kuechen-krampe.de Tel. 0 61 95 / 99 06-0 Möbel Fischer Heinz Schrimpf INSIDE GmbH Wohnzentrum und Küchenstudio Holzeinlegearbeiten Antik Möbel Mayrl Raumausstattung und Polsterei Großes Stressless-Studio Intarsien Am Flachsland 2a Frankfurter Straße 49 Hornauer Straße 12 Altenhainer Straße 6 Tel. -

German Immigrants to Baltimore: the Passenger Lists of 1854
GERMAN IMMIGRANTS TO BALTIMORE: THE PASSENGER LISTS OF 1854 PART I Edited by MORGAN H. PRITCHETT and KLAUS WUST INTRODUCTION More than thirty years ago, Lewis Kurtz, then President of the German So- ciety of Maryland and a vice president of the Society for the History of the Ger- mans in Maryland, suggested a list of immigrants of 1854 as a worthwhile item for publication in The Report. At that time numerous other articles and studies, particularly checklists of German imprints in Maryland and Virginia were wait- ing to be published and the immigrant lists were placed in the reserve file and promptly forgotten. Last year, when the collections of both societies were readied for the move to new quarters, the two present editors of these lists began to look for them among the innumerable boxes and shelves. The search proved success- ful. Pasted in the back of a service ledger were yellowed newspaper clippings with the passenger lists of thirty-nine vessels which brought 8665 passengers from Germany to the port of Baltimore in 1854. Though many port registers are extant, the re-discovery of these lists repre- sents a major event for genealogists and immigration historians alike. They con- tain the names of 5383 individuals. Though in most cases only the initial of the first name appears, almost 700 names are given in full. More important yet, how- ever, is the welcome fact that the home town or village is included for 3850 indi- viduals. For 903 persons only the home state is listed while in 630 cases no place of origin was noted. -
Overseas Military Address Designations City St Zip Country
FOC 350X4 1 of 20 OVERSEAS MILITARY ADDRESS DESIGNATIONS FCB 2001-001 1-1-2001 OVERSEAS MILITARY ADDRESS DESIGNATIONS CITY ST ZIP COUNTRY CITY APO AE 09007 GERMANY HEIDELBERG APO AE 09008 GERMANY FRANKFORT APO AE 09009 GERMANY RAMSTEIN AB APO AE 09012 GERMANY RAMSTEIN AB APO AE 09014 GERMANY HEIDELBERG APO AE 09021 GERMANY KAPAUN AS APO AE 09025 GERMANY SCHWABISCH HALL APO AE 09026 GERMANY WILDFLECKEN APO AE 09028 GERMANY SANDHOFEN APO AE 09029 GERMANY BERCHETESGADEN APO AE 09031 GERMANY KITZINGEN APO AE 09033 GERMANY SCHWEINFURT APO AE 09034 GERMANY BAUMHOLDER APO AE 09035 GERMANY NEV ULM APO AE 09036 GERMANY WURZBURG APO AE 09039 GERMANY FRANKFORT APO AE 09041 GERMANY MUNICH APO AE 09042 GERMANY SCHWETSINGEN APO AE 09044 GERMANY BINDLACH APO AE 09045 GERMANY KIRCHGOENS APO AE 09046 GERMANY BOBLINGEN APO AE 09047 GERMANY WERTHEIM APO AE 09050 GERMANY BAD TOLZ APO AE 09052 GERMANY ZWEIBRUCKEN APO AE 09053 GERMANY GARMISCH APO AE 09054 GERMANY KAISERLAUTERN APO AE 09056 GERMANY WORMS APO AE 09057 GERMANY RHEIN MAIN APO AE 09058 GERMANY WORMS APO AE 09059 GERMANY MIESAU APO AE 09060 GERMANY FRANKFORT AMT FRIEND OF THE COURT MANUAL STATE OF MICHIGAN FAMILY INDEPENDENCE AGENCY FOC 350X4 2 of 20 OVERSEAS MILITARY ADDRESS DESIGNATIONS FCB 2001-001 1-1-2001 CITY ST ZIP COUNTRY CITY APO AE 09061 GERMANY NELLIGAN APO AE 09063 GERMANY HEIDELBERG APO AE 09064 GERMANY RHEIN MAIN APO AE 09065 GERMANY OBERUSEL APO AE 09066 GERMANY ERLANGEN APO AE 09067 GERMANY KAISERLAUTERN APO AE 09068 GERMANY FURTH APO AE 09069 GERMANY BREMERHAVEN APO AE 09070 GERMANY