Häuserchronik Der Wolfsberger Altstadt
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Empire in the Provinces: the Case of Carinthia
religions Article The Empire in the Provinces: The Case of Carinthia Helmut Konrad Institut für Geschichte, Karl-Franzens-Universität Graz, Attemsgasse 8/II, [505] 8010 Graz, Austria; [email protected] Academic Editors: Malachi Hacohen and Peter Iver Kaufman Received: 16 May 2016; Accepted: 1 August 2016; Published: 5 August 2016 Abstract: This article examines the legacy of the Habsburg Monarchy in the First Austrian Republic, both in the capital, Vienna, and in the province of Carinthia. It concludes that Social Democracy, often cited as one of the six ingredients that held the old Empire together, took on distinct forms in the Republic’s different federal states. The scholarly literature on the post-1918 “heritage” of the Monarchy therefore needs to move beyond monolithic generalizations and toward regionally focused comparative studies. Keywords: empire; socialism; Jews; Habsburg Monarchy; Austria; Vienna; Carinthia; German Nationalism; Sprachenkampf 1. Introduction Which forms did the ideas take that allowed the Habsburg monarchy to persist, despite the diversity of nationalisms present in the small Republic of German-Austria, for so long after the end of the First World War? What was the “glue” that held this multiethnic empire together, when its collapse had been predicted since 1848, and which of its elements continued to exist beyond 1918? How was this heritage expressed in the different regions of the new republic? At least six factors can be identified as ingredients of the “glue” that held the monarchy together: first, the Emperor, a figure who symbolized the fusion of the complex linguistic, ethnic and religious components of the Habsburg state; second, the administrative officials, who were loyal to the Emperor and worked in the ubiquitous and even architecturally similar buildings of the Monarchy’s district authorities and train stations; third, the army, whose members promoted the imperial ideals through their long terms of service and acknowledged linguistic diversity. -

ESPON PROFECY Annex 9. Methodological Approach of CS
PROFECY – Processes, Features and Cycles of Inner Peripheries in Europe (Inner Peripheries: National territories facing challenges of access to basic services of general interest) Applied Research Final Report Annex 9 Methodological Case Study Approach Version 07/12/2017 This applied research activity is conducted within the framework of the ESPON 2020 Cooperation Programme, partly financed by the European Regional Development Fund. The ESPON EGTC is the Single Beneficiary of the ESPON 2020 Cooperation Programme. The Single Operation within the programme is implemented by the ESPON EGTC and co-financed by the European Regional Development Fund, the EU Member States and the Partner States, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. This delivery does not necessarily reflect the opinion of the members of the ESPON 2020 Monitoring Committee. Authors Paulina Tobiasz-Lis, Karolina Dmochowska-Dudek, Marcin Wójcik, University of Lodz (Poland) Francesco Mantino, Barbara Forcina, Council for Agricultural Research and Economics (Italy) Sabine Weck, Sabine Beißwenger, Nils Hans, ILS Dortmund (Germany) Advisory Group Project Support Team: Barbara Acreman and Zaira Piazza (Italy), Eedi Sepp (Estonia), Zsolt Szokolai, European Commission. ESPON EGTC: Marjan van Herwijnen (Project Expert), Laurent Frideres (HoU E&O), Ilona Raugze (Director), Piera Petruzzi (Outreach), Johannes Kiersch (Financial Expert). Information on ESPON and its projects can be found on www.espon.eu. The web site provides the possibility to download and examine the most recent documents produced by finalised and ongoing ESPON projects. This delivery exists only in an electronic version. © ESPON, 2017 Printing, reproduction or quotation is authorised provided the source is acknowledged and a copy is forwarded to the ESPON EGTC in Luxembourg. -

Verordnung Des Bundesdenkmalamtes Betreffend Den Pol
Verordnung des Bundesdenkmalamtes betreffend den pol. Bezirk Wolfsberg, Kärnten Auf Grund des § 2a des Denkmalschutzgesetzes, BGBl. I Nr. 170/1999, wird verordnet: § 1. Folgende 127 unbewegliche Denkmale des pol. Bezirkes Wolfsberg, Ger. Bez. Wolfsberg, die gemäß § 2 oder § 6 Abs. 1 leg.cit. kraft gesetzlicher Vermutung unter Denkmalschutz stehen, werden unter die Bestimmungen des § 2a Denkmalschutzgesetz gestellt: Bezeichnung Adresse EZ Gst.Nr. KG Gemeinde 9462 Bad Sankt Leonhard Stadtbefestigung (Gesamtanlage) Stadtanlage/ Bad St. Leonhard im 61; 92, 93; 95, 96, 99, Stadtmauer Lavanttal 144 121, 122, 124 77011 Bad St. Leonhard Bad St. Leonhard im Kath. Filialkirche hl. Kunigunde Lavanttal 137 .72 77011 Bad St. Leonhard Bad St. Leonhard im Kreuzwegkapelle, Ölbergkapelle Lavanttal 161 295 77011 Bad St. Leonhard Bad St. Leonhard im Friedhof christlich Lavanttal 295 546/1 77011 Bad St. Leonhard Kath. Pfarrkirche hl. Leonhard und Friedhof mit Bad St. Leonhard im Karner Lavanttal 295 .102 77011 Bad St. Leonhard Mariensäule Hauptplatz 744 942/1 77011 Bad St. Leonhard Bad St. Leonhard im Figur Christus im Leid Lavanttal 744 918 77011 Bad St. Leonhard archäologisches Kleindenkmal/ römischer Grabstein Hauptplatz 744 942/2 77011 Bad St. Leonhard Pfarrhof Hauptplatz 59 765 .67 77011 Bad St. Leonhard Bad St. Leonhard im Ehem. Spitalskirche/Zur lieben Frau Maria Lavanttal 766 .126 77011 Bad St. Leonhard Pfarrhof Schiefling 9 13 23 77013 Schiefling Kath. Pfarrkirche hl. Ägidius und Friedhof Schiefling 31 1/1 77013 Schiefling Aussichtswarte Kärntner Sonnenturm Schönberg 88 227/2 77017 Twimberg Gemeinde 9400 Frantschach-Sankt Gertraud Kath. Pfarrkirche hl. Nikolaus und Friedhof Kamp 42 12/2 77214 Kamp Kath. -

RAVI-Bulletin 20Xx
The Network of European World Meteorological Deutscher Meteorological Services Organization Wetterdienst European Climate Support World Climate Data Department Climate Network and Monitoring Programme Monitoring Annual Bulletin on the Climate in WMO Region VI - Europe and Middle East - 2009 ISSN: 1438 – 7522 Internet version: http://www.dwd.de/rcc-cm Editor: Deutscher Wetterdienst P.O. Box 10 04 65, D – 63004 Offenbach am Main, Germany Phone: +49 69 8062 2936 Fax: +49 69 8062 3759 Responsible: Peter Bissolli E-mail: [email protected] Technical assistance: Volker Zins E-mail: [email protected] Acknowledgements: Special thanks go to our colleagues G. Engel, K. Friedrich, G. Müller-Wester- meier, H. Nitsche, W. Thomas, B. Tinz and A. Walter for their valuable com- ments and corrections. This text is an extended version of the publication: A. Obregón et al., 2010: Europe, in “State of the climate in 2009”, Bull. Amer. Meteor. Soc., 91 (6), S160-S170. Annual Bulletin on the Climate in WMO Region VI - Europe and Middle East - 2009 The Bulletin is a summary of contributions from the following National Meteorological and Hydrological Services and was co-ordinated by the Deutscher Wetterdienst, Germany Armenia Austria Azerbaijan Belarus Belgium Bosnia and Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Germany Greece Hungary Iceland Ireland Israel Italy Jordan Kazakhstan Latvia Lithuania Luxembourg The Former Yugoslav Republic of Macedonia Malta Moldova Monaco Montenegro Netherlands Norway Poland Portugal -

Regional Intermediate Report Carinthia / Austria Test Areas Feldkirchen and Wolfsberg
Work package 5 « Regional studies » : Regional intermediate report Carinthia / Austria Test areas Feldkirchen and Wolfsberg Eva Favry Birgit Janach Eva Karpf-Fortin 30 November 2005 Klagenfurt, Vienna WP5 REGIONAL INTERMEDIATE REPORT CARINTHIA 051130 1 Regional intermediate report Carinthia / Austria Table of content 1. Introduction ...................................................................................................4 1.1 PUSEMOR: A general overview ............................................................4 1.2 Workpackage 5 Regional Studies: Goals, objectives and activities ......5 2. Country profile...............................................................................................9 2.1 Territorial organisation ...........................................................................9 2.2 Spatial policies in Carinthia....................................................................9 2.3 Roles and responsibilities in public services........................................10 Transport..............................................................................................10 Public administration............................................................................10 Health care and care for elderly...........................................................11 Child care, education and culture ........................................................11 Telecommunication..............................................................................12 Every day needs ..................................................................................13 -

Trips Around Graz Nature
TRIPS AROUND GRAZ NATURE. CULTURE. ENJOYMENT. SPORT. HEALTH. Right on Graz’s doorstep there are an endless number of things to Graz for sports activities or for relaxation and wellness? Things to see, enjoy and do. discover – and even more to enjoy ... Everything is possible! WELL WORTH THE TRIP! ACTIONS SPEAK LOUDER THAN WORDS! Leaving behind the urban flair of the city, it’s just a couple of miles For those who enjoy walking, the Styrian countryside offers a huge to the real countryside – how wonderful to breathe fresh air in the range of well-marked paths. Graz is “the most bicycle-friendly city midst of nature, to take in the beautiful, unspoilt Styrian landscape. in Austria”, and the surrounding area can also be explored by bike Discover striking natural wonders and cultural treasures, steeply slop- – whether on the bicycle path along the River Mur, a tour around ing vineyards, the summer residence of the world-famous Lipizzaner Graz or on the mountain bike routes. For golfers there is an Eldo- horses and massive stone fortresses of past centuries on the Styrian rado of wonderful golf courses! And if you’re after relaxation and castle route. Wherever you go, you’ll find the traditional delicacies wellness: close to the city lies a great variety of spas. of local cuisine – taste internationally renowned Styrian wines at the producer’s vineyard and buy fresh pumpkin-seed oil directly from the farmer to take back home with you! GRAZ TOURISMUS INFORMATION A-8010 Graz, Herrengasse 16, T +43/316/8075-0, F ext. -

Calliope Austria – Women in Society, Culture and the Sciences
CALLIOPE Austria Women in Society, Culture and the Sciences 1 CALLIOPE Austria Women in Society, Culture and the Sciences CALLIOPE Austria Women in Society, Culture and the Sciences Future Fund of the Republic of Austria Sources of inspiration are female – Federal Minister Sebastian Kurz 7 A new support programme for Austrian international cultural work – Teresa Indjein 9 Efforts to create equality worldwide – Ulrike Nguyen 11 An opportunity for effecting change: fundamental research on the issue of women’s rights in Austria 13 biografiA – an encyclopaedia of Austrian women 14 Ariadne – the service centre for information and documentation specific to women’s issues at the Austrian National Library 16 Protagonists for celebration, reflection and forward thinking 1 Creating facts: women and society 23 1.1 Power and powerlessness: women in the Habsburg Monarchy 25 1.2 Women’s rights are human rights: the women’s movement in Austria 31 1.3 Courageous, proactive, conspiratorial: women in the resistance against National Socialism 47 2 Creating free spaces: women and the arts 61 2.1 Women and architecture 63 2.2 Women and the fine arts 71 2.3 Women and design/graphics/applied arts 85 2.4 Women and fashion/Vienna couture 93 2.5 Women and film 99 2.6 Women and photography 111 2.7 Women and literature 121 2.8 Women and music 153 2.9 Women and theatre 163 2.10 Women and dance 173 2.11 Women and networks/salonières 181 Creating spaces for thought and action: 3 women and education 187 3.1 Schooling and higher education by women/for women and girls 189 3.2 Women and the sciences 197 3.2.1 Medicine and psychology 198 3.2.2 Natural sciences 206 3.2.3 Humanities 217 3.2.4 Social, economic and political sciences 223 Notes 234 Directory of the protagonists 254 Overview of commemoration dates and anniversaries 256 Imprint 272 Anja Manfredi Re-enacting Anna Pavlova with Heidrun Neumayer, analogue C-print, 70 x 100 cm, 2009 Sources of inspiration are female Austria is a cultural nation, where women make significant contributions to cultural and socio-political life. -

Frantschach 2018 Abschnitt 1: Einführung
Mondi Group Frantschach SEAT-Bericht 2018 www.mondigroup.com Contents Abschnitt 1: Einführung 1 Hintergrund: Wer wir sind und warum unsere SEAT-Prozesse so wichtig sind 1 Über diesen Bericht 1 Abschnitt 2: Bewertungsziele und Methodik 2 Ziele 2 Methodik 2 SEAT-Team 2 Haupt-Stakeholder 3 Danksagungen 3 Abschnitt 3: Überblick über die Umgebung 4 Abschnitt 4: Über Mondi Frantschach 5 Einführung 5 Social-Management-Systeme 5 Personalentwicklung 5 Geschlechtervielfalt 6 Mitarbeiterbefragung 6 Kommunikationspraktiken 6 Sicherheit am Arbeitsplatz 7 Soziale Aktivitäten für Mitarbeiter 8 Engagement in der Gemeinde 8 Regierungs- und Geschäftsbeziehungen 8 Ökologischer Fußabdruck und Umweltmanagement 9 Energie und CO2-Fußabdruck 10 Abfallentsorgung 10 Luft- und Wasseremissionen 11 Internationale Zertifizierungsstandards 12 Holzversorgung 13 Abschnitt 5: Ergebnisse der Bewertung 14 Allgemeine Beobachtungen 14 Beteiligung am SEAT-Prozess und Durchführung 14 Positive Erkenntnisse 14 Beschäftigung 14 Arbeits- und Gesundheitsschutz 14 Schulungen 15 Kommunikation 15 Auftragnehmer 15 Umweltmanagement 15 Investitionen in die Gemeinden und soziale Projekt 15 Mondi als Geschäftspartner 15 Identifizierte Herausforderungen und weitere Kommentare und Erwartungen der Stakeholder 16 Beschäftigung 16 Umweltprobleme 21 Interaktionen mit der Gemeinde 23 Kommunikation 24 Begriffsglossar 26 Kontaktinformationen U3 Mondi Group SEAT-Bericht Mondi Frantschach 2018 Abschnitt 1: Einführung Hintergrund: Wer wir sind und warum unsere Der SEAT-Ansatz wurde im Jahr 2005 eingeführt. Ziel war es dabei, SEAT-Prozesse so wichtig sind unsere Zellstoff- und Papierfabriken sowie unsere forstwirtschaftlichen Betriebe dabei zu unterstützen, einen offenen und transparenten Mondi ist ein weltweit führender Anbieter von Verpackungen Dialog mit ihren örtlichen Gemeinden zu führen. Durch den SEAT- und Papier und begeistert seine Kunden sowie Endverbraucher Prozess können wir besser verstehen, wo unsere Auswirkungen Einführung mit nachhaltigen Verpackungs- und Papierlösungen. -

Quo Vadis Lavanttal?« Menschen – Themen – Perspektiven
Verein Lavanttaler Wirtschaft »Quo vadis Lavanttal?« Menschen – Themen – Perspektiven Sankt Andrä Frantschach-Sankt Gertraud Sankt Georgen Lavamünd Bad Sankt Leonhard Sankt Paul Preitenegg Reichenfels Wolfsberg » ein unternehmer Das Wichtigste ist, dass es einfach eine Vorwärtsentwicklung im Tal gibt und dass alle das erkennen. 4 Vorwort des Vereins Lavanttaler Wirtschaft Dr. Wolfgang Sattler, DI-HTL-Ing. Horst Jöbstl 6 Grußworte der Förderstellen Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds, Entwicklungsagentur Kärnten 8 »Quo vadis Lavanttal?« Ausgangslage und Zielsetzung 14 Nachhaltige Wirtschaft Utopisches Konzept oder strategische Chance für kmu? 20 Jugend schafft Zukunft Schülerinnen und Schüler diskutieren die Lebens- und Arbeitsqualität im Lavanttal 26 Internationale Netzwerke mit Lavanttaler Wurzeln Große Töchter | Große Söhne 30 Zukunftskonferenz Lavanttal 2020 36 Abend der Lavanttaler Wirtschaft Zwischenergebnisse und Ausblick Vorwort Verein Lavanttaler Wirtschaft » mission statement vlw Der Verein Lavanttaler Wirtschaft verfolgt die Vision, das Lavanttal zu einer wirtschaftlichen Vorzeigeregion in Europa zu machen. »Quo vadis Lavanttal?« soll dabei eine Navigationshilfe geben. 4 der verein lavanttaler wirtschaft (vlw) wurde vor mehr als zehn Jahren mit dem Ziel gegründet, als überparteiliche und überin- stitutionelle Plattform die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Region Lavanttal zu verbessern und den Wirtschaftsstandort nach- haltig zu stärken. Der Verein hat mit seinen Aktivitäten dazu beige- tragen, dass das Lavanttal den -
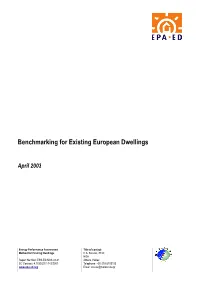
Benchmarking for Existing European Dwellings
Benchmarking for Existing European Dwellings April 2003 Energy P erformance A ssessment T itle of contact: M ethod for Existing Dwellings C .A. B a la ra s , Ph .D. NOA Report Number: EPA-ED NOA 03-01 Ath en s , H ella s EC C on tra c t: 4.1030/Z /01-142/2001 T eleph on e: + 30-210-8109152 www.epa-ed .org Ema il: c os ta s @ meteo.n oa .g r Benchmarking for Existing European Dwellings A uthor/s Date: www.epa-ed .org C .A. B a la ra s , Ph .D. April 16, 2003 NOA P roject co-ord inator Ath en s , H ella s R eport N umb er: EB M -c on s ult, Arn h em, T eleph on e: + 30-210-8109152 EPA-ED NOA 03-01 T h e Neth erla n d s Ema il: c os ta s @ meteo.n oa .g r EC C ontract M r. B a rt Poel E. Da s c a la k i, Ph .D. 4.1030/Z /01-142/2001 b poel@ eb m-consult.nl NOA Ath en s , H ella s T eleph on e: + 30-210-8109143 Ema il: ed a s k @ meteo.n oa .g r S . G eis s ler Ö Ö I V ien n a , Aus tria T eleph on e: + 43-15-236105 Ema il: g eis s ler@ ec olog y .a t K .B . W ittc h en DB U R H oers h olm, Den ma rk T eleph on e: + 45-45742395 Ema il: k bw @ by -og -by g .d k G . -
Österreich: Kärnten Und Steiermark, Slowenien) 29-112 © Naturwissenschaftlicher Verein Für Steiermark; Download Unter
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark Jahr/Year: 2008 Band/Volume: 138 Autor(en)/Author(s): Hafellner Josef Artikel/Article: Zur Diversität lichenisierter und lichenicoler Pilze im Gebiet der Koralpe (Österreich: Kärnten und Steiermark, Slowenien) 29-112 © Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark; download unter www.biologiezentrum.at Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark Bd. 138 S. 29–112 Graz 2008 Zur Diversität lichenisierter und lichenicoler Pilze im Gebiet der Koralpe (Österreich: Kärnten und Steiermark, Slowenien) von Josef Hafellner1 Mit 1 Abbildung und 2 Tabellen Angenommen am 14. November 2008 Summary: Lichenized and lichenicolous fungi of the Koralpe (Austria: Carinthia and Styria, Slovenia). – An inventory of the lichens and lichenicolous fungi so far recorded in the Koralpe range is presented. The catalogue for this part of the Eastern Alps contains 786 taxa of lichens, 107 lichenicolous fungi and 17 micromycetes frequently associated with lichens. Absconditella trivialis, Lepraria sylvicola, Lettauia cladoniicola, Listerella paradoxa and Tremella phaeophysciae are recorded for the first time in Aus- tria. For a greater number of species first records in Slovenia are reported (see chapter 4.3.). Zusammenfassung: Eine Bestandsaufnahme der Flechten und lichenicolen Pilze, die bisher im Gebirszug der Koralpe nachgewiesen werden konnten, wird vorgelegt. Der Katalog für diesem Teil der nördlichen Ostalpen enthält 786 Taxa von Flechten, 107 lichenicole Pilze und 17 oft mit Flechten asso- ziierte Mikromyceten. Absconditella trivialis, Lepraria sylvicola, Lettauia cladoniicola, Listerella paradoxa und Tremella phaeophysciae werden erstmals in Österreich nachgewiesen. Für eine größere Zahl von Arten werden erstmals Funde in Slowenien mitgeteilt (siehe Kapitel 4.3.). -

Fresh VIEW Special Edition: Austria’S Hidden Champions
Special edition | en Edited by the Austrian Federal Economic Chamber AdvAntAgE AuStriA FRESH VIEW Special edition: Austria’s Hidden Champions FRESH VIEW 1 Contents 02 Introduction 04 A spotlight on sustainable excellence 14 Hidden Champions 3.0 – A selection (2013-4) 188 Hidden Champions Index (2013-4) 200 ADVANTAGE AUSTRIA Offices Worldwide Disclosure according to §25 Media Act: FRESH VIEW is the international magazine showcasing the Austrian economy • Publisher, media owner and editorial: Austrian Federal Economic Chamber, ADVANTAGE AUSTRIA, A-1045 Vienna, Wiedner Hauptstraße 63, T +43/590 900- 4491, W www.advantageaustria.org • Publisher: Service GmbH of the Austrian Federal Economic Chamber, A-1045 Vienna, Wiedner Hauptstraße 63 • Concept: ADVANTAGE AUSTRIA • Editor in chief: David Bachmann • Text: ADVANTAGE AUSTRIA • Original design: ADVANTAGE AUSTRIA and Inhouse Media/Inhouse GmbH of the Austrian Federal Economic Chamber • Graphics: badinger.cc • Project management: Christian Zauner/assist communications • Cover and stock images: ADVANTAGE AUSTRIA and badinger.cc • Proof-reader: Michael Gray, London • Print: Wograndl Druck GmbH, A-7210 Mattersburg All rights reserved. Reproduction in whole or in part is permitted only if the source is indicated and prior agreement is given. Despite careful checking of the contents,errors cannot be ruled out. No liability can therefore be accepted for the accuracy of the content. Company texts and images are supplied exclusively by the companies. The publishing company, the editor and the authors accept no liability. Spring 2015. Austria’s Hidden Champions Hidden Champions 3.0 DER PRÄSIDENT DER WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH DR. CHRISTOPH LEITL BITTET _______________________________________________ PROGRAMM _______________________________________________ 11.00 Uhr Einlass ANLÄSSLICH DER EHRUNG IHRES UNTERNEHMENS ALS ÖSTERREICHISCHER 11.30 Uhr Begrüßung Dr.