Mariologisches Jahrbuch, 17 (2013) Bd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

CONDEMNATION of COMMUNISM in PONTIFICAL MAGISTERIUM Since Pius IX Till Paul VI
CONDEMNATION OF COMMUNISM IN PONTIFICAL MAGISTERIUM since Pius IX till Paul VI Petru CIOBANU Abstract: The present article, based on several magisterial documents, illus- trates the approach of Roman Pontiffs, beginning with Pius IX and ending with Paul VI, with regard to what used to be called „red plague”, i.e. communism. The article analyses one by one various encyclical letters, apostolic letters, speeches and radio messages in which Roman Pontiffs condemned socialist theories, either explicitly or implicitly. Keywords: Magisterium, Pope, communism, socialism, marxism, Christianity, encyclical letter, apostolic letter, collectivism, atheism, materialism. Introduction And there appeared another wonder in heaven; and behold a great red dragon, having seven heads and ten horns, and seven crowns upon his heads. And his tail drew the third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth: and the dragon stood before the woman which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born. And when the dragon saw that he was cast unto the earth, he persecuted the woman which brought forth the man child. And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus Christ (Rev 12,3-4.13.17). These words, written over 2.000 years ago, didn’t lose their value along time, since then and till now, reflecting the destiny of Christian Church and Christians – „those who guard the God words and have the Jesus tes- timony” – in the world, where appear so many „dragons” that have the aim to persecute Jesus Christ followers. -

In Fatima on the 8Th Day of the Novena
The Message of Fatima 100th Anniversary – 2017 1914-Apparition At 7 years old I (Lucia) began tending our flock of sheep. One day as we (Lucia & some friends) saw for the 1st time a figure that had a human shape, whiter than snow and which the sun turned transparent. This apparition recurred twice again without manifesting itself and always suspended in the air, over the wood at the bottom of the “Cabezo.” When questioned by her mother, “As I did not know how to explain clearly and to free myself from questions, I replied that it looked like someone wrapped in a very white sheet.” 1st 1916 Apparition of the Angel After quickly praying the rosary Lucia dos Santos with cousins Francisco & Jacinta Marto started to play a game. “We were feeding our flocks in a property belonging to my parents called “Chousa Velha,” which lies at the bottom of a hill called “Cabezo,” on the east side. It was there that the Angel appeared to us for the 1st time in the form of a youth, as white as snow, shining more brightly then the sun and as transparent as crystal. We began to see this light coming towards us and thus we gradually distinguished the features. We were taken by surprise and being half bewildered we did not say a word. On reaching us he said, “Don’t be afraid. I am the Angel of Peace. Pray with me!” And kneeling down, he bowed his forehead to the ground and made us repeat these words three times: My God, I believe, I adore, I hope and I love Thee! I beg pardon of You for those who do not believe, do not adore, do not hope and do not love You.” “Pray thus. -

Fatima and the Holy Father in This Evening's Talk on Fatima and The
Fatima and the Holy Father In this evening’s talk on Fatima and the Holy Father, I am going to cover both the Pope in the message of Fatima and the history of the Popes’ response to the Fatima message from 1917 to the present, ending with insights from Pope Benedict XVI’s recent visit to Fatima. Reference to the Holy Father occurs at least four times in the “secret” revealed to the seers on July 13, 1917 …We then looked up at Our Lady, who said to us so kindly and so sadly: “You have seen hell where the souls of poor sinners go. To save them, God wishes to establish in the world devotion to my Immaculate Heart. If what I say to you is done, many souls will be saved and there will be peace. The war is going to end: but if people do not cease offending God, a worse one will break out during the Pontificate of Pius XI. When you see a night illumined by an unknown light, know that this is the great sign given you by God that he is about to punish the world for its crimes, by means of war, famine, and persecutions of the Church and of the Holy Father. To prevent this, I shall come to ask for the consecration of Russia to my Immaculate Heart and the Communion of reparation on the First Saturdays. If my requests are heeded, Russia will be converted, and there will be peace; if not, she will spread her errors throughout the world, causing wars and persecutions of the Church. -
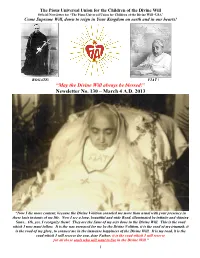
“May the Divine Will Always Be Blessed!” Newsletter No
The Pious Universal Union for the Children of the Divine Will Official Newsletter for “The Pious Universal Union for Children of the Divine Will –USA” Come Supreme Will, down to reign in Your Kingdom on earth and in our hearts! ROGATE! FIAT ! “May the Divine Will always be blessed!” Newsletter No. 130 – March 4 A.D. 2013 “Now I die more content, because the Divine Volition consoled me more than usual with your presence in these lasts instants of my life. Now I see a long, beautiful and wide Road, illuminated by infinite and shining Suns... Oh, yes, I recognize them! They are the Suns of my acts done in the Divine Will. This is the road which I now must follow. It is the way prepared for me by the Divine Volition, it is the road of my triumph, it is the road of my glory, to connect me in the immense happiness of the Divine Will. It is my road, it is the road which I will reserve for you, dear Father; it is the road which I will reserve for all those souls who will want to live in the Divine Will.” 1 The Holy Death of Luisa Piccarreta By Padre Bernardino Bucci At the news of Luisa’s death which occurred on March 4 A.D. 1947, it seemed that the people of Corato paused to live a unique and extraordinary event. Their Luisa, their Saint, was no more. And like a river in full spate they poured into Luisa’s house to look at her and express their affection to her, for so many years esteemed and beloved by all. -

Godność Człowieka I Dobro Wspólne W Papieskim Nauczaniu Społecznym
Rozdział III Godność człowieka i dobro wspólne w nauczaniu papieskim w latach 1878−1958 1. Leon XIII i fundamenty papieskiego nauczania o godności człowieka i dobru wspólnym Nikomu nie wolno naruszać bezkarnie tej godności człowie- ka, którą sam Bóg z wielka czcią rozporządza899. Cel bowiem wytknięty państwu dotyczy wszystkich oby- wateli, bo jest nim dobro powszechne, w którym uczestni- czyć mają prawo wszyscy razem i każdy z osobna, w części należnej900. Uczestnicy współczesnego dyskursu politycznego w poszukiwaniu aksjologicznych fun- damentów dla ustawodawstwa krajowego czy ponadnarodowego odwołują się do takich kategorii, jak: wolność, równość, prawa człowieka. Do tych fundamentalnych idei zaliczyć należy również dignitas humana i bonum commune901. Wydaje się poza dyskusją, że wielką rolę w przetrwaniu i rozwoju tych idei odegrała katolicka nauka społeczna, co uzasadnia poddanie analizie poglądów w tej materii twórcy papieskiego nauczania społecznego Le- ona XIII. Wybrany 20 lutego 1878 r. na papieża arcybiskup Perugii, kardynał Vincenzo Gioacchi- no Aloiso Pecci (1810−1903) przybrał imię Leona XIII. Nowy papież rozbudził w środowi- skach katolickich, zwłaszcza w kręgach zajmujących się problemami społecznymi, wielkie nadzieje na zmiany, które byłyby w stanie dostosować Kościół katolicki do istniejących 899 Rerum novarum Jego Świątobliwości Leona, z opatrzności Bożej papieża XIII, encyklika o robot- nikach z 15 maja 1891 r. Osobne odbicie z „Notyfi kacyj” Kuryi Książęco-Biskupiej w Krakowie, nr VII i VIII z roku 1891, Kraków 1891, s. 27. 900 Ibidem, s. 33. 901 Szerzej na ten temat por. M. Sadowski, Godność człowieka – aksjologiczna podstawa państwa i prawa, [w:] Studia Erasmiana Wratislaviensia − Wrocławskie Studia Erazmiańskie, Zeszyt Naukowy Studentów, Doktorantów i Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. -
Catholic Social Teaching Edited by Gerard V
Cambridge University Press 978-1-316-51360-6 — Catholic Social Teaching Edited by Gerard V. Bradley , E. Christian Brugger Frontmatter More Information catholic social teaching Catholic Social Teaching (CST) refers to the corpus of authoritative ecclesiastical teaching, usually in the form of papal encyclicals, on social matters, beginning with Pope Leo XIII’s Rerum Novarum (1891) and running through Pope Francis. CST is not a social science and its texts are not pragmatic primers for social activists. It is a normative exercise of Church teaching, a kind of comprehensive applied – although far from systematic – social moral theology. This volume is a scholarly engagement with this 130-year-old documentary tradition. Its twenty-three essays aim to provide a constructive, historically sophisticated, critical exegesis of all the major (and some of the minor) documents of CST. The volume’s appeal is not limited to Catholics, or even just to those who embrace, or who are seriously interested in, Christianity. Its appeal is to any scholar interested in the history or content of modern CST. Gerard V. Bradley is Professor of Law at the University of Notre Dame. He has been a Visiting Professor of Politics at Princeton University, a Fellow of the Hoover Institution at Stanford, and is currently a Senior Fellow of the Witherspoon Institute. At Notre Dame he is Co-Editor-in-Chief of The American Journal of Jurisprudence and serves as Co-Director of the Natural Law Institute. E. Christian Brugger is Professor of Moral Theology at St. Vincent de Paul Regional Seminary in Boynton Beach, Florida. He is author of Capital Punishment and Roman Catholic Moral Tradition, 2nd ed. -

Psc 2001 Cap 03
Sapientia II Crucis - 2001 II - 2001 Consecrations to the Holy Angels A Theological and Historical Study Part I Resumo Este artigo apresenta um estudo, em duas partes, sobre o sig- nificado e a possibilidade de uma “consagração” aos santos Anjos. Nesta parte teológica analiza-se a natureza da consagra- ção. É Deus quem consagra o homem, como se pode verificar no Antigo e no Novo Testamento e continua a realizar-se na Igreja, principalmente através dos sacramentos do Batismo, da Confir- mação e da Ordem. O homem responde a esta graça principal- mente pela fé, mas também e duma forma mais perfeita, nos con- selhos evangélicos e por atos de “devoção” (devotio), aos quais pertencem as consagrações. Pode haver também consagrações a criaturas, isto é, aos “San- tos de Deus”, pois, segundo S. Tomás de Aquino, uma tal consa- gração (devotio) não termina nas criaturas mas passa para Deus. Assim foi entendida, desde a Patrística até o Magistero atual, a consagração a Maria. O mesmo vale, analogamente, para uma consagração aos santos Anjos. A sua relação ao Batismo e aos conselhos evangélicos mostra o objetivo e a essência duma con- sagração aos santos Anjos: ela é uma aliança com eles, na qual o homem se compromete e se esforça por agir em tudo como e com os santos Anjos, cooperando pela vinda do reino de Deus, para ser mais perfeitamente unido a Cristo e tornar-se mais se- melhante a Ele. * * * I. On the Nature of a Consecration Generally speaking, a consecration means a dedication of persons or things to the divine cult. -

VENERABLE POPE PIUS XII and the 1954 MARIAN YEAR: a STUDY of HIS WRITINGS WITHIN the CONTEXT of the MARIAN DEVOTION and MARIOLOGY in the 1950S
INTERNATIONAL MARIAN RESEARCH INSTITUTE UNIVERSITY OF DAYTON, OHIO In affiliation with the PONTIFICAL FACULTY OF THEOLOGY "MARIANUM" The Very Rev. Canon Matthew Rocco Mauriello VENERABLE POPE PIUS XII AND THE 1954 MARIAN YEAR: A STUDY OF HIS WRITINGS WITHIN THE CONTEXT OF THE MARIAN DEVOTION AND MARIOLOGY IN THE 1950s A Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree Licentiate of Sacred Theology with Specialization in Mariology Director: The Rev. Thomas A. Thompson, S.M. Marian Library/International Marian Research Institute University ofDayton 300 College Park Dayton OH 45469-1390 2010 To The Blessed Virgin Mary, with filial love and deep gratitude for her maternal protection in my priesthood and studies. MATER MEA, FIDUCIA MEA! My Mother, my Confidence ii ACKNOWLEDGMENTS My sincerest gratitude to all who have helped me by their prayers and support during this project: To my parents, Anthony and Susan Mauriello and my family for their encouragement and support throughout my studies. To the Rev. Thomas Thompson, S.M. and the Rev. Johann Roten, S.M. of the International Marian Research Institute for their guidance. To the Rev. James Manning and the staff and people of St. Albert the Great Parish in Kettering, Ohio for their hospitality. To all the friends and parishioners who have prayed for me and in particular for perseverance in this project. iii Goal of the Research The year 1954 was very significant in the history of devotion to the Blessed Virgin Mary. A Marian Year was proclaimed by Pope Pius XII by means of the 1 encyclical Fulgens Corona , dated September 8, 1953. -

Télécharger En
http://www.rore-sanctifica.org Communiqué du 28 février 2010 Chronologie de la subversion liturgique à Rome – V1 Eléments de chronologie de la subversion romaine. Deux siècles de complots, infiltrations et influences contre le caractère SACRIFICIEL du Sacerdoce et de la Messe Catholiques (Version 1.0 – Fin au 8 juillet 2007, à compléter et prolonger) En préambule à la parution du tome III de Rore Sanctifica, nous publions en l’état un très important travail de recherches et de recoupements encore en cours pour établir la chronologie de la subversion de l’Église catholique par les milieux franc-maçons Rose+Croix, dirigés par les ennemis anglicano-britanniques de la Sainte Église. Nous parcourons ainsi deux siècles de complots, infiltrations et influences visant à détruire le caractère SACRIFICIEL du Sacerdoce et de la Messe Catholiques. Cette version, intitulée V1.0, s’achève au 8 juillet 2007. Elle n’inclut donc pas encore la chronologie de la subversion de la FSSPX depuis la publication du Motu Proprio (7 juillet 2007), acclamé par Mgr Bernard Fellay (!), qui vient couronner la subversion liturgique en déclarant que le faux rite de Montini-Paul VI forme, avec le rite ancien et authentique, les « deux formes d’un même rite » (sic). La chronologie de la subversion finale de la FSSPX, en marche vers son ralliement à la Révolution conciliaire, sous la conduite dissimulée du britannique ex(?) Anglican, Mgr Richard Williamson, l’« évêque à la Rose de la FSSPX », et de l’abbé Schmidberger, son second, Mgr Fellay ayant progressivement embrassé cet objectif maçonnique (Grande Loge de France) d’adhésion au modernisme subtil de l’abbé Ratzinger-Benoît XVI, sera traitée dans une deuxième version de la chronologie. -
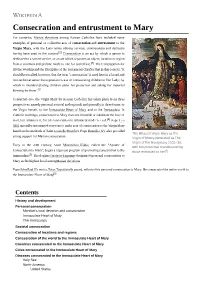
Consecration and Entrustment to Mary
Consecration and entrustment to Mary For centuries, Marian devotions among Roman Catholics have included many examples of personal or collective acts of consecration and entrustment to the Virgin Mary, with the Latin terms oblatio, servitus, commendatio and dedicatio having been used in this context.[2] Consecration is an act by which a person is dedicated to a sacred service, or an act which separates an object, location or region from a common and profane mode to one for sacred use.[3] The Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments clarifies that in this context, "It should be recalled, however, that the term "consecration" is used here in a broad and non-technical sense: the expression is use of 'consecrating children to Our Lady', by which is intended placing children under her protection and asking her maternal blessing for them".[2] Consecration to the Virgin Mary by Roman Catholics has taken place from three perspectives, namely personal, societal and regional; and generally in three forms: to the Virgin herself, to the Immaculate Heart of Mary and to the Immaculata. In Catholic teachings, consecration to Mary does not diminish or substitute the love of God, but enhances it, for all consecration is ultimately made to God.[4] Pope Leo XIII, specially encouraged everyone to make acts of consecration to the Virgin Mary based on the methods of Saint Louis de Montfort. Pope Benedict XV also provided The Blessed Virgin Mary as the strong support for Marian consecration. Virgin of Mercy venerated as The Virgin of the Navigators, 1531–36, Early in the 20th century, Saint Maximilian Kolbe, called the "Apostle of with her protective mantle covering Consecration to Mary", began a vigorous program of promoting consecration to the those entrusted to her.[1] Immaculata.[5] Theologian Garrigou-Lagrange designated personal consecration to Mary as the highest level amongMarian devotions. -

La Iglesia De La Paz En Tiempos De Guerra
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS Facultad de Ciencias Humanas y Sociales Grado en Relaciones Internacionales Trabajo Fin de Grado LA IGLESIA DE LA PAZ EN TIEMPOS DE GUERRA El papado y la Guerra Fría Estudiante: Luis Aramendía de Salas Director: Prof. Francisco Javier Lion Bustillo Madrid, Abril 2018 RESUMEN El presente trabajo académico consiste en un estudio acerca de la configuración de un nuevo concepto de Paz capaz de alcanzar una estabilidad y convivencia verdadera y fecunda. Para ello utilizaremos el escenario de la Guerra Fría y, en concreto, la labor de la Iglesia Católica como actor internacional para forjar este nuevo concepto en medio de un clima de incertidumbre y tensión internacional. De esta forma, siguiendo la línea teórica constructivista, se analizarán las esfuerzos que realizaron Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II, como representantes de la Iglesia, para configurar una concepción de Paz que pueda superar las ideas que habían puesto al mundo en una espiral de odio y violencia. PALABRAS CLAVE Iglesia; Papado; Paz; Guerra Fría; Conflicto; Constructivismo ABSTRACT This academic work consists in a study about the configuration of a new concept of Peace, which will be able to reach stability and real coexistence to the world. For that reason, we will study the Catholic Church’s performance as an international actor in the scenario of the Cold War to see how this new vision of peace was created, while the world was ruled by uncertainty and tension. Following the constructivist theory, the efforts made by the representatives of the Catholic Church (Popes: Pius XII, John XXIII, Paul VI, John Paul I and John Paul II) will be analysed, to see how they created a new Peace’s conception that could overcome the ideas that had put to the world in a spiral of hatred and violence. -

Inhaltsübersicht Über Den Jahrgang 1948
Inhaltsübersicht über den Jahrgang 1948 Objekttyp: Index Zeitschrift: Schweizerische Kirchenzeitung : Fachzeitschrift für Theologie und Seelsorge Band (Jahr): 116 (1948) PDF erstellt am: 04.10.2021 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch I<HWEIZERI<<HE KIRCHEN-ZEITUNG Redaktion: Mgr. Dr. VIKTOR v. ERNST, Kan., Prof. theol., St. Leodegarstraße 9, Luzern. - Tel. 2 02 87 Dr. phil. et theol. ALOIS SCHENKER, Prof. theol., Adligenswilerstraße 8, Luzern - Tel, 2 65 93 Inhaltsübersicht 8 © 8 © © über den Jahrgang 1948 © 8 © © I. Aktenstücke II. Allgemeines Sachregister III. Persönliches IV. Rezensionen © © © © © ©I © © © © ©©©eeeee©e©©©e999o®9o$999®90f3fc£^jyes^&(§j©e©e©e©©ee©©©©®993o®oo9a®o9oi I.