Begleitheft Sonderausstellung.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

J a H R E S B E R I C H T 2 0
GUSTAV – EBERLEIN – FORSCHUNG e.V. - Hann. Münden J A H R E S B E R I C H T 2 0 1 5 1 GUSTAV – EBERLEIN – FORSCHUNG e.V. - Hann. Münden J A H R E S B E R I C H T 2 0 1 5 . I N H A L T S V E R Z E I C H N I S Seite Schwerpunkte (Ehrengrab, Amtsübergabe, Ordensverleihungen) 3 1. Restaurieren und Erhalten von Werken 5 Restaurierung und Erhaltung in Hann. Münden / Archivierung 5 Erhaltung und Restaurierung außerhalb von Hann. Münden 8 2. Entdecken von Eberlein-Werken 10 Bisher unbekannte Werke / Neues Material zu schon bekannten Werken 10 Versteigerungen bzw. Erwerbungen 11 3. Forschung / Veröffentlichungen und Quellenmaterial 13 Einzelergebnisse 13 Veröffentlichungen 16 4. Präsentation von Werken / Öffentlichkeitsarbeit 19 Öffentlichkeitsarbeit durch Ausstellungen und Vorträge 20 Öffentlichkeitsarbeit durch Medien / Internet / Presseartikel 20 Öffentlichkeitsarbeit durch Teilnahme an Ereignissen 22 5. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen / Wissen- 22 schaftlerinnen / Wissenschaftlern / Interessierten 6. Entwicklung des Vereins / Organisation / Finanzierung 22 7. Anlage: Ordensverleihungen Prof. Grimm mit Abbildungen 24 2 GUSTAV – EBERLEIN – FORSCHUNG e.V. - Hann. Münden J A H R E S B E R I C H T 2 0 1 5 Vorbemerkung: Der Jahresbericht 2015 folgt derselben Gliederung wie die der zurückliegenden. Dadurch ist er mit ihnen leicht vergleichbar. Auf Anfrage wird er gern in digitaler Form als Mailanhang versendet. Darin blau gekennzeichnete Links können direkt aus der Datei geöffnet werden (STRG+Klicken). Hinweis: Ein USB-Stick oder eine DVD mit allen Jahresberichten seit 1982, verschiedenen Texten und Fotos (u.a. -

Ftaketettflugplafc Berlin
A 1015 F MITTEILUNGEN DES VEREINS FÜR DIE GESCHICHTE BERLINS GEGRÜNDET 1865 88. Jahrgang Heft 1 Januar 1992 Rcisbifoliofhek ig der Ber!!f»r StodtbiWiathe» Der „Bogenschütze" im Schloßpark von Sanssouci, Parterre der Neuen Orangerie, Aufnahme November 1990 (Foto: Schmidt) Plastiken in Berlin: Der „Bogenschütze" von Ernst Moritz Geyger Ein Berliner Bildhauer und sein populärstes Werk Von Martin H. Schmidt Nur schwer läßt sich die gigantisch erscheinende Skulptur des „Bogenschützen" von Ernst Moritz Geyger im Schloßpark von Sanssouci übersehen. Seit 1961 steht der — von dem Potsda mer „Blechner" Gustav Lind1 in Kupfer getriebene — nackte Jüngling im Parterre der Neuen Orangerie; er hatte ursprünglich (seit 1902) im Sizilianischen Garten und zwischenzeitlich (1927—1960) in der Nähe des Hippodroms Aufstellung gefunden. Folgende Bemerkungen seien zunächst dem Schöpfer des „Bogenschützen" gewidmet: Der Künstler Ernst Moritz Geyger — Sohn eines Schuldirektors2 — wurden am 9. November 1861 in Rixdorf (heute Berlin-Neukölln) geboren. Mit sechzehn Jahren begann er seine künst lerische Ausbildung in der Malklasse der Kunstschule in Berlin und setzte sie von 1878 bis 1883 an der akademischen Hochschule fort. Wie auf viele junge Künstler übte sein Lehrer, der Tier maler Paul Meyerheim, auf die früh entstandenen Gemälde und Graphiken des Eleven einen unübersehbaren Einfluß aus.3 Trotz positiver Erwähnungen aus den Reihen zeitgenössischer Kritiker scheiterte Geygers Versuch, im Atelier des staatstragenden Künstlers der Wilhelmini schen Ära, Anton von Werner, unterzukommen. Als Geygers Hauptwerk in der Gattung der Malerei gilt das große Ölgemälde „Viehfütterung" von 1885. Ein breites Publikum erreichte der Künstler mit satirischen Tiergraphiken; die Radierungen, Kranich als „Prediger in der Wüste", „Elephant bei der Toilette" oder „Affen in einem Disput über den von ihrer Sippe ent arteten Menschen", riefen bei jeder öffentlichen Präsentation „das Entzücken der Laien wie der Kenner in gleichem Maße hervor. -
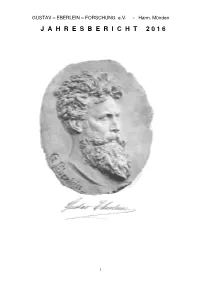
J a H R E S B E R I C H T 2 0
GUSTAV – EBERLEIN – FORSCHUNG e.V. - Hann. Münden J A H R E S B E R I C H T 2 0 1 6 1 GUSTAV – EBERLEIN – FORSCHUNG e.V. - Hann. Münden J A H R E S B E R I C H T 2 0 1 6 . I N H A L T S V E R Z E I C H N I S Seite Schwerpunkte (Ehrengrab, Dauer- und Sonderausstellung 3 1. Restaurieren und Erhalten von Werken 5 Restaurierung und Erhaltung in Hann. Münden / Archivierung 5 Erhaltung und Restaurierung außerhalb von Hann. Münden 7 2. Entdecken von Eberlein-Werken 7 Versteigerungen bzw. Erwerbungen 7 Neues Material zu schon bekannten Werken / Bisher unbekannte Werke 7/8 3. Forschung / Veröffentlichungen und Quellenmaterial 10 Weitergabe von digital gespeicherten Forschungsergebnissen 10 Veröffentlichungen 10 4. Präsentation von Werken / Öffentlichkeitsarbeit 11 Öffentlichkeitsarbeit durch Ausstellungen und Vorträge 12 Öffentlichkeitsarbeit durch Medien / Internet / Presseartikel 14 Öffentlichkeitsarbeit durch Teilnahme an Ereignissen 16 5. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen / Wissen- 16 schaftlerinnen / Wissenschaftlern / Interessierten 6. Entwicklung des Vereins / Organisation / Finanzierung 17 Anhang 19 2 GUSTAV – EBERLEIN – FORSCHUNG e.V. - Hann. Münden J A H R E S B E R I C H T 2 0 1 6 Vorbemerkung: Der Jahresbericht 2016 folgt derselben Gliederung wie die der zurückliegenden. Dadurch ist er mit ihnen leicht vergleichbar. Auf Anfrage wird er gern in digitaler Form als Mailanhang versendet. Da- rin blau gekennzeichnete Links können direkt aus der Datei geöffnet werden (STRG+Klicken) . Hinweis: Ein USB-Stick oder eine DVD mit allen Jahresberichten seit 1982, verschiedenen Texten und Fotos (u.a. -

2/1-Spaltig, Mit Einrückung Ab Titelfeld
Landesarchiv Berlin E Rep. 061-16 Nachlass Rudolf Mosse Findbuch Inhaltsverzeichnis Vorwort II Verzeichnungseinheiten 1 Behörden und Institutionen 151 Firmenindex 151 Personenindex 151 Sachindex 165 Vereine und Vereinigungen 170 E Rep. 061-16 Nachlass Rudolf Mosse Vorwort I. Biographie Rudolf Mosse wurde am 9. Mai 1843 in Grätz (Posen) geboren. Nach der Schulzeit ging er 1861 für eine Buchhandelslehre nach Berlin, wo er zunächst im Verlag des "Kladderadatsch" mitarbeitete. Wenig später übernahm er in Leipzig die Geschäftsleitung des "Telegraphen" und wirkte außerdem so erfolgreich in der Anzeigenaquisition der "Gartenlaube", dass man ihm eine Teilhaberschaft anbot. Mosse schlug das Angebot jedoch aus und zog 1866 wieder nach Berlin, wo er 1867 die "Annoncen-Expedition Rudolf Mosse" gründete. Obwohl dieses erste Geschäft bankrott ging, gelang 1870/71 ein zweiter Versuch. Mosse gründete ergänzend dazu 1872 seine erste Zei- tung, das "Berliner Tageblatt", mit bedeutendem Inseratenteil. Er pachtete außerdem Insera- tenteile von anderen Zeitungen und Zeitschriften, um sie ausschließlich mit Inseraten seiner Vermittlung zu bestücken. Mosse baute sein Unternehmen durch die Gründung eines Ver- lags aus; 1889 gründete er gemeinsam mit Emil Cohn die "Berliner Morgenpost" und über- nahm 1904 die "Berliner Volkszeitung". Der erfolgreiche Verleger konnte mit seinen Unternehmen ein bedeutendes Vermögen er- werben. Vor Beginn des Ersten Weltkriegs galt Mosse als Berlins größter Steuerzahler. Ru- dolf Mosse war verheiratet mit Emilie, geb. Loewenstein (1851-1924). 1893 adoptierte er die fünfjährige Felicia. Rudolf Mosse war eine gesellschaftlich außerordentlich stark engagierte Persönlichkeit. Er wirkte in zahlreichen Ausschüssen, Vereinen und Gremien mit. Gemeinsam mit seiner Frau betätigte er sich an gemeinnützigen Projekten. Emilie Mosse gründete beispielsweise 1888 den ersten Mädchenhort in Berlin. -

The German Bundestag in the Reichstag Building
The German Bundestag in the Reichstag Building The German Bundestag in the Reichstag Building 6 Foreword by the President of the German Bundestag, Wolfgang Schäuble Hans Wilderotter 9 “Here beats the heart of democracy” Structure and function of the Bundestag 10 The ‘forum of the nation’: the Bundestag at the heart of the German Constitution 14 “Representatives of the whole people”: the Members of Parliament 22 “The President shall represent the Bundestag”: the President of the Bundestag, the Presidium and the Council of Elders 32 “Permanent subdivisions of the Bundestag”: the parliamentary groups 40 “Microcosms of the Chamber”: the committees 48 Strategy and scrutiny: study commissions, committees of inquiry, the Parliamentary Oversight Panel and the Parliamentary Commissioner for the Armed Forces 54 “The visible hub of parliamentary business”: the plenary chamber 62 “Federal laws shall be adopted by the Bundestag”: legislation and legislative processes 76 “Establishing a united Europe”: Bundestag participation in the process of European integration Content Hans Wilderotter 83 The long road to democracy Milestones in Germany’s parliamentary history 84 “... the real school of Vormärz liberalism”: parliaments in Germany before 1848 88 “We will create a constitution for Germany”: the German National Assembly in St Paul’s Church, Frankfurt am Main 106 A “written document as the Constitution of the Prussian Kingdom”: the constituent National Assembly and the Prussian House of Representatives in Berlin 122 Democracy without parliamentarianism: -

Zwischen Altjapanischer Tradition Und Westlicher Innovation. Der Beginn Der Modernen Japanischen Skulptur Unter Europäischem Einfluß Um 1900
Kunstgeschichte Zwischen altjapanischer Tradition und westlicher Innovation. Der Beginn der modernen japanischen Skulptur unter europäischem Einfluß um 1900 Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster (Westf.) vorgelegt von Kazue Honda, M.A. aus Takarazuka, Japan 2005 Tag der mündlichen Prüfung: 21. 7. 2005 Dekan: Professor Dr. Dr. h. c. Wichard Woyke Referenten: Professor Dr. Joachim Poeschke Professor Dr. Jürg Meyer zur Capellen 2 Inhaltsverzeichnis I. Einleitung …………………………………………………. 6 1. Gegenstand …………………………………………………. 6 2. Thematik und Forschungslage …………………………. 7 3. Untersuchungsziel …………………………………………. 11 4. Vorbemerkungen …………………………………………. 12 II. Vorgeschichte …………………………………………………. 13 1. Japanische Skulptur vor 1868 …………………………. 14 a. Terrakotta-Figuren: Haniwa …………………………. 14 b. Buddhistische Skulptur der Tori-Schule um 600 ….. 15 c. Entstehung der japanischen Porträtkunst ……………. 20 d. Niedergang der religiösen Skulptur: Situation um 1868 …………………………………. 24 2. Die erste Begegnung Japans mit Europa und die Abschließung gegenüber dem Westen ………….. 27 III. Kunstpolitik der Meiji-Regierung nach 1868 …………… 30 1. Technische Kunstschule ………………………………….. 32 a. Italien als Land der Kunst ………………………….. 32 b. Vincenzo Ragusa als Vermittler der akademischen Bildhauerkunst Europas …………… 35 c. Bildhauerklasse Ragusas ………………………….. 39 d. Schließung der Technischen Kunstschule ………….. 44 e. Japanische Schüler Ragusas …………………….. ….. 46 3 2. Westliche Bildhauerei und -

Nach Persönlichkeiten Benannte Straßen
Nach Persönlichkeiten benannte Straßen Vorhandenes WI Straßenname: Erläuterung zur Person: Zusatzschild: JA NEIN Abeggstraße Luise Abegg, * 1827 in Danzig, † 3.6.1880 in Wiesbaden, Stiftung für wohltätige Zwecke Abraham-Lincoln-Straße Abraham Lincoln, * 12.2.1809 bei Hodgenville, † 15.4.1865 in Washington (D.C.) Präsident der USA Adalbert-Stifter-Straße (Sonnenberg) Adalbert Stifter, * 23.10.1805 in Oberplan, † 28.1.1868 in Linz Schriftsteller Adamstal (Wohnplatz) Adam Haßloch, * 9.8.1778 in Wiesbaden, † 12.11.1842 in Wiesbaden Ökonom, Landwirtschaftsreformer Adelheidstraße Adelheid von Anhalt-Dessau, Frau Herzog Adolfs von Nassau * 25.12.1833, † 24.11.1916 auf Schloß Königstein Adolfsallee Adolf Herzog von Nassau (1817-1905), Großhzg. von Luxemburg X Adolfsberg ? Adolf Herzog von Nassau (1817-1905), Großhzg. von Luxemburg Adolfsgäßchen (Biebrich) Adolf Herzog von Nassau (1817-1905), Großhzg. von Luxemburg Adolf-Schneider-Straße (Rambach) Adolf Schneider, * 6.5.1884 in Rambach, † 12.2.1972 X Maurer, Gewerkschafter, Ortsvorsteher in Rambach Adolfstraße Adolf Herzog von Nassau (1817-1905), Großhzg. von Luxemburg Adolf-Todt-Straße (Biebrich) Adolf Todt, * 29.3.1886 in Oestrich, † 10.8.1960 X Direktor der Firma Kalle, Kommunalpolitiker Alban-Köhler-Straße (Bierstadt) Alban Köhler, * 1.3.1874 in Petsa bei Altenburg, † 26.2.1947 in Niederselters X Radiologe Albertsberg (Frauenstein) Familie von Allendorf (1361 Burglehen von Mainz), verballhornt von "allendorffs berg" Albertstraße (Biebrich) Familie Albert (Chemische Werke Albert und Kurt Albert GmbH) Albert-Schweitzer-Allee (Biebrich) Albert Schweitzer, * 14.1.1875 in Kaysersberg, † 5.9.1965 in Lambarene (Gabun) Arzt und Theologe, Friedensnobelpreisträger Albert-Schweitzer-Platz (Biebrich) wie vor Albrecht-Dürer-Anlagen Albrecht Dürer, * 21.5.1471 in Nürnberg, † 6.4.1528 ebda. -

Bibliotheksmagazin 14 (2019), 2
BIBLIOTHEKSMAGAZIN 2/19 kurz notiert kurz notiert kurz notiert kurz notiert Bestaunen Sie Sammelobjekte vom IIIF UND MIRADOR-WEITERENT- 17. bis 20. Jahrhundert und entde- WICKLUNG MIT STANFORD cken Sie bibliophile Kostbarkeiten Die Bayerische Staatsbibliothek aus den Regionen Bayerns, die sonst beteiligt sich im Rahmen ihres meist im Verborgenen in den Treso- Engagements in der weltweiten ren und Magazinen der Bibliotheken IIIF-Community an der Neuentwick- ruhen. Wer es partout nicht mehr lung der Viewer-Applikation Mirador schaffen sollte, in die Ludwigstraße 3 in Zusammenarbeit mit der Stanford zu kommen oder wer erkunden möch- University. te, was in den Teilen I und II präsen- Für den Start des Projektes waren tiert wurde, dem empfehlen wir die zwei Entwickler des Münchener Digi- virtuelle Ausstellung unter talisierungszentrums eine Woche lang www.gott-welt-bayern.de. an der Stanford University in Palo kurz notiert Die nächste Jahresausstellung der Alto zu einem Kick-Off Workshop Bayerischen Staatsbibliothek wird für die Entwicklung. In besonderem kurz notiertENDSPURT FÜR ,GOTT, DIE WELT sich übrigens 2020 dem haus- Fokus bei der Neuentwicklung stehen UND BAYERN‘ eigenen Bildarchiv widmen. die verbesserte Unterstützung für Nur noch bis 7. Juli ist Teil III der „München – Schau her!“ zeigt vor mobile Endgeräte, sowie eine mo- großen Jahresausstellung 2018/2019 allem die Landeshauptstadt Bayerns dernere Oberfläche und eine bessere der Bayerischen Staatsbibliothek zu in historischen Aufnahmen vom Erweiterbarkeit durch Dritt-Kompo- sehen. Die Themen Krieg und Frie- Beginn der Fotografie bis in die nenten. den, Freud und Leid stehen im Fokus jüngste Vergangenheit. des letzten Teils der Ausstellungstri- Bild: J. Wolf und B. -

Archiv Der Abschlussarbeiten Am IEK
Archiv der Abschlussarbeiten am IEK 1993 Abgeschlossene Dissertationen Bei Prof. Riedl • Sabine Bock: Künstlerische Aktivitäten anläßlich von Jubiläen der Universität Heidelberg. • Karin Bury: Der Bildhauer Kurt Lehmann. • Sylvia Jäkel-Scheglmann: "Zum Lobe der Frauen". Untersuchungen zum Bild der Frau in der niederländischen Genremalerei des 17. Jahrhunderts. • Felix Reuße: Das Denkmal an der Grenze seiner Sprachfähigkeit. • Barbara Stark: Emil Rudolf Weiß (1875-1942). Monographie und Katalog seines Werkes. • Friederike Werner: Ägyptische Motive in der Architektur des 19. Jahrhunderts. • Holger Wilmesmeier: Deutsche Avantgarde und Film. Die Filmmatinee Der absolute Film (3. und 10. Mai 1925). Bei Prof. Schubert • Hubertus Adam: "Deutschsprechung". Nietzscherezeption in der bildenden Kunst zwischen Nationalismus und "Nationalsozialismus". • Christine Bretzer: Wyndham Lewis und der Erste Weltkrieg. • Jan Kneher: Edvard Munch in seinen Ausstellungen 1892-1912, eine Dokumentation der Ausstellungen und eine Studie zur Rezeptionsgeschichte von Munchs Kunst. • Martina Wehlte-Höschele: Der Deutsche Künstlerbund - Gründung und erste Ausstellungen. Bei Prof. Seidel • Almut Stolte: Frühe Miniaturen zu Dantes Göttlicher Komödie. Der Codex Egerton 943 der British Library in London. Begonnene Dissertationen Bei Prof. Fritz • Christoph Emmendörffer: Hans Kemmer, ein Lübecker Maler der Reformationszeit. • Bärbel Roth: Sakrale und profane Glasmalerei in Heidelberg zwischen Historismus und Jugendstil unter besonderer Berücksichtigung des Glasmalerei-Betriebs Heinrich Beiler. • Kai Winter: Der evangelische Kirchenbau des späten 17. und 18. Jahrhunderts und seine Ausstattung in der Pfalz unter besonderer Berücksichtigung der theologischen und liturgischen Situation. Bei Prof. Hesse • Andrea Bartelt: Das weibliche Rollenporträt im Frankreich des 18. Jahrhunderts (Arbeitstitel). • Jeanette Droste: Philip Johnson. Leben und Werk. • Daniela Dücker: Neue Theaterarchitektur in Frankreich. • Cornelia Huber: Der Klassizismus und das Ende der klassischen Architekturrede. -

Hermann Sudermann and the Liberal German Bourgeoisie
University of Massachusetts Amherst ScholarWorks@UMass Amherst Doctoral Dissertations Dissertations and Theses July 2016 Pessimism in Progress: Hermann Sudermann and the Liberal German Bourgeoisie Jason Doerre University of Massachusetts Amherst Follow this and additional works at: https://scholarworks.umass.edu/dissertations_2 Part of the European History Commons, German Literature Commons, and the Intellectual History Commons Recommended Citation Doerre, Jason, "Pessimism in Progress: Hermann Sudermann and the Liberal German Bourgeoisie" (2016). Doctoral Dissertations. 652. https://doi.org/10.7275/8322692.0 https://scholarworks.umass.edu/dissertations_2/652 This Open Access Dissertation is brought to you for free and open access by the Dissertations and Theses at ScholarWorks@UMass Amherst. It has been accepted for inclusion in Doctoral Dissertations by an authorized administrator of ScholarWorks@UMass Amherst. For more information, please contact [email protected]. PESSIMISM IN PROGRESS: HERMANN SUDERMANN AND THE LIBERAL GERMAN BOURGEOISIE A Dissertation Presented by JASON J. DOERRE Submitted to the Graduate School of the University of Massachusetts Amherst in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY May 2016 German and Scandinavian Studies © Copyright by Jason J. Doerre 2016 All Rights Reserved PESSIMISM IN PROGRESS: HERMANN SUDERMANN AND THE LIBERAL GERMAN BOURGEOISIE A Dissertation Presented by JASON J. DOERRE Approved as to style and content by: ____________________________________________________ -

Grabmäler Des 19. Jahrhunderts Im Rheinland Zwischen Identität, Anpassung Und Individualität
Grabmäler des 19.Jahrhunderts im Rheinland zwischen Identität, Anpassung und Individualität. Inaugural - Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich - Wilhelms - Universität zu Bonn vorgelegt von Ulrike Evangelia Meyer -Woeller aus Erlangen Bonn 1999 2 Gedruckt mit der Genehmigung der Rheinischen Friedrich - Wilhelms - Universität 1.Berichterstatter: Prof.Dr. Zehnder 2.Berichterstatter: Prof.Dr. Cox Tag der mündlichen Prüfung: 30. Juni 1999 3 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis ........................................................3 Vorwort ...................................................................4 I.Politische, wirtschaftliche und kulturelle ..............................6 Entwicklung des Rheinlandes .............................................6 II.Die Entwicklung der Friedhöfe .........................................29 III.Friedhof und Landschaftsgarten .......................................42 IV.Aufgabe und Funktion von Friedhöfen und ...............................48 Grabmälern im 19.Jahrhundert ..........................................48 V.Grabmal und Denkmal ....................................................54 VI. Die Schöpfer der Grabmäler: ..........................................63 Künstler, Handwerker und Industrie ...................................63 VII.Zur Stildiskussion allgemein und in Bezug ............................69 auf Grabkunst ........................................................69 Klassizismus ............................................................................................................................................. -

Kurzbiographien Der Künstler-Medailleure Und Der Privaten Prägeanstalten
KURZBIOGRAPHIEN DER KÜNSTLER-MEDAILLEURE UND DER PRIVATEN PRÄGEANSTALTEN Die biographischen Angaben wurden auf wesentliche Fakten und Ereignisse zum Ausbildungs- und Werdegang beschränkt. Für weitere ausführlichere biographische und bibliographische Informationen sei auf die einschlägig bekannten, zumeist zitierten Künstlerlexika verwiesen (Thieme-Becker (ThB), Vollmer, Forrer und Saur). An Literaturtiteln wurden in der Regel nur solche aufgenommen, die das plastische Schaffen eines Künstlers, vor allem das Medaillenschaffen mittelbar oder unmittelbar betreffen. Achtenhagen, Wilhelm (biographische Daten unbekannt bzw. nicht ermittelt) Medailleur in Magdeburg, A. war mit Medaillen auf der Deutschen Kunstausstellung 1906 in Köln vertreten, er trat später mit einer Reihe von Weltkriegsmedaillen hervor, Exemplare in der Sammlung der Hamburger Kunsthalle (siehe dazu Salaschek 1980, S. 1-2) Lit.: - Akerberg, Karl (biographische Daten unbekannt bzw. nicht ermittelt) Lit.: - Amberg, Adolf (31.7.1874 Hanau – 3.7.1913 Berlin) Bildhauer, Maler und Medailleur, 1884-1885 Studium an der Zeichenakademie in Hanau, 1888 an der Kunstgewerbeschule in Hanau, Studienaufenthalte führten ihn an die Berliner Kunstgewerbeschule und nach Paris, an die Akademien Julian und Colarossi. In Berlin war er Meisterschüler von Louis Tuaillon. Lit.: ThB 1, S. 386 – Vollmer 1, S. 39 – Forrer 1, S. 513 – Saur 3, S. 119-120 Arnoldt, Hans (2.10.1860 Wittenberg – gest. 1913 Berlin) Bildhauer, 1879-1881 Schüler an der Münchener Akademie, 1881-1883 bei Albert Wolff und Fritz Schaper (1881-1882) an der Berliner Akademie, seit 1886 selbständig tätig, 1894 Mitglied im Verein Berliner Künstler. Lit.: ThB 2, S. 135 – Vollmer 5, S. 253 – Saur 5, S. 238-239 Aurich, Oskar (8.10.1877 Neukirchen/Erzgebirge – gest. November 1968 Dresden ?) Bildhauer, Aurich studierte zunächst an der Kunstgewerbeschule in Dresden, von 1898-1902 an der Münchener Akademie, 1905 in Dresden, er schuf Genreplastiken, Porträtbüsten und Kriegerdenkmäler.