Leseprobe Aus
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ÿþm I C R O S O F T W O R
Leeds Studies in English Article: Robert Cox, 'Snake rings in Deor and Vǫlundarkviða', Leeds Studies in English, n.s. 22, (1991), 1-20 Permanent URL: https://ludos.leeds.ac.uk:443/R/-?func=dbin-jump- full&object_id=121852&silo_library=GEN01 Leeds Studies in English School of English University of Leeds http://www.leeds.ac.uk/lse \ Snake Rings in Deor and Vglundarkvida Robert Cox The troubles of Welund, alluded to in the first section of Deor, are relatively well- understood, given fuller versions of the legend in Vglundarkvida and pidriks saga, and thanks to graphic corroboration of the story on the Franks casket and elsewhere.1 Welund him be wurman wrasces cunnade, anhydig eorl, earfoda dreag, haefde him to gesibbe sorge ond longab, wintercealde wraece, wean oft onfond sibban hine Nibhad on nede legde, swoncre seonobende, on syllan monn.2 [Welund 'among snakes' endured torment, the resolute hero, endured troubles, had for company sorrow and frustration, wintercold wretchedness, often felt woe after Nibhad laid fetters on him, supple sinew-bonds, upon the good man.]3 Yet the phrase 'be wurman' in the opening verse leaves editors and translators, like Welund, in some difficulty. My purpose in this paper is to explore the nature and extent of the difficulty and to offer evidence in support of a reading originally suggested by Kemp Malone, but not widely adopted by subsequent editors or translators. Even the preposition 'be' in 'be wurman' is troublesome. 'Be' cannot have instrumental meaning ('by means of, using') in this context, but its -

The Karlamagnús Compendium
Háskóli Íslands Hugvísindasvið Medieval Icelandic Studies The Karlamagnús Compendium Genre and Meaning in AM 180a-b fol. Ritgerð til M.A.-prófs Harry Williams Kt.: 151183-4419 Leiðbeinandi: Svanhildur Óskarsdóttir September 2017 Abstract This thesis is an examination of the fifteenth century manuscript AM 180a-b fol.; made up of a copy of the A version of Karlamagnús saga (180a) and seven further sagas - Konráðs saga keisarasonar, Dunstanus saga, Katrínar saga, Bærings saga, Knýtlinga saga, Vitus saga and Laurentius saga (180b), it originally formed one codex. The thesis has two main aims: to consider the generic position of Karlamagnús saga as it existed for the compilers of the manuscript and to speculate on the producers, purpose and use of the manuscript by means of a holistic consideration of its parts. The first aim is prompted by viewing the sagas of 180b as a reflection of the generic ambiguity of Karlamagnús saga. While patently belonging to the riddarasögur, Karlamagnús saga has affinities with hagiography and the konungasögur; representatives of these three generic classes are to be found in 180b. Structured by the theme of saintliness, in which a chronological line of saintly figures is presented, as well as shared geographical referents, the codex is marked by a wide-ranging intellectual curiosity. This is attributed to the concerns of the North Icelandic Benedictine School, the presence of which is marked in the manuscript, and to the wider intellectual atmosphere of fourteenth century Iceland in which saints' lives and romances were possibly written by the same people. 2 Ágrip Þessi ritgerð skoðar fimmtándu aldar handritið AM 180a-b fol.; sem samanstendur af A gerð Karlamagnúsar sögu (180a) ásamt sjö öðrum sögum- Konráðs sögu keisarasonar, Dunstanusar sögu, Katrínar sögu, Bærings sögu, Knýtlinga sögu, Vitus sögu og Laurentiusar sögu (180b), sem upphaflega mynduðu saman eitt handrit. -

Der Herr Der Bilder. Vorstellungslenkung Und Perspektivierung Im „Laurin“*
4 10.3726/92140_487 487 BJÖRN REICH Der Herr der Bilder. Vorstellungslenkung und Perspektivierung im „Laurin“* „Czu Berne waz geseßen / eyn degen so vormeßen /der waz geheysen Dytherich“ 1 (VV. 1 ff.) – so lauten die ersten Verse des Laurin. Dieser Prolog mit der waz gesezzen- Formel und dem anschließenden ‚Heldenvergleich‘, wie er sich ähnlich im Sigenot oder 2 Eckenlied findet, bildet den typischen Textbeginn für die aventiurehafte Dietrichepik. Wie so oft geht es um die Frage nach der Exzellenz Dietrichs von Bern. Diese Exzellenz – wiewohl zunächst im Herrscherlob bestätigt („sie pristen en vor alle man“, V. 19) – wird (ähnlich wie im Eckenlied) sogleich durch Hildebrand in Frage gestellt, der darauf hinweist, dass Dietrich die Aventiure der Zwerge unbekannt sei. Es geht wieder einmal 3 darum, das Heldentum Dietrichs auszuloten oder besser, das ‚Bild‘/die imago, die Vorstel- lung von dem, was bzw. wer ‚Dietrich‘ sei, zu umkreisen, denn die fama Dietrichs sichert ihm nie einen festen Status, immer wieder keimen Zweifel an seinem Heldentum auf.4 Bei der Frage nach dem ‚Bild‘ Dietrichs von Bern, also der Frage danach, ob die positiven Vorstellungen, die man sich von Dietrich macht, gerechtfertigt sind oder nicht, ist der Laurin ein besonders interessanter Text: Dietrich bekommt es hier mit einem Gegner zu tun, der sich als ein wahrer Meister der ‚Bilder‘ und grandioser Manipula- tor von Vorstellungen entpuppt. Im Folgenden soll gezeigt werden, welche bildsteuernde, imaginationsbeeinflussende Kraft der Zwerg Laurin besitzt und wie sie zur Gefahr für Dietrich und seine Gesellen wird (I.). An das Thema der imaginativen Manipulation anschließend, wird die Handlung des Textes einem ständigen Wechsel von Perspek- tivierungen unterworfen (II.). -

Jordanes and the Invention of Roman-Gothic History Dissertation
Empire of Hope and Tragedy: Jordanes and the Invention of Roman-Gothic History Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Brian Swain Graduate Program in History The Ohio State University 2014 Dissertation Committee: Timothy Gregory, Co-advisor Anthony Kaldellis Kristina Sessa, Co-advisor Copyright by Brian Swain 2014 Abstract This dissertation explores the intersection of political and ethnic conflict during the emperor Justinian’s wars of reconquest through the figure and texts of Jordanes, the earliest barbarian voice to survive antiquity. Jordanes was ethnically Gothic - and yet he also claimed a Roman identity. Writing from Constantinople in 551, he penned two Latin histories on the Gothic and Roman pasts respectively. Crucially, Jordanes wrote while Goths and Romans clashed in the imperial war to reclaim the Italian homeland that had been under Gothic rule since 493. That a Roman Goth wrote about Goths while Rome was at war with Goths is significant and has no analogue in the ancient record. I argue that it was precisely this conflict which prompted Jordanes’ historical inquiry. Jordanes, though, has long been considered a mere copyist, and seldom treated as an historian with ideas of his own. And the few scholars who have treated Jordanes as an original author have dampened the significance of his Gothicness by arguing that barbarian ethnicities were evanescent and subsumed by the gravity of a Roman political identity. They hold that Jordanes was simply a Roman who can tell us only about Roman things, and supported the Roman emperor in his war against the Goths. -
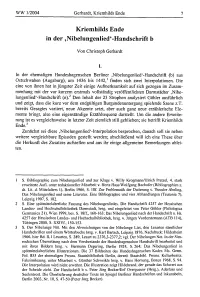
Handschrift B
WW 1/2004 Gerhardt, Kriemhilds Ende 7 Kriemhilds Ende in der ,NibeIungenlied'-Handschrift b Von Christoph Gerhardt I. In der ehemaligen Hundeshagenschen Berliner ,Nibelungenlied'-Handschrift (b) aus Ostschwaben (Augsburg), um 1436 bis 1442,' finden sich zwei Interpolationen. Die eine von ihnen hat in jüngster Zeit einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen im Zusam menhang mit der vor kurzem erstmals vollständig veröffentlichten Darmstädter ,Nibe- lungenlied'-Handschrift (n).2 Den Inhalt der 23 Strophen analysiert Göhler ausführlich und zeigt, dass die kurz vor dem endgültigen Burgundenuntergang spielende Szene z.T. bereits Gesagtes variiert, neue Akzente setzt, aber auch ganz neue erzählerische Ele mente bringt, also eine eigenständige Erzählsequenz darstellt. Um die andere Erweite rung ist es vergleichsweise in letzter Zeit ziemlich still geblieben; sie betrifft Kriemhilds Ende.3 Zunächst sei diese ,Nibelungenlied'-Interpolation besprochen, danach soll sie neben weitere vergleichbare Episoden gestellt werden; abschließend will ich eine These über die Herkunft des Zusatzes aufstellen und aus ihr einige allgemeine Bemerkungen ablei ten. 1 S. Bibliographie zum Nibelungenlied und zur Klage v. Willy Krogmann/Ulrich Pretzel, 4. stark erweiterte Aufl. unter redaktioneller Mitarbeit v. Herta Haas/Wolfgang Bachofer (Bibliographien z. dt. Lit. d. Mittelalters 1), Berlin 1966, S. 18f. Zur Problematik der Datierung s. Theodor Abeling, Das Nibelungenlied und seine Literatur. Eine Bibliographie und vier Abhandlungen (Teutonia 7), Leipzig 1907, S. 182. 2 S. Eine spätmittelalterliche Fassung des Nibelungenliedes. Die Handschrift 4257 der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt, hrsg. und eingeleitet von Peter Göhler (Philologica Germanica 21), Wien 1999, bes. S. 18Ff., 160-163; Das Nibelungenlied nach der Handschrift n. Hs. 4257 der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek, hrsg. -

Rev. of Agneta Ney. Bland Ormar Och Drakar: Hjältemyt Och Manligt Ideal I Berättartraditioner Om Sigurd FafnesBane
SCRIPTA ISLANDICA ISLÄNDSKA SÄLLSKAPETS ÅRSBOK 68/2017 REDIGERAD AV LASSE MÅRTENSSON OCH VETURLIÐI ÓSKARSSON under medverkan av Pernille Hermann (Århus) Else Mundal (Bergen) Guðrún Nordal (Reykjavík) Heimir Pálsson (Uppsala) Henrik Williams (Uppsala) UPPSALA, SWEDEN Publicerad med stöd från Vetenskapsrådet. © 2017 respektive författare (CC BY) ISSN 0582-3234 EISSN 2001-9416 Sättning: Ord och sats Marco Bianchi urn:nbn:se:uu:diva-336099 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-336099 Innehåll LARS-ERIK EDLUND, Ingegerd Fries (1921–2016). Minnesord ...... 5 AÐALHEIÐUR GUÐMUNDSDÓTTIR, Some Heroic Motifs in Icelandic Art 11 DANIEL SÄVBORG, Blot-Sven: En källundersökning .............. 51 DECLAN TAGGART, All the Mountains Shake: Seismic and Volcanic Imagery in the Old Norse Literature of Þórr ................. 99 ELÍN BÁRA MAGNÚSDÓTTIR, Forfatterintrusjon i Grettis saga og paralleller i Sturlas verker ............................... 123 HAUKUR ÞORGEIRSSON & TERESA DRÖFN NJARÐVÍK, The Last Eddas on Vellum .............................................. 153 HEIMIR PÁLSSON, Reflections on the Creation of Snorri Sturluson’s Prose Edda ........................................... 189 MAGNUS KÄLLSTRÖM, Monumenta lapidum aliquot runicorum: Om runstensbilagan i Verelius’ Gothrici & Rolfi Westrogothiae Regum Historia (1664) ................................. 233 MATTEO TARSI, Creating a Norm for the Vernacular: Some Critical Notes on Icelandic and Italian in the Middle Ages ............ 253 OLOF SUNDQVIST, Blod och blót: Blodets betydelse och funktion -

Vidga –Vidigoia –Wudga–Witege -Wittich Verlandson (Latein Vidricus)
Vidrich – Vidrik –Vidga –Vidigoia –Wudga–Witege -Wittich Verlandson (latein Vidricus) Vidrich, Vidrik, Wittich, in der Thidrekssaga Widga, sonst auch Witege, Wittig, ist eine Gestalt der germanischen Heldensagen. Aufgrund der Ausrüstung, die er von seinem Vater Wieland bekam, war er nach der Sage der am besten ausgerüstete Ritter seiner Zeit. Er hatte mit Mimung das beste Schwert, seine Rüstung und sein Helm waren ebenfalls von Wieland geschmiedet worden und damit vom Feinsten und sein Reittier war der Hengst Schimming, eines der besten Pferde der damaligen Zeit. Mimung spielt in der Wielandsage eine wichtige Rolle, aber auch in der Sage von Dietrich von Bern – Teodorico da Verona - denn mit Mimungs Hilfe kann Wittich Dietrich besiegen. Später leiht sich Dietrich, als er in einem Wettkampf gegen Odoaker zu verlieren droht, von Wittich dessen Schwert und tötet damit Odoaker. In den Sagen um Dietrich von Bern spielt er insofern eine den Haupthelden sehr verdunkelnde Rolle. Doch wird er an anderer Stelle auch seinerseits recht negativ dargestellt, insofern er am Schluss seines Lebens, als er zum Gegner Dietrichs geworden ist, in der Rabenschlacht eine äußerst unrühmliche Rolle spielt.[1] In dieser Schlacht, die in der Nähe von Dietrichs Stadt Raben (Bezug auf das historische Ravenna) stattfand, in der Dietrichs Heer gegen das von Kaiser Ermenrich kämpfte, um Dietrichs Reich von diesem zurückzugewinnen, waren Wittich und Ritter Heime, die zu Ermanrichs Heer gehörten, auf einem Erkundungsritt, und sie stießen auf einen gegnerischen Ritter, der dort auf der Wacht stand. Sie kämpften mit ihm, und zwar zunächst, wie es unter Rittern üblich war, Mann gegen Mann, und er besiegte sie alle beide. -

321827631001.Pdf
Revista de Filología Alemana ISSN: 1133-0406 [email protected] Universidad Complutense de Madrid España KOPLOWITZ-BREIER, Anat Politics and the Representation of Women in the Nibelungenlied Revista de Filología Alemana, vol. 15, 2007, pp. 9-25 Universidad Complutense de Madrid Madrid, España Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=321827631001 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto Politics and the Representation of Women in the Nibelungenlied Anat KOPLOWITZ-BREIER Bar-Ilan University [email protected] Recibido: enero de 2007 Aceptado: febrero de 2007 ABSTRACT The article examines the manner in which the female characters are represented in the Nibelungenlied by dividing them into two groups: the traditional women, who keep their socially accepted positions and are supportive of the men, and the women rebelling against tradition, who try to be part of the male world, thereby exceeding the limits of tradition and rebelling against it. The article suggests that in the Nibelungenlied the two groups of women represent the Church and the men the Empire. The group of traditional women represents the Church before the breakout of the historical conflict with the Empire while the group of rebellious women represents the Church in the period of advanced conflict. Keywords: Das Nibelungenlied, Women, Politics, Representation, Church, Empire. ZUSAMMENFASSUNG Dieser Artikel überprüft die Art und Weise, wie die weiblichen Figuren im Nibelungenlied dargestellt sind. -

Nibelungenlied
Politics and the Representation of Women in the Nibelungenlied Anat KOPLOWITZ-BREIER Bar-Ilan University [email protected] Recibido: enero de 2007 Aceptado: febrero de 2007 ABSTRACT The article examines the manner in which the female characters are represented in the Nibelungenlied by dividing them into two groups: the traditional women, who keep their socially accepted positions and are supportive of the men, and the women rebelling against tradition, who try to be part of the male world, thereby exceeding the limits of tradition and rebelling against it. The article suggests that in the Nibelungenlied the two groups of women represent the Church and the men the Empire. The group of traditional women represents the Church before the breakout of the historical conflict with the Empire while the group of rebellious women represents the Church in the period of advanced conflict. Keywords: Das Nibelungenlied, Women, Politics, Representation, Church, Empire. ZUSAMMENFASSUNG Dieser Artikel überprüft die Art und Weise, wie die weiblichen Figuren im Nibelungenlied dargestellt sind. Sie sind in zwei Gruppen unterteilt: die traditionellen Frauen, welche ihre sozial festgelegte Stellung akzeptieren und die Manner unterstützen; und die Frauen, welche gegen diese Tradition rebellieren und versuchen, ein Teil der Männerwelt zu werden, und die damit die Grenzen der Tradition überschreiten. Dieser Artikel legt nahe, dass die beiden Frauengruppen im Nibelungenlied die Kirche und die Männer des Kaiserreichs repräsentieren. Die Gruppe der traditionellen Frauen repräsentiert die Kirche vor dem Ausbruch des historischen Konflikts mit dem Reich; die Gruppe der rebellierenden Frauen symbolisiert die Kirche in der Periode des fortgeschrittenen Konflikts. Schlüsselwörter: Das Nibelungenlied, Frauen, Politik, Darstellung, Kirche, Kaiserreich. -

Dietrich Von Bern and “Historical” Narrative in the German Middle Ages
1 Dietrich von Bern and “Historical” Narrative in the German Middle Ages: An Investigation of Strategies for Establishing Credibility in Four Poems of the Middle High German Dietrichepik by Jonathan Martin Senior Honors Thesis Submitted for German and MEMS, March 26th, 2010 Advised by Professor Helmut Puff © Jonathan Seelye Martin 2010 2 Acknowledgements My special thanks are owed to Dr. Helmut Puff, who has made his advice, time, and considerable knowledge available to me throughout the process of writing this thesis. He has steered me away from many misconceptions and improved my writing for clarity and style. It is very much thanks to him that this thesis appears in the form that it currently does. I also must thank him for repeatedly reminding me that one is never fully satisfied with an end product: there is always something left to improve or expand upon, and this is especially true of an overly ambitious project like mine. In a large part due to his wonderful help, I hope to continue working on and improving my knowledge of this topic, which at first I despised but have come to love, in the future. My thanks also go out to Drs. Peggy McCracken, Kerstin Barndt, George Hoffmann, and Patricia Simons, who have at various times read and commented on drafts of my work and helped guide me through the process of writing and researching this thesis. My other professors and instructors, both here and at Freiburg, have also been inspirations for me, and I must especially thank Maria “Frau” Caswell for teaching me German, Dr. -

Download PDF Van Tekst
Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 41 bron Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 41. E.J. Brill, Leiden 1922 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_tij003192201_01/colofon.htm © 2009 dbnl 1 Johannes Ruusbroec en de Duitsche mystiek. I. Hetgeen in het volgende opstel wordt medegedeeld is de vrucht van een onderzoek, waarbij het doel was meer klaarheid te verkrijgen omtrent de ware beteekenis van de terminologie der middeleeuwsche Nederlandsche mystici, met name van Ruusbroec, en meer in het bizonder de invloed, door de Duitsche op de Nederlandsche mystiek in de Middeleeuwen uitgeoefend, na te gaan. Het nasporen van de denkbeelden, die zijn overgebracht, moet natuurlijk gepaard gaan met het vaststellen van de ontleende termen, omdat deze de dragers zijn van de ideeën. De beteekenis, die de middeleeuwsche, in Germaansche taal geschreven mystiek voor de geestes-ontwikkeling dier Germaansche volken heeft gehad, kan dan ook eenigermate nauwkeurig gemeten worden naar de schat van woorden, welke, door de mystieke schrijvers naar het latijn nieuw gevormd, of van een nieuwe inhoud voorzien, tot op heden toe in de algemeen gangbare taal voortleven. Wanneer men bedenkt dat woorden als afkeer, binnenste, eenheid, gelijkheid, hebbelijk en onhebbelijk, indruk, inval, invloed, minzaam, neiging, ongedurig, zinnelijk, toeval, vernuft - om er maar eenige te kiezen - eerst in de dertiende en veertiende eeuwen zijn gemaakt, dan krijgt men reeds eenige voorstelling, hoe de gedachtenrijkdom, ook van het niet-geleerde volk, werd vergroot. Deze woorden zijn veelal van kleur veranderd en verbleekt. Bij hun vorming werden ze gevuld met speculatieve, ethische, theologische inhoud, en zij waren inder- Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. -

Some Heroic Motifs in Icelandic Art. Scripta Islandica 68/2017
SCRIPTA ISLANDICA ISLÄNDSKA SÄLLSKAPETS ÅRSBOK 68/2017 REDIGERAD AV LASSE MÅRTENSSON OCH VETURLIÐI ÓSKARSSON under medverkan av Pernille Hermann (Århus) Else Mundal (Bergen) Guðrún Nordal (Reykjavík) Heimir Pálsson (Uppsala) Henrik Williams (Uppsala) UPPSALA, SWEDEN Publicerad med stöd från Vetenskapsrådet. © 2017 respektive författare (CC BY) ISSN 0582-3234 EISSN 2001-9416 Sättning: Ord och sats Marco Bianchi urn:nbn:se:uu:diva-336099 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-336099 Innehåll LARS-ERIK EDLUND, Ingegerd Fries (1921–2016). Minnesord ...... 5 AÐALHEIÐUR GUÐMUNDSDÓTTIR, Some Heroic Motifs in Icelandic Art 11 DANIEL SÄVBORG, Blot-Sven: En källundersökning .............. 51 DECLAN TAGGART, All the Mountains Shake: Seismic and Volcanic Imagery in the Old Norse Literature of Þórr ................. 99 ELÍN BÁRA MAGNÚSDÓTTIR, Forfatterintrusjon i Grettis saga og paralleller i Sturlas verker ............................... 123 HAUKUR ÞORGEIRSSON & TERESA DRÖFN NJARÐVÍK, The Last Eddas on Vellum .............................................. 153 HEIMIR PÁLSSON, Reflections on the Creation of Snorri Sturluson’s Prose Edda ........................................... 189 MAGNUS KÄLLSTRÖM, Monumenta lapidum aliquot runicorum: Om runstensbilagan i Verelius’ Gothrici & Rolfi Westrogothiae Regum Historia (1664) ................................. 233 MATTEO TARSI, Creating a Norm for the Vernacular: Some Critical Notes on Icelandic and Italian in the Middle Ages ............ 253 OLOF SUNDQVIST, Blod och blót: Blodets betydelse och funktion