Dr. Klaus Werner Zum 75. Geburtstag 3
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Professor Dr. Franz Fukarek Zum Ehrenmitglied Ernannt
Tuexenia 13: 3-10. Göttingen 1993. Professor Dr. Franz Fukarek zum Ehrenmitglied ernannt — H. Krisch, Greifswald — Anläßlich der Jahresversammlung am 4. Juni 1993 während der Tagung in Regensburg hat die Floristisch-soziologische Arbeitsgemeinschaft Herrn Professor Dr. Franz FUKAREK zu ihrem Ehrenmitglied ernannt. Damit wurden nicht nur seine Verdienste um die floristische und vegetationskundliche Erforschung des nordostdeutschen Flachlandes gewürdigt, sondern es wurde ihm auch gedankt für seine langjährigen Bemühungen, den Kontakt zwischen West und Ost nicht abreißen zu lassen. Franz FUKAREK wurde am 21. Januar 1926 in Rumburg (Sudetenland) geboren, wo er auch aufwuchs und die Schule besuchte, bis man ihn nach dem elften Schuljahr im Mai 1944 zur Wehrmacht einzog. Bereits im Januar 1945 wurde er verwundet, was schließlich im April 1945 zur Entlassung aus der Wehrmacht führte. Dann folgte die Ausweisung der Deutschen aus dem 3 Sudetenland, und Franz FUKAREK gelangte im Juni 1945 ins benachbarte Zittau, wo sein Vater verhaftet wurde und wenige Wochen später im Konzentrationslager Hirschfelde umkam. Alle diese Ereignisse prägen einen jungen Menschen sicherlich nachhaltig. Auf der Suche nach einer Bleibe und einer sicheren Ernährungsgrundlage begibt Franz FUKAREK sich schließlich über Gera und Hildburghausen in den kleinen Ort Arensdorf nördlich von Halle (Saale), wohin er seine Mutter nachkommen läßt. Von dort aus bot sich ihm zunächst die Gelegenheit, in den altehrwürdigen Franckeschen Stiftungen in Halle das Abitur nachzuholen, so daß er mit dem Herbstsemester 1946/47 das Studium der Biologie, Geographie und Geologie — alle Fächer wurden zunächst gleichwertig belegt — an der Martin-Luther-Uni- versität Halle-Wittenberg aufnehmen konnte. Schon im 4. Semester beschäftigte Prof. -

Pharmaziehistorische Bibliographie 12. Jahrgang 2004
Pharmaziehistorische Bibliographie 12. Jahrgang gegründet 1952 als Pharmaziegeschichtliche Rundschau Redaktion: Lektorat Phannaziegeschichte - Govi-Verlag Phannazeutischer Verlag GmbH Carl-Mannich-Straße 26 - 65760 Eschborn ISSN 0945-7704 Inhalt 1. Aufsätze aus Zeitschriften und Sammelwerken ....................................................................................... Seiten 1-18 2. Rezensionen aus Zeitschriften ................................................................................................................. Seiten 19-27 3. Monografien/Bücher ................................................................................................................................ Seiten 28-31 4. Originalrezensionen ................................................................................................................................. Seiten 32-45 5. Verzeichnis der regelmäßig ausgewerteten Zeitschriften ........................................................................ Seite 46 6. Register .......................................................................................... , ..........................•.............................. Seiten 47-55 Aufsätze aus Zeitschriften Müller-Jahncke, Wolf-Dieter: Apotheke und Publikum. Die und Sammelwerken Vorträge der Pharmaziehistorischen Biennale in Karlsruhe 1 vom 26. bis 28. April 2002. Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 2003. 221 S. ISBN: 3-8047-2052-8 (Veröffentlichungen zur Abel-Wanek, Ulrike: Der Weg war das Ziel. Carl Pharmaziegeschichte; Bd. 3), S. 53-70. 9 -

Annals of the History and Philosophy of Biology
he name DGGTB (Deutsche Gesellschaft für Geschichte und Deutsche Gesellschaft für Theorie der Biologie; German Society for the History and Philosophy of BioT logy) refl ects recent history as well as German tradition. Geschichte und Theorie der Biologie The Society is a relatively late addition to a series of German societies of science and medicine that began with the “Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften”, Annals of the History founded in 1910 by Leipzig University‘s Karl Sudhoff (1853-1938), who wrote: “We want to establish a ‘German’ society in order to gather Ger- and Philosophy of Biology man-speaking historians together in our special disciplines so that they form the core of an international society…”. Yet Sudhoff, at this Volume 17 (2012) time of burgeoning academic internationalism, was “quite willing” to accommodate the wishes of a number of founding members and formerly Jahrbuch für “drop the word German in the title of the Society and have it merge Geschichte und Theorie der Biologie with an international society”. The founding and naming of the Society at that time derived from a specifi c set of histori- cal circumstances, and the same was true some 80 years lat- er when in 1991, in the wake of German reunifi cation, the “Deutsche Gesellschaft für Geschichte und Theorie der Biologie” was founded. From the start, the Society has been committed to bringing stud- ies in the history and philosophy of biology to a wide audience, us- ing for this purpose its Jahrbuch für Geschichte und Theorie der Biologie. Parallel to the Jahrbuch, the Verhandlungen zur Geschichte und Theorie der Biologie has become the by now traditional medi- Annals of the History and Philosophy Biology, Vol. -

How Did East German Genetics Avoid Lysenkoism? Rudolf Hagemann
320 Forum TRENDS in Genetics Vol.18 No.6 June 2002 Science Chronicle How did East German genetics avoid Lysenkoism? Rudolf Hagemann Lysenkoism gained favour in the Soviet in agreement with the communist ideology. Lysenko presented his ‘theory’ of the Union during the 1930s and 1940s, replacing This theory received official support from regular sudden transformation of species mendelian genetics. Opponents of Lysenko Stalin in 1936. Many distinguished in 1949–1951 (Box 1). were dismissed from their jobs, imprisoned geneticists who did not follow the political and, not infrequently, died. After World War II theories of stalinism and did not support The penetration of Lysenkoism into the in some of the East European Soviet satellite Lysenkoism (e.g. Vavilov, Karpechenko, GDR (East Germany) states, Lysenkoism became the official Levitsky, Agol, Levit, Nadson and Meiser) It has to be remembered that during the genetics supported by the communist were caught by waves of arrests, often Stalin era, the policies in the Eastern Bloc authorities, and thus, genetics and biology ending in their death [3,4]. were dictated from Moscow, and so the were set back many years. Yet the uptake of After the war, Lysenko gave a notorious 1948 Moscow conference and Lysenko’s Lysenkoism was not uniform in the Eastern lecture on ‘The Situation in the Biological approval by Stalin signalled the transfer Bloc. The former East Germany (GDR) Science’ [5] during a conference of the of these concepts into all other communist mostly escaped its influence, owing to the Lenin Academy of Agricultural Sciences countries. The influence of Lysenko’s contribution of a few brave individuals and of the USSR (31 July to 7 August 1948, ‘Michurinist Biology’ was strong in the fact that the country had an open border Moscow). -

O7% Bornmuller-Festschrift 0^ @
Dtcpretońum spmctum nobatum n p bcjictabUis. Herausgegeben von Professor Dr. phil. F ried rich Fedde. tsa m i Beihefte. Band C. Ml Ml o7% Bornmuller-Festschrift Herausgegeben von 0^ 0. Schwarz. @ Ausgegeben am 1. Marz 1938. Dahlem bei Berlin FabeckstraGe 49. Im Selbstverlage. 1938. Fedde, Rep. Beih. C. - Titelbild. „Befr.“ 23978 (1238) 144/6$ f <^L 1 0 ) I n h a 11. Zu Joseph Bornmiillers funfundsiebzigstem Geburtstage. Von O. Schwaiz.............................................. p. 1 Verzeichnis der von J. Bornmuller verfaBten Arbeiten. Zusammengestellt von Tad. Wiśniewski........................... p. 11 C. Regel. Ober die Depression der Waldgrenze in Griechen- land. • p. 28 Gunnar Satnuelsson. Cives Novae Florae Syriacae. p. 38 Vivi Laurent-Tackholm. A revision of the Milne Redhead Sinai herbarium . ......................................... p. 50 Heinrich Handel-Mazzetti. Eine neue Onobrychis-Rasse in den Holien Tauern.............................. p. 53 Werner Rothmaler. Systematik und Geographie der Sub- sektion Calycanthum der Gattung Alchemilla L. p. 59 O. Renner. Alte und neue Oenotheren in Norddeutschland. p. 94 A. Ade und K. H. Rechinger. Samothrake. p. 106 Joh. Mattfeld. Ober eine angebliche Drymaria Australiens, nebst Bemerkungen iiber die Staminaldrusen und die Petaien der Caryophyllaceen.......................... p. 147 Georg Kiikenthal. Botanische Streifziige durch Unteritalien. p. 165 K. Ronniger. Eine neue Thymus-hrt aus Mazedonien. p. 171 H. Melchior. Das Vorkommen von Crepis pygmaea L. und Yaleriana saliunca Ali. in den Brenta-Alpen. p. 173 O. Schwarz. Phytochorologie ais Wissenschaft, am Beispiele der vorderasiatischen Flora....................................................p. 178 Hu losepf) BommCiUcrs funfundsiebzigstcm 0ebut?tstage 75 Jahre eines Menschenlebens, von denen gut zwei Drittel der floristischen Erforschung des Orientes gewidmet waren, gaben wahrlićh ein Recht, Riickschau zu halten und mit Genugtuung eine Leistung zu iiberblicken, die auch in der heutigen Zeit immerhin un- gewohnlich ist. -
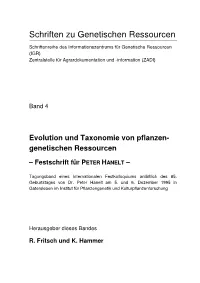
Festschrift Für PETER HANELT –
Schriften zu Genetischen Ressourcen Schriftenreihe des Informationszentrums für Genetische Ressourcen (IGR) Zentralstelle für Agrardokumentation und -information (ZADI) Band 4 Evolution und Taxonomie von pflanzen- genetischen Ressourcen – Festschrift für PETER HANELT – Tagungsband eines Internationalen Festkolloquiums anläßlich des 65. Geburtstages von Dr. Peter Hanelt am 5. und 6. Dezember 1995 in Gatersleben im Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung Herausgeber dieses Bandes R. Fritsch und K. Hammer Herausgeber: Informationszentrum für Genetische Ressourcen (IGR) Zentralstelle für Agrardokumentation und -information (ZADI) Villichgasse 17, D – 53177 Bonn Postfach 20 14 15, D – 53144 Bonn Tel.: (0228) 95 48 - 210 Fax: (0228) 95 48 - 149 Email: [email protected] Schriftleitung: Dr. Frank Begemann Layout: Gabriele Blümlein Birgit Knobloch Druck: Druckerei Schwarzbold Inh. Martin Roesberg Geltorfstr. 52 53347 Alfter-Witterschlick Schutzgebühr 15,- DM ISSN 0948-8332 © ZADI Bonn, 1996 Inhalts- und Vortragsverzeichnis 1 Inhaltsverzeichnis .........................................................................................................i Abkürzungsverzeichnis............................................................................................... iii Eröffnung des Kolloquiums und Würdigung von Dr. habil. PETER HANELT zu seinem 65. Geburtstag ..........................................................................................1 Opening of the Colloquium and laudation to Dr. habil. PETER HANELT on the occasion of -

Plantas, Espacios Y Públicos. El Desarrollo De La Botánica En La España Peninsular Entre 1833 Y 1936
INSTITUTO DE ESPAÑA REAL ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA PLANTAS, ESPACIOS Y PÚBLICOS. EL DESARROLLO DE LA BOTÁNICA EN LA ESPAÑA PENINSULAR ENTRE 1833 Y 1936 DISCURSO DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GONZÁLEZ BUENO LEÍDO EL 8 DE OCTUBRE DE 2020 EN EL ACTO DE SU TOMA DE POSESIÓN COMO ACADÉMICO DE NÚMERO Y CONTESTACIÓN DEL EXCMO. SR. DON FRANCISCO JAVIER PUERTO SARMIENTO MADRID MMXX REAL ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA PLANTAS, ESPACIOS Y PÚBLICOS. EL DESARROLLO DE LA BOTÁNICA EN LA ESPAÑA PENINSULAR ENTRE 1833 Y 1936 INSTITUTO DE ESPAÑA REAL ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA PLANTAS, ESPACIOS Y PÚBLICOS. EL DESARROLLO DE LA BOTÁNICA EN LA ESPAÑA PENINSULAR ENTRE 1833 Y 1936 DISCURSO DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GONZÁLEZ BUENO LEÍDO EL 8 DE OCTUBRE DE 2020 EN EL ACTO DE SU TOMA DE POSESIÓN COMO ACADÉMICO DE NÚMERO Y CONTESTACIÓN DEL EXCMO. SR. DON FRANCISCO JAVIER PUERTO SARMIENTO MADRID MMXX Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los derechos del copyright, bajo las sanciones establecidas en la ley, la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y tratamiento informático y la distribución de ella mediante alquiler o préstamo. © 2020 de los textos, sus autores Edita: Real Academia Nacional de Farmacia ISBN: 978-84-949499-9-9 Depósito legal: M-25069-2020 Maquetación: La Botella de Leyden Impresión: Booksfactory, Madrid. DISCURSO DE INGRESO EN LA REAL ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GONZÁLEZ BUENO Agradecimientos 7 PLANTAS, ESPACIOS Y PÚBLICOS. EL -

Biotic Interactions Overrule Plant Responses to Climate, Depending on the Species' Biogeography
Biotic Interactions Overrule Plant Responses to Climate, Depending on the Species’ Biogeography Astrid Welk1*, Erik Welk1,2, Helge Bruelheide1,2 1 Institute of Biology/Geobotany and Botanical Garden, Martin Luther University Halle-Wittenberg, Halle (Saale), Germany, 2 German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig, Leipzig, Germany Abstract This study presents an experimental approach to assess the relative importance of climatic and biotic factors as determinants of species’ geographical distributions. We asked to what extent responses of grassland plant species to biotic interactions vary with climate, and to what degree this variation depends on the species’ biogeography. Using a gradient from oceanic to continental climate represented by nine common garden transplant sites in Germany, we experimentally tested whether congeneric grassland species of different geographic distribution (oceanic vs. continental plant range type) responded differently to combinations of climate, competition and mollusc herbivory. We found the relative importance of biotic interactions and climate to vary between the different components of plant performance. While survival and plant height increased with precipitation, temperature had no effect on plant performance. Additionally, species with continental plant range type increased their growth in more benign climatic conditions, while those with oceanic range type were largely unable to take a similar advantage of better climatic conditions. Competition generally caused strong reductions of aboveground biomass and growth. In contrast, herbivory had minor effects on survival and growth. Against expectation, these negative effects of competition and herbivory were not mitigated under more stressful continental climate conditions. In conclusion we suggest variation in relative importance of climate and biotic interactions on broader scales, mediated via species-specific sensitivities and factor-specific response patterns. -

Harvard Papers in Botany Volume 21, Number 2 December 2016
Harvard Papers in Botany Volume 21, Number 2 December 2016 A Publication of the Harvard University Herbaria Including The Journal of the Arnold Arboretum Arnold Arboretum Botanical Museum Farlow Herbarium Gray Herbarium Oakes Ames Orchid Herbarium ISSN: 1938-2944 Harvard Papers in Botany Initiated in 1989 Harvard Papers in Botany is a refereed journal that welcomes longer monographic and floristic accounts of plants and fungi, as well as papers concerning economic botany, systematic botany, molecular phylogenetics, the history of botany, and relevant and significant bibliographies, as well as book reviews. Harvard Papers in Botany is open to all who wish to contribute. Instructions for Authors http://huh.harvard.edu/pages/manuscript-preparation Manuscript Submission Manuscripts, including tables and figures, should be submitted via email to [email protected]. The text should be in a major word-processing program in either Microsoft Windows, Apple Macintosh, or a compatible format. Authors should include a submission checklist available at http://huh.harvard.edu/files/herbaria/files/submission-checklist.pdf Availability of Current and Back Issues Harvard Papers in Botany publishes two numbers per year, in June and December. The two numbers of volume 18, 2013 comprised the last issue distributed in printed form. Starting with volume 19, 2014, Harvard Papers in Botany became an electronic serial. It is available by subscription from volume 10, 2005 to the present via BioOne (http://www.bioone. org/). The content of the current issue is freely available at the Harvard University Herbaria & Libraries website (http://huh. harvard.edu/pdf-downloads). The content of back issues is also available from JSTOR (http://www.jstor.org/) volume 1, 1989 through volume 12, 2007 with a five-year moving wall. -

Rudolf Mansfeld and Plant Genetic Resources
Schriften zu Genetischen Ressourcen Schriftenreihe der Zentralstelle für Agrardokumentation und -information Informationszentrum Biologische Vielfalt (IBV) BAND 22 Rudolf Mansfeld and Plant Genetic Resources Proceedings of a symposium dedicated to the 100th birthday of Rudolf Mansfeld, Gatersleben, Germany, 8-9 October 2001 Editors H. Knüpffer J. Ochsmann Herausgeber: Zentralstelle für Agrardokumentation und -information (ZADI) Informationszentrum Biologische Vielfalt (IBV) Villichgasse 17, D – 53177 Bonn Postfach 20 14 15, D – 53144 Bonn Tel.: (0228) 95 48 - 202 Fax: (0228) 95 48 - 220 Email: [email protected] Layout: Gabriele Blümlein Anette Scheibe Jörg Ochsmann Helmut Knüpffer Gudrun Schütze Druck: Druckerei Martin Roesberg Geltorfstr. 52 53347 Alfter-Witterschlick Schutzgebühr 12,- € ISSN 0948-8332 © ZADI Bonn, 2003 Diese Publikation ist im Internet verfügbar unter: http://www.genres.de/infos/igrreihe.htm Preface Preface In October 2001, the Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK) in Gatersleben, Germany, organised an international scientific symposium commemo- rating the centenary of RUDOLF MANSFELD, who was born on January 17, 1901. The symposium, entitled “Rudolf Mansfeld and Plant Genetic Resources”, and dedicated to his life’s work and scientific legacy was co-organised by the Genetic Resources Section of the Gesellschaft für Pflanzenzüchtung (GPZ, Society for Plant Breeding), and the Gemeinschaft zur Förderung der Kulturpflanzenforschung in Gatersleben e.V. (Society for the Advancement of Cultivated Plant Research). Professor RUDOLF MANSFELD worked in Gatersleben between 1946 and 1960, and was the former head of the Department of “Systematik und Sortiment” (Systematics and World Collection of Cultivated Plants) of the former Institute of Cultivated Plant Research. He was a plant taxonomist from the famous Berlin school of ADOLF ENGLER, and he developed principles for the classification of cultivated plants. -

Symposium 22
Monday August 12 species. Secondly, the trademark, which is a designation of the origin of goods Symposium 22 (S22): 4th International Symposium (and services) and enables a person who offers for sale or markets a certain on Taxonomy of Cultivated Plants product to distinguish this product from identical or similar products, offered for sale or marketed by someone else. The variety denomination is destined to Monday · August 12 identify a certain variety forever, i.e., not only during the (possible) period of protection, but also after the expiration of that protection. In the case of a pro- Location: Metro Toronto Convention Centre, Room 103A tected variety a trademark may be associated with the designated variety de- nomination, but the latter must always be easily recognizable as such. More- 1100–1140 over, the applicant for plant variety protection has to waive any possible rights to the denomination in one or more UPOV-Member States in connection with S22–O–1 identical or similar goods, e.g., when at the time of proposing the variety de- 50 YEARS OF THE INTERNATIONAL CODE OF NOMENCLATURE nomination he already used the same denomination as a trademark. Problems FOR CULTIVATED PLANTS: FUTURE PROSPECTS FOR may arise when a variety is only marketed under the trademark, or when two or CULTIVATED PLANT TAXONOMY more persons use different trademarks for the designation of one and the same Piers Trehane* variety and do not use the official variety denomination as well. Problems may 1 Haggates Cottages, Witchampton, Wimborne, Dorset BH21 5BS, England, also arise when the trademark is put within single quotation marks (in order to UK make it look like a variety denomination), or when someone sells plants be- The first edition of the International Code of Nomenclature for Cultivated longing to different varieties under one and the same trademark. -

Prof. Dr. Rer. Nat. Habil. Helmut Pankow (29.10.1929-19.12.1996)
Rostock. Meeresbiolog. Beitr. Heft 26 2-16 Rostock 2015 Lothar TÄUSCHER Institut für angewandte Gewässerökologie GmbH, Schlunkendorfer Straße 2e, D-14554 Seddiner See [email protected] Prof. Dr. rer. nat. habil. Helmut Pankow (29.10.1929-19.12.1996) Abstract Helmut Pankow was born in Grabow (Mecklenburg-Western Pomerania, North Germany) October 29th, 1929. Since 1949 he had been living and working in Rostock. Helmut Pankow studied biology in Rostock, made his diploma certificate (1953) and took doctor’s degrees (1955, 1961) at Rostock University. Among others Professor Dr. Dr. h. c. Hermann von Guttenberg (1881-1969) and Professor Dr. Franz Pohl (1896-1988) were two of his academic teachers, with whom he conducted studies concerning the anatomy of plants and who promoted Helmut Pankow in the investigation of algae. Professor Helmut Pankow holds a professorship for common and special botany and director of the Botanical Garden at Rostock University for more than 30 years. In addition to studies of plant anatomy, the floristics of bryophytes and spermatophytes in Mecklenburg-Western Pomerania, investigations of algal distribution in Mecklenburg-Western Pomerania and of the Baltic Sea, their sociology, their use for bioindication and their threat were of great importance in his scientific work. Professor Helmut Pankow also investigated the algal flora in the cause of frequent working stays in Iraq, in Sudan and in the Antarctic. The results of his investigations of systematic, aut- and synecology and sociology of micro and macro algae are the subject of many of Professor Pankow’s publications. Lots of new descriptions of taxa and syntaxa, new combinations and emendations were made by him.