O7% Bornmuller-Festschrift 0^ @
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Professor Dr. Franz Fukarek Zum Ehrenmitglied Ernannt
Tuexenia 13: 3-10. Göttingen 1993. Professor Dr. Franz Fukarek zum Ehrenmitglied ernannt — H. Krisch, Greifswald — Anläßlich der Jahresversammlung am 4. Juni 1993 während der Tagung in Regensburg hat die Floristisch-soziologische Arbeitsgemeinschaft Herrn Professor Dr. Franz FUKAREK zu ihrem Ehrenmitglied ernannt. Damit wurden nicht nur seine Verdienste um die floristische und vegetationskundliche Erforschung des nordostdeutschen Flachlandes gewürdigt, sondern es wurde ihm auch gedankt für seine langjährigen Bemühungen, den Kontakt zwischen West und Ost nicht abreißen zu lassen. Franz FUKAREK wurde am 21. Januar 1926 in Rumburg (Sudetenland) geboren, wo er auch aufwuchs und die Schule besuchte, bis man ihn nach dem elften Schuljahr im Mai 1944 zur Wehrmacht einzog. Bereits im Januar 1945 wurde er verwundet, was schließlich im April 1945 zur Entlassung aus der Wehrmacht führte. Dann folgte die Ausweisung der Deutschen aus dem 3 Sudetenland, und Franz FUKAREK gelangte im Juni 1945 ins benachbarte Zittau, wo sein Vater verhaftet wurde und wenige Wochen später im Konzentrationslager Hirschfelde umkam. Alle diese Ereignisse prägen einen jungen Menschen sicherlich nachhaltig. Auf der Suche nach einer Bleibe und einer sicheren Ernährungsgrundlage begibt Franz FUKAREK sich schließlich über Gera und Hildburghausen in den kleinen Ort Arensdorf nördlich von Halle (Saale), wohin er seine Mutter nachkommen läßt. Von dort aus bot sich ihm zunächst die Gelegenheit, in den altehrwürdigen Franckeschen Stiftungen in Halle das Abitur nachzuholen, so daß er mit dem Herbstsemester 1946/47 das Studium der Biologie, Geographie und Geologie — alle Fächer wurden zunächst gleichwertig belegt — an der Martin-Luther-Uni- versität Halle-Wittenberg aufnehmen konnte. Schon im 4. Semester beschäftigte Prof. -

Pharmaziehistorische Bibliographie 12. Jahrgang 2004
Pharmaziehistorische Bibliographie 12. Jahrgang gegründet 1952 als Pharmaziegeschichtliche Rundschau Redaktion: Lektorat Phannaziegeschichte - Govi-Verlag Phannazeutischer Verlag GmbH Carl-Mannich-Straße 26 - 65760 Eschborn ISSN 0945-7704 Inhalt 1. Aufsätze aus Zeitschriften und Sammelwerken ....................................................................................... Seiten 1-18 2. Rezensionen aus Zeitschriften ................................................................................................................. Seiten 19-27 3. Monografien/Bücher ................................................................................................................................ Seiten 28-31 4. Originalrezensionen ................................................................................................................................. Seiten 32-45 5. Verzeichnis der regelmäßig ausgewerteten Zeitschriften ........................................................................ Seite 46 6. Register .......................................................................................... , ..........................•.............................. Seiten 47-55 Aufsätze aus Zeitschriften Müller-Jahncke, Wolf-Dieter: Apotheke und Publikum. Die und Sammelwerken Vorträge der Pharmaziehistorischen Biennale in Karlsruhe 1 vom 26. bis 28. April 2002. Stuttgart: Wiss. Verl.-Ges., 2003. 221 S. ISBN: 3-8047-2052-8 (Veröffentlichungen zur Abel-Wanek, Ulrike: Der Weg war das Ziel. Carl Pharmaziegeschichte; Bd. 3), S. 53-70. 9 -

Annals of the History and Philosophy of Biology
he name DGGTB (Deutsche Gesellschaft für Geschichte und Deutsche Gesellschaft für Theorie der Biologie; German Society for the History and Philosophy of BioT logy) refl ects recent history as well as German tradition. Geschichte und Theorie der Biologie The Society is a relatively late addition to a series of German societies of science and medicine that began with the “Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften”, Annals of the History founded in 1910 by Leipzig University‘s Karl Sudhoff (1853-1938), who wrote: “We want to establish a ‘German’ society in order to gather Ger- and Philosophy of Biology man-speaking historians together in our special disciplines so that they form the core of an international society…”. Yet Sudhoff, at this Volume 17 (2012) time of burgeoning academic internationalism, was “quite willing” to accommodate the wishes of a number of founding members and formerly Jahrbuch für “drop the word German in the title of the Society and have it merge Geschichte und Theorie der Biologie with an international society”. The founding and naming of the Society at that time derived from a specifi c set of histori- cal circumstances, and the same was true some 80 years lat- er when in 1991, in the wake of German reunifi cation, the “Deutsche Gesellschaft für Geschichte und Theorie der Biologie” was founded. From the start, the Society has been committed to bringing stud- ies in the history and philosophy of biology to a wide audience, us- ing for this purpose its Jahrbuch für Geschichte und Theorie der Biologie. Parallel to the Jahrbuch, the Verhandlungen zur Geschichte und Theorie der Biologie has become the by now traditional medi- Annals of the History and Philosophy Biology, Vol. -

How Did East German Genetics Avoid Lysenkoism? Rudolf Hagemann
320 Forum TRENDS in Genetics Vol.18 No.6 June 2002 Science Chronicle How did East German genetics avoid Lysenkoism? Rudolf Hagemann Lysenkoism gained favour in the Soviet in agreement with the communist ideology. Lysenko presented his ‘theory’ of the Union during the 1930s and 1940s, replacing This theory received official support from regular sudden transformation of species mendelian genetics. Opponents of Lysenko Stalin in 1936. Many distinguished in 1949–1951 (Box 1). were dismissed from their jobs, imprisoned geneticists who did not follow the political and, not infrequently, died. After World War II theories of stalinism and did not support The penetration of Lysenkoism into the in some of the East European Soviet satellite Lysenkoism (e.g. Vavilov, Karpechenko, GDR (East Germany) states, Lysenkoism became the official Levitsky, Agol, Levit, Nadson and Meiser) It has to be remembered that during the genetics supported by the communist were caught by waves of arrests, often Stalin era, the policies in the Eastern Bloc authorities, and thus, genetics and biology ending in their death [3,4]. were dictated from Moscow, and so the were set back many years. Yet the uptake of After the war, Lysenko gave a notorious 1948 Moscow conference and Lysenko’s Lysenkoism was not uniform in the Eastern lecture on ‘The Situation in the Biological approval by Stalin signalled the transfer Bloc. The former East Germany (GDR) Science’ [5] during a conference of the of these concepts into all other communist mostly escaped its influence, owing to the Lenin Academy of Agricultural Sciences countries. The influence of Lysenko’s contribution of a few brave individuals and of the USSR (31 July to 7 August 1948, ‘Michurinist Biology’ was strong in the fact that the country had an open border Moscow). -

Syntaxonomy and Nomenclatural Adjustments of Steppe-Like Vegetation on Shallow Ultramafic Soils in the Balkans Included in the Order Halacsyetalia Sendtneri
Tuexenia 36: 293–320. Göttingen 2016. doi: 10.14471/2016.36.016, available online at www.tuexenia.de Syntaxonomy and nomenclatural adjustments of steppe-like vegetation on shallow ultramafic soils in the Balkans included in the order Halacsyetalia sendtneri Syntaxonomisch-nomenklatorische Änderungen bei den Steppenrasen der Ordnung Halacsyetalia sendtneri auf flachgründig-ultramafischen Böden des Balkans Nevena Kuzmanović1, *, Eva Kabaš1, Slobodan Jovanović1, Snežana Vukojičić1, Svetlana Aćić2, Boštjan Surina3, 4 & Dmitar Lakušić1, * 1University of Belgrade, Faculty of Biology, Institute of Botany and Botanical Garden “Jevremovac”, Takovska 43, 11000 Belgrade, Serbia, [email protected]; [email protected]; 2University of Belgrade, Faculty of Agriculture, Department of Botany, Nemanjina 6, Belgrade-Zemun, Serbia, [email protected]; 3University of Primorska, Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies, Glagoljaška 8, 6000 Koper, Slovenia; 4Natural History Museum Rijeka, Lorenzov prolaz 1, 51000 Rijeka, Croatia *Corresponding authors Abstract Dry open rocky grassland vegetation on shallow ultramafic soils in the Central Balkans represents typical secondary grasslands, which have developed mainly in the zone of thermophilous mixed decid- uous broadleaved and pine forests. Although all relevant national and regional syntaxonomic reviews classify these rocky grasslands within the distinct order Halacsyetalia sendtneri, the syntaxonomic position of the order in different systems of classification has varied in the past. Considering this as well as the fact that there have been no synoptic works on this specific vegetation type, we gathered all available data on the order Halacsyetalia sendtnerii from the serpentinites of the Western and Central Balkan Peninsula for its critical evaluation. The results obtained in our analyses allowed us to propose a new syntaxonomic concept, which is partly in accordance with previously published syntaxonomic schemes. -

Book of Abstracts
Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference - Book of Abstracts GREEN ROOM SESSIONS 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference 1-3 November 2018, Podgorica, Montenegro BOOK OF ABSTRACTS University of Montenegro, Faculty of Philosophy, Geography, Montenegro University of Montenegro, Faculty of Architecture, Montenegro University of Montenegro, Biotechnical Faculty, Montenegro University of Montenegro, Institute of Marin Biology, Montenegro Perm State Agro-Technological University, Russia Voronezh State Agricultural University, Russia Faculty of Agricultural Sciences and Food, Skopje, Macedonia University of Zagreb, Faculty of Agriculture Aleksandras Stulginskis University, Lithuania University of Sarajevo, Faculty of Agriculture and Food Science, B&H Tarbiat Modares University, Faculty of Natural Resources, Iran Watershed Management Society, Iran University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, RS, B&H University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, RS, B&H Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad, Serbia Balkan Scientific Association of Agricultural Economists University of Dzemal Bijedic, Mostar, Agromediterranean Faculty, B&H University of Kragujevac, Faculty of Hotel Management &Tourism Vrnjacka Banja Institute of Meteorology and Seismology of Montenegro National Parks of Montenegro Put Gross, Montenegro Eko ekvilibrijum, Montenegro National Association of Sommeliers of Montenegro Centar za samorazvoj i unapredjenje drustva Editor in Chief: Velibor Spalevic Publiher: Faculty of Philosophy, University of Montenegro Printing house: Grafo group doo Podgorica Circulation: 250 Website: www.greenrooms.me Photo front page: Aleksandar Jaredic / Ribo Raicevic CIP - Kaталогизација у публикацији Национална библиотека Црне Горе, Цетиње ISBN 978-86-7798-112-9 COBISS.CG-ID 36811792 2 Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference - Book of Abstracts Honorary Committee Prof. -
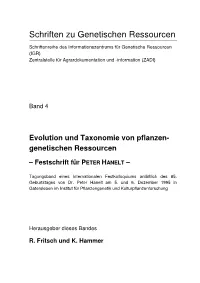
Festschrift Für PETER HANELT –
Schriften zu Genetischen Ressourcen Schriftenreihe des Informationszentrums für Genetische Ressourcen (IGR) Zentralstelle für Agrardokumentation und -information (ZADI) Band 4 Evolution und Taxonomie von pflanzen- genetischen Ressourcen – Festschrift für PETER HANELT – Tagungsband eines Internationalen Festkolloquiums anläßlich des 65. Geburtstages von Dr. Peter Hanelt am 5. und 6. Dezember 1995 in Gatersleben im Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung Herausgeber dieses Bandes R. Fritsch und K. Hammer Herausgeber: Informationszentrum für Genetische Ressourcen (IGR) Zentralstelle für Agrardokumentation und -information (ZADI) Villichgasse 17, D – 53177 Bonn Postfach 20 14 15, D – 53144 Bonn Tel.: (0228) 95 48 - 210 Fax: (0228) 95 48 - 149 Email: [email protected] Schriftleitung: Dr. Frank Begemann Layout: Gabriele Blümlein Birgit Knobloch Druck: Druckerei Schwarzbold Inh. Martin Roesberg Geltorfstr. 52 53347 Alfter-Witterschlick Schutzgebühr 15,- DM ISSN 0948-8332 © ZADI Bonn, 1996 Inhalts- und Vortragsverzeichnis 1 Inhaltsverzeichnis .........................................................................................................i Abkürzungsverzeichnis............................................................................................... iii Eröffnung des Kolloquiums und Würdigung von Dr. habil. PETER HANELT zu seinem 65. Geburtstag ..........................................................................................1 Opening of the Colloquium and laudation to Dr. habil. PETER HANELT on the occasion of -

Mining Institute Dd Tuzla Revised Environmental Impact Assessment Study for the Construction of the Regional Sanitary Landfill F
MINING INSTITUTE DD TUZLA Street Rudarska 72, 75000 Tuzla REVISED ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT STUDY FOR THE CONSTRUCTION OF THE REGIONAL SANITARY LANDFILL FOR TUZLA REGION AT THE LOCATION OF “SEPARACIJA 1”–MUNICIPALITY OF ŽIVINICE “Eko-Sep” d.o.o. ŽIVINICE Tuzla, July 2015 1 MINING INSTITUTE DD TUZLA Street Rudarska 72, 75000 Tuzla Indirect taxes no.263025390006 Protocol no. 30-03-04-805/14 Contract no. 137/2014 REVISED ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT STUDY FOR THE CONSTRUCTION OF THE REGIONAL SANITARY LANDFILL FOR TUZLA REGION AT THE LOCATION OF “SEPARACIJA 1” – MUNICIPALITY OF ŽIVINICE Executive Director of the Scientific Research Director of the Tuzla Institute Center Zlatko Džambid Eldar Pirid Tuzla, July 2015 2 List of contributors: Team leader: Jasmina Isabegovid Contributors: Senaid Bajrid Jasminka Spahid Eldin Halilčevid Ranko Karišik 3 TABLE OF CONTENTS 1. INTRODUCTION................................................................................................................................................... 7 1.1. ROLE AND IMPORTANCE OF THE RSL "SEPARACIJA 1" .......................................................................... 9 1.2. LEGAL FRAMEWORK FOR THE EIA ....................................................................................................... 12 1.3. SPATIAL PLANNING DOCUMENTS ....................................................................................................... 14 2. DESCRIPTION OF THE PROPOSED PROJECT ..................................................................................................... -

Plantas, Espacios Y Públicos. El Desarrollo De La Botánica En La España Peninsular Entre 1833 Y 1936
INSTITUTO DE ESPAÑA REAL ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA PLANTAS, ESPACIOS Y PÚBLICOS. EL DESARROLLO DE LA BOTÁNICA EN LA ESPAÑA PENINSULAR ENTRE 1833 Y 1936 DISCURSO DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GONZÁLEZ BUENO LEÍDO EL 8 DE OCTUBRE DE 2020 EN EL ACTO DE SU TOMA DE POSESIÓN COMO ACADÉMICO DE NÚMERO Y CONTESTACIÓN DEL EXCMO. SR. DON FRANCISCO JAVIER PUERTO SARMIENTO MADRID MMXX REAL ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA PLANTAS, ESPACIOS Y PÚBLICOS. EL DESARROLLO DE LA BOTÁNICA EN LA ESPAÑA PENINSULAR ENTRE 1833 Y 1936 INSTITUTO DE ESPAÑA REAL ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA PLANTAS, ESPACIOS Y PÚBLICOS. EL DESARROLLO DE LA BOTÁNICA EN LA ESPAÑA PENINSULAR ENTRE 1833 Y 1936 DISCURSO DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GONZÁLEZ BUENO LEÍDO EL 8 DE OCTUBRE DE 2020 EN EL ACTO DE SU TOMA DE POSESIÓN COMO ACADÉMICO DE NÚMERO Y CONTESTACIÓN DEL EXCMO. SR. DON FRANCISCO JAVIER PUERTO SARMIENTO MADRID MMXX Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los derechos del copyright, bajo las sanciones establecidas en la ley, la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y tratamiento informático y la distribución de ella mediante alquiler o préstamo. © 2020 de los textos, sus autores Edita: Real Academia Nacional de Farmacia ISBN: 978-84-949499-9-9 Depósito legal: M-25069-2020 Maquetación: La Botella de Leyden Impresión: Booksfactory, Madrid. DISCURSO DE INGRESO EN LA REAL ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GONZÁLEZ BUENO Agradecimientos 7 PLANTAS, ESPACIOS Y PÚBLICOS. EL -

Biotic Interactions Overrule Plant Responses to Climate, Depending on the Species' Biogeography
Biotic Interactions Overrule Plant Responses to Climate, Depending on the Species’ Biogeography Astrid Welk1*, Erik Welk1,2, Helge Bruelheide1,2 1 Institute of Biology/Geobotany and Botanical Garden, Martin Luther University Halle-Wittenberg, Halle (Saale), Germany, 2 German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig, Leipzig, Germany Abstract This study presents an experimental approach to assess the relative importance of climatic and biotic factors as determinants of species’ geographical distributions. We asked to what extent responses of grassland plant species to biotic interactions vary with climate, and to what degree this variation depends on the species’ biogeography. Using a gradient from oceanic to continental climate represented by nine common garden transplant sites in Germany, we experimentally tested whether congeneric grassland species of different geographic distribution (oceanic vs. continental plant range type) responded differently to combinations of climate, competition and mollusc herbivory. We found the relative importance of biotic interactions and climate to vary between the different components of plant performance. While survival and plant height increased with precipitation, temperature had no effect on plant performance. Additionally, species with continental plant range type increased their growth in more benign climatic conditions, while those with oceanic range type were largely unable to take a similar advantage of better climatic conditions. Competition generally caused strong reductions of aboveground biomass and growth. In contrast, herbivory had minor effects on survival and growth. Against expectation, these negative effects of competition and herbivory were not mitigated under more stressful continental climate conditions. In conclusion we suggest variation in relative importance of climate and biotic interactions on broader scales, mediated via species-specific sensitivities and factor-specific response patterns. -

Lot1 Environmental Impact Study and Non-Technical Resume
IPSA I N S T I T U T Ministry of Communication and Transport Of Bosnia and Herzegovina Project title: “Highway on Corridor Vc” Preparation of planning- study documentation Lot no: 1 Environmental Impact Study May 2006 IPSA I N S T I T U T Ministry of Communication and Transport Of Bosnia and Herzegovina General project reference Client: Bosnia and Herzegovina Ministry of Communication and Transport Contract no: BA-5C-ICB-01-S-04-BOS Title: “Highway on Corridor Vc“ Preparation of Planning-Study Documentation Authorized Representative Project director: M.Sc. Kupusovic Namik, of Consultants: grad.engineer Project director deputy: Bozo Blagojevic, grad.engineer Contact detailes of Client: Telephone (00387 33) 204 620 Fax (00387 33) 668 493 E-mail: [email protected] Leading Consultant: IPSA Institute j.s.c, Put života bb, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Authorized Representative Prof. Esref Gacanin Ph.D., General director of IPSA of Leading Consultant: Institute Contract Director and Bisera Karalić-Hromić, grad. engineer Resident Project Director- Ana Handžić, grad. engineer LOT1 Contact Details of Leading Telephone (00387 33) 276 320 Consultant: Fax (00387 33) 276 355 E-mail: [email protected] Consultants - Partners: Hydro-engineering Institute, Sarajevo Stjepana Tomića 1, 71000 Sarajevo, BiH Traser Maršala Tita 70, 71000 Sarajevo, BiH DIVEL Tešanjska 5a, 71000 Sarajevo, BIH Zavod za saobraćaj Stjepana Tomića 1, 71000 Sarajevo, BiH IGH d.d. Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, R. Hrvatska The Institute for Urbanism of RS j.s.c. Save Mrkalja -

A New Association from the Relict Mountain Steppe Vegetation in South- Western Bulgaria
HACQUETIA 9/2 • 2010, 185–206 DOI: 10.2478/v10028-010-0010-2 Bromo moesiacae-stipetum epilosae – A new AssociatIon from the relIct mountain steppe vegetAtIon In south- western BulgAria Salza Todorova1 & rossen TzoNEV2 Abstract A syntaxonomical analysis of the dry grasslands (Festuco-Brometea) in Bosnek karst region, Mt Vitosha (SW Bulgaria) has been carried out. These grasslands are part of the intrazonal vegetation distributed within the belts of xerophilous oak and mesophilous beech forest in the south-western foothills of the mountain. The bedrock is carbonate, the soils are dry and shallow, climate – moderate continental. This vegetation grows mostly on steep slopes, with southern and south-western exposition. Apart from the typical for Festuco-Brom- etea calcicoles, the studied vegetation is characterized by many endemic (regional and local) species and at the same time includes a lot of Mediterranean species. As a result of the analysis, a new association, Bromo moesiacae-Stipetum epilosae ass. nova, has been established that belongs to the alliance Saturejon montanae. A comparison with related syntaxa from other karst mountains from SW Bulgaria and E Serbia is made, and some conclusions about the origin of the steppe vegetation in that region are drawn. Keywords: calcareous grasslands, dry grasslands, phytosociology, syntaxonomy, Festuco-Brometea, Saturejon montanae. Izvleček Naredili smo sintaksonomsko analizo suhih travnikov (Festuco-Brometea) v kraškem območju Bosnek v gorovju Vitoša (jugozahodna Bolgarija). Ti travniki so del intraconalne vegetacije, razširjene v pasu kserofilnih hra- stovih in mezofilnih bukovih gozdov na jugozahodnih vznožjih hribovja. Matična podlaga je karbonatna, tla so suha in plitva, podnebje je zmerno celinsko.