Chronik Der Naturschutzarbeit Band II
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
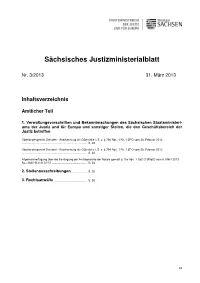
Sächsisches Justizministerialblatt
Sächsisches Justizministerialblatt Nr. 3/2013 31. März 2013 Inhaltsverzeichnis Amtlicher Teil 1. Verwaltungsvorschriften und Bekanntmachungen des Sächsischen Staatsminister i- ums der Justiz und für Europa und sonstiger Stellen, di e den Geschäftsbereich der Justiz betreffen Oberlandesgericht Dresden - Anerkennung als Gütestelle i. S. v. § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO vom 28. Februar 2013 .................................................................................. S. 24 Oberlandesgericht Dresden - Anerkennung als Gütestelle i. S. v. § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO vom 28. Februar 2013 .................................................................................. S. 24 Allgemeinverfügung über die Festlegung der Amtsbereiche der Notare gemäß § 10a Abs. 1 Satz 2 BNotO vom 8. März 2013 Az.: 3830-III.4-3133/12 ............................................ S. 24 2. Stellenausschreibungen ................... S. 25 3. Rechtsanwälte ......................................... S. 28 23 31. März 2013 Nr. 3 Sächsisches Justizministerialblatt 1. Verwaltungsvorschriften und Bekanntmachungen des Sächsischen Staatsministeri- ums der Justiz und für Europa und sonstiger Stellen, die den Geschäftsbereich der Justiz betreffen Anerkennung als Gütestelle i. S. v. § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO Vom 28. Februar 2013 Rechtsanwalt Christian Pille, Chemnitzer Straße 121 in 01187 Dresden ist mit Wirkung zum 1. März 2013 durch den Präsiden- ten des Oberlandesgerichts Dresden als Gütestelle i. S. v. § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO anerkannt worden. Anerkennung als Gütestelle i. S. v. § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO Vom 28. Februar 2013 Rechtsanwalt Jens-Uwe Zastrow, Chemnitzer Straße 121 in 01187 Dresden ist mit Wirkung zum 1. März 2013 durch den Präsidenten des Oberlandesgerichts Dresden als Gütestelle i. S. v. § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO anerkannt worden. Allgemeinverfügung über die Festlegung der Amtsbereiche der Notare gemäß § 10a Abs. 1 Satz 2 BNotO Vom 8. -

Kurzumtriebsplantagen Auf Ackerland – Ökonomische Bewertung Einer Anbauoption Mit Ökologischen Vorteilen Am Beispiel Des Freistaats Sachsen
Kurzumtriebsplantagen auf Ackerland – ökonomische Bewertung einer Anbauoption mit ökologischen Vorteilen am Beispiel des Freistaats Sachsen Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Agrarwissenschaften (Dr. agr.) der Naturwissenschaftlichen Fakultät III Agrar‐ und Ernährungswissenschaften, Geowissenschaften und Informatik der Martin‐Luther‐Universität Halle‐Wittenberg vorgelegt von Herrn Kröber, Mathias Geb. am 25.01.1982 in Eilenburg Gutachter: Prof. Dr. Peter Wagner Prof. Dr. Albrecht Bemmann Verteidigung am 03.12.2018 Vorwort Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen des vom BMBF geförderten Verbundforschungsprojekts AgroForNet (Nachhaltige Entwicklung ländlicher Regionen durch die Vernetzung von Produzenten und Verwertern von Dendromasse für die energetische Nutzung) an der Professur für Landwirtschaftliche Betriebslehre der Martin- Luther-Universität Halle-Wittenberg. Für die erhaltene Unterstützung, vor allem aber für den gewährten Freiraum während der Erstellung der Arbeit, bedanke ich mich recht herzlich bei Herrn Prof. Dr. Peter Wagner. Weiterhin danke ich besonders Herrn Dr. Jürgen Heinrich für seine unzähligen Hinweise, Verbesserungsvorschläge sowie die teilweise stundenlangen Diskussionen zur fachlichen Durchdringung spezieller Teilfragen. Zudem gilt Herrn Dr. Thomas Chudy ein spezieller Dank für die wunschgenaue Darstellung der zahlreichen Abbildungen im Text. Ebenfalls möchte ich mich bei allen Projektkollegen für die konstruktive Zusammenarbeit sowie den Erfahrungsaustausch bedanken. Besonders zu nennen ist hier Herr Hendrik Horn für die Bereitstellung der Daten zur Biomasseertragsschätzung, auf denen ein Großteil meiner in der Arbeit untersuchten Betrachtungen aufbaut. Insgesamt danke ich allen Mitarbeitern der Professur für Landwirtschaftliche Betriebslehre sowie der Professur für Unternehmensführung im Agribusiness für die häufig spontane und jederzeit unkomplizierte Hilfe bei der Bewältigung von kleineren und größeren Problemen. Nicht zuletzt gehört mein ausdrücklicher Dank meiner Familie und meinen Freunden. -

COMMISSION DECISION of 10 October 2008 Concerning Certain
L 272/16EN Official Journal of the European Union 14.10.2008 COMMISSION DECISION of 10 October 2008 concerning certain interim protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5N1 in poultry in Germany (notified under document number C(2008) 6026) (Text with EEA relevance) (2008/795/EC) THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, holdings and to wild birds. As a result it may spread from one Member State to another Member State and to third countries through trade in live birds or their Having regard to the Treaty establishing the European products and by migration of wild birds. Community, Having regard to Council Directive 89/662/EEC of (4) Council Directive 2005/94/EC of 20 December 2005 on 11 December 1989 concerning veterinary checks in intra- Community measures for the control of avian influenza Community trade with a view to the completion of the and repealing Directive 92/40/EEC (4) sets out measures internal market (1), and in particular Article 9(3) thereof, for the control of both the low pathogenic and highly pathogenic forms of avian influenza. Article 16 of that Directive provides for the establishment of protection, Having regard to Council Directive 90/425/EEC of 26 June surveillance and further restricted zones in the event of 1990 concerning veterinary and zootechnical checks applicable outbreaks of highly pathogenic avian influenza. in intra-Community trade in certain live animals and products with a view to the completion of the internal market (2), and in particular Article 10(3) thereof, -

District Heating in Lusatia
Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg District Heating in Lusatia Status Quo and Prospects for Climate Neutrality Fernwärme in der Lausitz Status quo und Perspektiven für Klimaneutralität Thesis for the degree of Master of Science in Environmental and Resource Management submitted by Jan Christian Bahnsen 1st Examiner: Prof. Dr. Bernd Hirschl 2nd Examiner: Katharina Heinbach Submitted: 29th May 2020 Statement of Authentication I hereby declare that I am the sole author of this master thesis and that I have not used any other sources other than those listed in the bibliography and identified as references. I further declare that I have not submitted this thesis at any other institution in order to obtain a degree. The content, either in full or in part, has not been previously submitted for grading at this or any other academic institution. ________________________________ _____________________________________ (Place, Date) (Signature) Abstract The master thesis at hand examines the potential of district heating in Lusatia. The thesis follows the approach of first identifying technical and economic potentials in general and then transferring them to the study region. For the quantitative determination of district heating potential in Lusatia, the status quo is determined and a GIS-based analysis is carried out with regard to minimum heat demand densities. The extent to which district heating is suitable for climate-neutral heat supply will be investigated using the potential of renewable and waste heat energy sources. Furthermore, the regional economic effects of developing these potentials are examined. The results show that despite an overall decline in heat demand, there is potential to increase the relative share of district heating in Lusatia. -

Mit Substitution Therapieren Bild: © Fizkes
11 • 2020 Kassenärztliche Vereinigung Sachsen Bündnis gegen Sucht Mit Substitution therapieren Bild: © fizkes - www.fotosearch.de Zurück zu den Wurzeln – Nachfolge Bekanntmachung des Influenzaimpfstoff: für Landarztpraxis gefunden Landesausschusses Bedarf 2021 / 2022 Seite 6 Seite I Seite XIII Wir suchen Sie als Fachärztin / Facharzt für Allgemeinmedizin an der Internationalen Praxis am Klinikum Chemnitz befristet in Vollzeit bis zum 31. Dezember 2022 Das können Sie erwarten: • hausärztliche Versorgung eines internationalen Patientenklientels mit Unterstützung durch Sprachmittler • Übernahme der Weiterbildungsverantwortung für die in der Praxis angestellten Ärzte • enge Zusammenarbeit mit den externen Leistungserbringern bei der Organisation notwendiger fachärztlicher Weiterversorgung Ihre Voraussetzungen: • Facharzt für Allgemeinmedizin mit mindestens dreijähriger Facharzttätigkeit • Sensibilität im Umgang mit einem internationalen Patientenklientel • Flexibilität, Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit • gute Fremdsprachenkenntnisse wünschenswert Bei Fragen und Interesse: KV Sachsen, Bezirksgeschäftsstelle Chemnitz, Pia Ranft Telefon: 0371 2789-103 E-Mail: [email protected] www.kvsachsen.de > Karriere Stadt Chemnitz, Pressestelle – Foto: © Dirk Hanus Foto: Chemnitz, Pressestelle – Stadt Inhalt Editorial Recht 2 Bündnis gegen Sucht – mit Substitution therapieren 14 Aktuelle Fragen zur ärztlichen Berufsausübungs- gemeinschaft Standpunkt 4 Recht auf Krankheit Nachrichten 16 Grünes Licht für kv.dox: Der KIM-Dienst der KBV steht Im Gespräch -

L 282 Official Journal
ISSN 1725-2555 Official Journal L 282 of the European Union Volume 51 English edition Legislation 25 October 2008 Contents I Acts adopted under the EC Treaty/Euratom Treaty whose publication is obligatory REGULATIONS Commission Regulation (EC) No 1046/2008 of 24 October 2008 establishing the standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables ............................... 1 Commission Regulation (EC) No 1047/2008 of 24 October 2008 on the issue of licences for importing rice under the tariff quotas opened for the October 2008 subperiod by Regulation (EC) No 327/98 ......................................................................................... 3 ★ Commission Regulation (EC) No 1048/2008 of 23 October 2008 establishing a prohibition of fishing for cod in VI; EC waters of Vb; EC and international waters of XII and XIV by vessels flying the flag of Ireland ......................................................................... 6 ★ Commission Regulation (EC) No 1049/2008 of 23 October 2008 establishing a prohibition of fishing for cod in zones I and IIb by vessels flying the flag of France ........................ 8 ★ Commission Regulation (EC) No 1050/2008 of 24 October 2008 amending Regulation (EC) No 1580/2007 as regards the trigger levels for additional duties on cucumbers, artichokes, clementines, mandarins and oranges ............................................................. 10 ★ Commission Regulation (EC) No 1051/2008 of 24 October 2008 amending Annex V to Council Regulation (EC) No 1342/2007 as regards the quantitative limits of certain steel products from the Russian Federation ........................................................................... 12 ★ Regulation (EC) No 1052/2008 of the European Central Bank of 22 October 2008 amending Regulation (EC) No 1745/2003 (ECB/2003/9) on the application of minimum reserves (ECB/2008/10) ................................................................................... -

Commission Decision of 24 October 2008
Changes to legislation: There are currently no known outstanding effects for the Commission Decision of 24 October 2008 amending Decision 2006/415/EC concerning certain protection measures in relation to an outbreak of highly pathogenic avian influenza of the subtype H5N1 in poultry in Germany (notified under document number C(2008) 6154) (Text with EEA relevance) (2008/812/EC). (See end of Document for details) Commission Decision of 24 October 2008 amending Decision 2006/415/EC concerning certain protection measures in relation to an outbreak of highly pathogenic avian influenza of the subtype H5N1 in poultry in Germany (notified under document number C(2008) 6154) (Text with EEA relevance) (2008/812/EC) COMMISSION DECISION of 24 October 2008 amending Decision 2006/415/EC concerning certain protection measures in relation to an outbreak of highly pathogenic avian influenza of the subtype H5N1 in poultry in Germany (notified under document number C(2008) 6154) (Text with EEA relevance) (2008/812/EC) THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Having regard to the Treaty establishing the European Community, Having regard to Council Directive 89/662/EEC of 11 December 1989 concerning veterinary checks in intra-Community trade with a view to the completion of the internal market(1), and in particular Article 9(4) thereof, Having regard to Council Directive 90/425/EEC of 26 June 1990 concerning veterinary and zootechnical checks applicable in intra-Community trade in certain live animals and products with a view to the completion of the -

Und Straßenverzeichnis
Alphabetisches Orts- und Straßenverzeichnis Stadtgebiet Weißwasser lt. Straßenverzeichnis: Straßenname Zuständigkeit A Ackerstraße Herr Freymann Albert-Schweitzer-Ring Herr Backasch Alexanderstraße Herr Freymann Am Anger Herr Freymann Am Freizeitpark Herr Backasch Am Qualisch Herr Freymann Am Sägewerk Herr Freymann Am Schulsacker Herr Freymann Am Tierpark Herr Freymann An der Philippine Herr Freymann An der Rennbahn Herr Backasch An der Ziegelei Herr Freymann Auensiedlung Herr Freymann August-Bebel-Straße Herr Backasch B Bahnhofstraße Herr Freymann Bärenstraße Herr Freymann Bautzener Straße Herr Freymann Bergstraße Herr Backasch Berliner Straße Herr Freymann Bertold-Brecht-Straße Herr Backasch Birkenweg Herr Freymann Bodelschwinghstraße Herr Freymann Boxberger Straße Herr Backasch Braunsteichweg Herr Freymann Brentanoweg Herr Backasch Brunnenstraße Herr Freymann Bruno-Bürgel-Straße Herr Freymann D Damaschkestraße Herr Freymann Dominium Herr Backasch H:\Verteiler-Verwaltung\Alphabetisches Orts- und Straßenverzeichnis Gerichtsvollzieher - mit Linien-2020.docx Dr. Altmann-Straße Herr Freymann E Eichendorffweg Herr Backasch Eichengrund Herr Backasch Eisenbahnstraße Herr Freymann F Feldstraße Herr Backasch Forster Straße Herr Freymann Forstweg Herr Backasch Friedrich-Fröbel-Straße Herr Freymann G Gablenzer Weg Herr Freymann Gartenstraße Herr Backasch Geschwister-Scholl-Straße Herr Backasch Glückaufstraße Herr Freymann Goethestraße Herr Backasch Görlitzer Straße Herr Backasch Graf-von-Stauffenberg-Straße Herr Backasch Grillparzer Straße Herr -

NEISSELAND-Tour Mit Dem Rad Erleben
1 Gaststätte und Pension 4 Bauernhof Ladusch 8 Martinshof Rothenburg Diakoniewerk, Brüderhaus 10 13 Ferienwohnung Gorn "Forsthaus am Erlichthof" KREBA-NEUDORF ROTHENBURG/O.L. STEINÖLSA RIETSCHEN E Mühlgasse 10 • 02929 Rothenburg/O.L. E Am Erlichthof 1 q +49 (0) 35891 - 3 81 45 p +49 (0) 35891 - 3 82 66 E Waldhof 2 02956 Rietschen @ [email protected] 02906 Quitzdorf am See offene Kirche q +49 (0) 35772 - 4 05 62 E Nieskyer Straße 26 www.martinshof-diakoniewerk.de OT Steinölsa p +49 (0) 35772 - 4 00 90 02906 Kreba-Neudorf q +49 (0) 35893 - 63 23 @ [email protected] q +49 (0) 35893 - 63 00 Das Brüderhaus des Martinshofes bietet Ihnen: p +49 (0) 35893 - 5 02 05 www.forsthaus-erlichthof.de p +49 (0) 35893 - 5 07 37 • Barrierefreiheit n +49 (0) 170 - 4 00 63 95 @ [email protected] • komfortable Gästezimmer für Gruppen und Einzelbesucher, Ferienwohnung Waldhof Barbara Reimann @ [email protected] Schlemmen und Schlafen im www.bauernhof-ladusch.de buchbar mit und ohne Verpflegung STEINÖLSA www.ferienwohnung-gorn.de Schrotholzhaus: Regionale Küche, • Bett+Bike-zertifiziert hausgebackene Kuchen und Tor- • Bauernmuseum (Mai-September) auf Anfrage E Waldhof 4 • 02906 Quitzdorf am See OT Steinölsa ten, Pensionszimmer, Ferienhaus, • Sauna, Schwimmen, Kegelbahn auf Anfrage q +49 (0) 35893 - 62 21 n +49 (0) 176 - 99 96 04 72 • p Ferienwohnung, Museumsdorf, 5 Ferienparadies „Seeblick“ Weiterbildungen und Seminare inkl. Technik +49 (0) 35893 - 5 02 13 14 Hotel und Restaurant Bürgerhaus Wolfsexkursionen. NIEDERSPREE • wechselnde Ausstellungen regionaler Künstler @ [email protected] • www.ferienwohnung-waldhof.de NIESKY • offene Kapelle "Zum Kripplein Christi" E Niederspree Nr. -

Beteiligungsbericht 2017 Große Kreisstadt Görlitz
[GebenGroße Sie Kreisstadt den Titel des DokumentsGörlitz ein] Beteiligungsbericht 2017 1 von 166 Inhaltsverzeichnis Einführung ................................................................................................................................................3 Tabellarische Übersicht über die städtischen Beteiligungen 2017...........................................................4 Organigramm der städtischen Beteiligungen 2017 ..................................................................................7 Organigramm der Mitgliedschaften an Zweckverbänden 2017 ................................................................8 Übersicht über Finanzbeziehungen der Stadt Görlitz 2017 .....................................................................9 Konzernlagebericht der Stadt Görlitz .................................................................................................... 11 Erläuterung der finanziellen Kennzahlen ............................................................................................... 22 Eigenbetrieb: ........................................................................................................................................ 24 Städtischer Friedhof Görlitz ................................................................................................................... 25 Eigengesellschaften: ........................................................................................................................... 32 Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH ................................................................................................... -
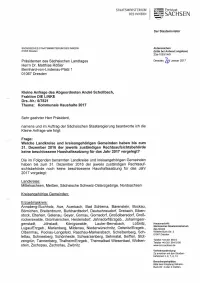
T'31 SACHSEN C C23
STAATSMINISTERIUM -;-= Freistaat DES INNERN t'31 SACHSEN c c23, Der Staatsminister SACHSISCHES STAATSMINISTERIUM DES INNERN Aktenzeichen 01095 Dresden (bitte bei Antwort angeben) 23a-1053/14/9 Präsidenten des Sächsischen Landtages Dresden, 7 0 Januar 2017 Herrn Dr. Matthias Rößler Bernhard -von -Lindenau -Platz 1 01067 Dresden Kleine Anfrage des Abgeordneten Andre Schollbach, Fraktion DIE LINKE Drs.-Nr.: 6/7821 Thema: Kommunale Haushalte 2017 Sehr geehrter Herr Präsident, namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: Frage: Welche Landkreise und kreisangehörigen Gemeinden haben bis zum 31. Dezember 2016 der jeweils zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde keine beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2017 vorgelegt? Die im Folgenden benannten Landkreise und kreisangehörigen Gemeinden haben bis zum 31. Dezember 2016 der jeweils zuständigen Rechtsauf- sichtsbehörde noch keine beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2017 vorgelegt: Landkreise: Mittelsachsen, Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Nordsachsen Kreisangehörige Gemeinden: Erzgebirgskreis: Annaberg-Buchholz, Aue, Auerbach, Bad Schlema, Bärenstein, Bockau, Börnichen, Breitenbrunn, Burkhardtsdorf, Deutschneudorf, Drebach, Eiben- stock, Elterlein, Gelenau, Geyer, Gornau, Gornsdorf, Großolbersdorf, Groß- rückerswalde, Grünhainichen, Heidersdorf, Jahnsdorf/Erzgeb., Johanngeor- genstadt, Jöhstadt, Königswalde, Lauter-Bernsbach, Lößnitz, Hausanschrift: Sächsisches Staatsministerium Lugau/Erzgeb., Marienberg, Mildenau, Niederwürschnitz, -

B Commission Implementing Regulation (Eu
02021R0605 — EN — 03.08.2021 — 003.001 — 1 This text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. The Union's institutions do not assume any liability for its contents. The authentic versions of the relevant acts, including their preambles, are those published in the Official Journal of the European Union and available in EUR-Lex. Those official texts are directly accessible through the links embedded in this document ►B COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/605 of 7 April 2021 laying down special control measures for African swine fever (Text with EEA relevance) (OJ L 129, 15.4.2021, p. 1) Amended by: Official Journal No page date ►M1 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/623 of 15 April 2021 L 131 137 16.4.2021 ►M2 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/687 of 26 April 2021 L 143 11 27.4.2021 ►M3 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/811 of 20 May 2021 L 180 114 21.5.2021 ►M4 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/902 of 3 June 2021 L 197 76 4.6.2021 ►M5 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/952 of 11 June 2021 L 209 95 14.6.2021 ►M6 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/994 of 18 June 2021 L 219 1 21.6.2021 ►M7 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1090 of 2 July 2021 L 236 10 5.7.2021 ►M8 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1141 of 12 July 2021 L 247 55 13.7.2021 ►M9 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1205 of 20 July 2021 L 261 8 22.7.2021 ►M10 Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1268 of 29 July 2021 L 277 99 2.8.2021 02021R0605 — EN — 03.08.2021 — 003.001 — 2 ▼B COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/605 of 7 April 2021 laying down special control measures for African swine fever (Text with EEA relevance) CHAPTER I SUBJECT MATTER, SCOPE AND DEFINITIONS Article 1 Subject matter and scope 1.