Forschungen Zur Baltischen Geschichte 1 2006
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ardo Hansson: Working Together for the Good of the EU and Estonia
Ardo Hansson: Working together for the good of the EU and Estonia Opening speech by Mr Ardo Hansson, Governor of the Bank of Estonia (Eesti Pank), to the Ragnar Nurkse Lecture for the 95th Anniversary of Eesti Pank, Tallinn, 4 November 2014. * * * Professor Balcerowicz, President of the Riigikogu, Chair of the Supervisory Board of Eesti Pank, Excellencies, Ladies and Gentlemen, Thank you for being here today to mark the 95th anniversary of Eesti Pank and to honour Ragnar Nurkse, the world's best-known economist from Estonia to date. Eesti Pank was founded when the Republic of Estonia was only a year old and Ragnar Nurkse was a model eleven-year-old pupil at the Tallinn Cathedral School. In the words of Juhan Kukk, the Minister of Finance of the time, founding Eesti Pank as the issuer of the national currency and tying the currency to gold showed the same great “bravery and belief in national and economic independence” as engaging in the War of Independence did. Ragnar Nurkse started his studies in the University of Tartu, but he soon moved to continue them in the School of Economics of the University of Edinburgh and later in Vienna. He was recognised in his home country for his work, as is shown by the worried letter that Jüri Jaakson, Governor of Eesti Pank at the time, sent him in spring 1938. Nurkse was working in Geneva at the time for the League of Nations, the forerunner of the United Nations. The letter says: “The rise in the cost of living in the past three years has been larger than has been seen in many other countries that compete with us in foreign markets. -

List of Prime Ministers of Estonia
SNo Name Took office Left office Political party 1 Konstantin Päts 24-02 1918 26-11 1918 Rural League 2 Konstantin Päts 26-11 1918 08-05 1919 Rural League 3 Otto August Strandman 08-05 1919 18-11 1919 Estonian Labour Party 4 Jaan Tõnisson 18-11 1919 28-07 1920 Estonian People's Party 5 Ado Birk 28-07 1920 30-07 1920 Estonian People's Party 6 Jaan Tõnisson 30-07 1920 26-10 1920 Estonian People's Party 7 Ants Piip 26-10 1920 25-01 1921 Estonian Labour Party 8 Konstantin Päts 25-01 1921 21-11 1922 Farmers' Assemblies 9 Juhan Kukk 21-11 1922 02-08 1923 Estonian Labour Party 10 Konstantin Päts 02-08 1923 26-03 1924 Farmers' Assemblies 11 Friedrich Karl Akel 26-03 1924 16-12 1924 Christian People's Party 12 Jüri Jaakson 16-12 1924 15-12 1925 Estonian People's Party 13 Jaan Teemant 15-12 1925 23-07 1926 Farmers' Assemblies 14 Jaan Teemant 23-07 1926 04-03 1927 Farmers' Assemblies 15 Jaan Teemant 04-03 1927 09-12 1927 Farmers' Assemblies 16 Jaan Tõnisson 09-12 1927 04-121928 Estonian People's Party 17 August Rei 04-121928 09-07 1929 Estonian Socialist Workers' Party 18 Otto August Strandman 09-07 1929 12-02 1931 Estonian Labour Party 19 Konstantin Päts 12-02 1931 19-02 1932 Farmers' Assemblies 20 Jaan Teemant 19-02 1932 19-07 1932 Farmers' Assemblies 21 Karl August Einbund 19-07 1932 01-11 1932 Union of Settlers and Smallholders 22 Konstantin Päts 01-11 1932 18-05 1933 Union of Settlers and Smallholders 23 Jaan Tõnisson 18-05 1933 21-10 1933 National Centre Party 24 Konstantin Päts 21-10 1933 24-01 1934 Non-party 25 Konstantin Päts 24-01 1934 -

The Daughter of Peter the Great; a History of Russian Diplomacy and Of
Digitized by the Internet Archive in 2007 with funding from Microsoft Corporation http://www.archive.org/details/daughterofpetergOObainuoft /t<r /,// six THE DAUGHTER OF PETER THE GREAT A HISTORY OF RUSSIAN DIPLOMACY AND OF THE RUSSIAN COURT UNDER THE EMPRESS ELIZABETH PETROVNA 1 741-1762 BY R. NISBET BAIN AUTHOR OF "THE PUPILS OF PETER THE GREAT" "GUSTAVUS III AND HIS CONTEMPORARIES" "CHARLES XIII" ETC ETC NEW YORK E. P. DUTTON AND CO WESTMINSTER ARCHIBALD CONSTABLE AND CO 1900 Reprinted by Scholarly Press - 22929 Industrial Drive East - St. Clair Shores, Mich. 48080 PK B32> G^ LIST OF ILLUSTRATIONS. Elizabeth Petrovna, aetat. 32. Photogravure Frontispiece. Field Marshal Count Munnich . Face Page 22 The Grand Duke Peter, aetat. 16 . „ ,, 66 The Grand Chancellor Count Alexius Bestuzhev-Ryumin , „ p7 The Grand Duchess Catherine ... „ „ 234. Elizabeth Petrovna, aetat. 52 ... „ „ 286 The Grand Duke Peter, aetat'. 33 . ,, „ 314 — — CONTENTS. PAGE INTRODUCTION xi BIBLIOGRAPHY xv CHAPTER I. introductory— peter's pupils i Death of Peter the Great —Danger of a reaction— Peter's pupils—Menshi- kov, Tolstoi, Yaguzhinsky—Their promptness—Catherine I and her difficulties—The history of Russia during the eighteenth century the liistory of her foreign policy —Why this was so — Ostermann—The hostility of England brings about the Austro-Russian Alliance Peter II—Anne of Courland — Brutality of her favourite, Biren—His character—The genius of Ostermann—Russia's triumphs abroad—Miin- nich and Lacy—Death of Anne—Merits and defects of her government. CHAPTER -

Eesti Rahvusbibliograafia Raamatud
EESTI RAHVUSBIBLIOGRAAFIA RAAMATUD ESTONIAN NATIONAL BIBLIOGRAPHY BOOKS 2004 12 Detsember - December 2004detsember.p65 1 03.05.06, 10:57 Koostaja Compiled by Eesti Rahvusraamatukogu National Library of Estonia Kogude arenduse osakond Department of Collection Development and Documentation Ilmub 12 numbrit aastas / Issued monthly © Eesti Rahvusraamatukogu, 2005 Eesti Rahvusbibliograafia Series of seeriad: the Estonian National Bibliography: RAAMATUD BOOKS PERIOODIKA SERIALS MUUSIKA MUSIC Väljaandeid müüb: The publications can be purchased from Eesti Rahvusraamatukogus asuv the bookshop Lugemisvara in the raamatukauplus Lugemisvara National Library of Estonia Hind 70 krooni Price 70 krooni Tõnismägi 2 10122 Tallinn 2004detsember.p65 2 03.05.06, 10:57 SAATEKS Raamatud on Eesti rahvusbibliograafia osa, mis ilmub 1999. aastast alates kuuvihikuna ja aastaväljaandena. Aastatel 1946-1991 kandis väljaanne pealkirja Raamatukroonika. Raamatud kajastab Eestis kõigis keeltes ja väljaspool Eestit ilmunud eestikeelseid raamatuid, nii trüki- kui ka elektroonilisi väljaandeid ning mittemuusikalisi auviseid. Raamatud sisaldab ka pimedaile ja vaegnägijaile mõeldud teavikuid. Nimestik ei hõlma piiratud lugemisotstarbe või lühiajalise tähtsusega trükiseid (näit. asutuste kvartaliaruandeid, reklaamväljaandeid jms.). Kuuvihik peegeldab ühe kuu jooksul Eesti Rahvusraamatukogusse saabunud uued teavikud, mida kirjeldatakse rahvusvaheliste kirjereeglite ISBD(M), ISBD(NBM) ja ISBD(ER) järgi. Lisaks kajastab nimestik rahvusbibliograafias seni registreerimata väljaanded, -
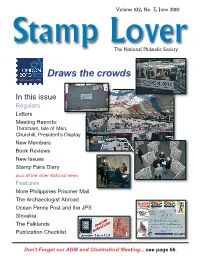
Draws the Crowds
Volume 102, No. 3, June 2010 The National Philatelic Society Draws the crowds In this issue Regulars Letters Meeting Reports: Thatcham, Isle of Man, Churchill, President’s Display New Members Book Reviews New Issues Stamp Fairs Diary plus all the other National news Features More Philippines Prisoner Mail The Archaeologist Abroad Ocean Penny Post and the JPS Slovakia The Falklands Publication Checklist Don’t Forget our AGM and Chelmsford Meeting....see page 66. Stamp Lover The Journal of the National Philatelic Society © 2009 National Philatelic Society & Individual Authors/Contributors What’s Inside ISSN 0038-9277 Vol. 102 No. 3 June 2010 The National Philatelic Society One of the largest general philatelic societies, it was founded as the Junior Philatelic Society by Fred Melville in 1899. UK Membership £27 a year (or £23 if living 60 miles or more from London). President’s Message Overseas Membership £19. ................................................................. For further details including our £15 Chris Oliver 63 introductory offer and application contact the Secretary at the General address given Editor’s column - first impressions of London 2010.......... 65 below or visit the Society website www.ukphilately.org.uk/nps General, including Membership Letters ................................................................................. 65 and “Shop Window” National Philatelic Society, c/o The British Postal Museum & Archive, Freeling House, National PS News Phoenix Place, London WC1X 0DL ................................................................ 66 [email protected] Tel: 020 7239 2571 Peter Mellor. Library: National Philatelic Society Library As above address. Email: Meetings Report: Thatcham, Isle of Man, Churchill and the [email protected] President’s displays Circulating Packets: NPS Unit CP, as above Tel: 0792 514 9048 (Thursdays only 10am – 3pm) by the Editor, photos by Chris Oliver..................................68 (Callers re Packets by prior arrangement only) Auctions and Literature Sales Features Michael R. -

Crols, Dirk (2006) from Tsarist Empire to League of Nations and from USSR to EU: Two Eras in the Construction of Baltic State Sovereignty
Crols, Dirk (2006) From Tsarist empire to League of Nations and from USSR to EU: two eras in the construction of Baltic state sovereignty. PhD thesis. http://theses.gla.ac.uk/2453/ Copyright and moral rights for this thesis are retained by the author A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the Author The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the Author When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given Glasgow Theses Service http://theses.gla.ac.uk/ [email protected] FROM TSARIST EMPIRE TO LEAGUE OF NATIONS AND FROM USSR TO EU: TWO ERAS IN THE CONSTRUCTION OF BALTIC STATE SOVEREIGNTY Thesis submitted by Dirk Crols to obtain the degree of Doctor of Philosophy (PhD). Date of submission: 23 July 2006 Department of Central and East European Studies, University of Glasgow Supervisor: Dr. David Smith, Senior Lecturer, Department of Central and East European Studies, University of Glasgow. 1 ABSTRACT This thesis examines how the three Baltic countries constructed their internal and external sovereign statehood in the interwar period and the post Cold War era. Twice in one century, Estonia, Latvia and Lithuania were namely confronted with strongly divided multiethnic societies, requiring a bold and wide-ranging ethnic policy. In 1918 all three Baltic countries promised their minorities cultural autonomy. -

The University of Chicago Smuggler States: Poland, Latvia, Estonia, and Contraband Trade Across the Soviet Frontier, 1919-1924
THE UNIVERSITY OF CHICAGO SMUGGLER STATES: POLAND, LATVIA, ESTONIA, AND CONTRABAND TRADE ACROSS THE SOVIET FRONTIER, 1919-1924 A DISSERTATION SUBMITTED TO THE FACULTY OF THE DIVISION OF THE SOCIAL SCIENCES IN CANDIDACY FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY DEPARTMENT OF HISTORY BY ANDREY ALEXANDER SHLYAKHTER CHICAGO, ILLINOIS DECEMBER 2020 Илюше Abstract Smuggler States: Poland, Latvia, Estonia, and Contraband Trade Across the Soviet Frontier, 1919-1924 What happens to an imperial economy after empire? How do economics, security, power, and ideology interact at the new state frontiers? Does trade always break down ideological barriers? The eastern borders of Poland, Latvia, and Estonia comprised much of the interwar Soviet state’s western frontier – the focus of Moscow’s revolutionary aspirations and security concerns. These young nations paid for their independence with the loss of the Imperial Russian market. Łódź, the “Polish Manchester,” had fashioned its textiles for Russian and Ukrainian consumers; Riga had been the Empire’s busiest commercial port; Tallinn had been one of the busiest – and Russians drank nine-tenths of the potato vodka distilled on Estonian estates. Eager to reclaim their traditional market, but stymied by the Soviet state monopoly on foreign trade and impatient with the slow grind of trade talks, these countries’ businessmen turned to the porous Soviet frontier. The dissertation reveals how, despite considerable misgivings, their governments actively abetted this traffic. The Polish and Baltic struggles to balance the heady profits of the “border trade” against a host of security concerns shaped everyday lives and government decisions on both sides of the Soviet frontier. -

Download Download
International Review of Scottish Studies Vol. 29 2004 Rebecca Wills, The Jacobites in Russia 1715-1750. East Linton, Scotland: Tuckwell Press, 2002. xvi + 253 pp. $47.95 (CAN), $31.95, (US). £20.00. ISBN 1862321426. Since the 1970s, works on Jacobite history have flowed with wild abandon from presses around the globe. Historians like E. Cruickshanks, D. Szechi, P. Monod, J. Black, B. Lenman, M. Pittock, and F. McLynn have cast their eye upon issues of politics and culture, primarily within an exclusively domestic framework. Too often these works have left the impression that the Jacobite movement was little more than a noble and chivalric, but ultimately doomed, attempt by the ‘Children of the Mist’, a ragtag band of Highland and Irish misfits, to affect the restoration of the exiled Stuart monarchy. Likewise, the exiled monarchs, especially James III, with whom Wills is primarily concerned, are portrayed as enig- matic, but ineffective leaders, making great plans but consis- tently failing to follow through. Rebecca Wills’ The Jacobites in Russia 1715-1750, taking as its theme the period of the Jacobite diaspora, suggests that the Jacobite movement, as it relates to early eighteenth century Russia, was far more nuanced and complex than previous work has allowed. In the course of her work, Wills examines the nature of Russo-Jacobite relations - not only in a Russian context, but in a broader European one – and the crisis of identity facing the men who were both Jacobite and Russian. Though some historians have begun to look at Jacobitism in a wider European context (notably, D. -

MARIA GROENEVELD of the State and the Role Society Relationship Policy Making Process in the Foreign
DISSERTATIONES RERUM MARIA GROENEVELD POLITICARUM UNIVERSITATIS TARTUENSIS 7 The role of the state and society relationship in the foreign policy making process in the foreign of the state and society relationship The role MARIA GROENEVELD The role of the state and society relationship in the foreign policy making process Tartu 2012 ISSN 1736–4205 ISBN 978–9949–32–174–2 DISSERTATIONES RERUM POLITICARUM UNIVERSITATIS TARTUENSIS 7 DISSERTATIONES RERUM POLITICARUM UNIVERSITATIS TARTUENSIS 7 MARIA GROENEVELD The role of the state and society relationship in the foreign policy making process Institute of Government and Politics, Faculty of Social Sciences and Education, University of Tartu, Estonia Dissertation was accepted for the commencement of the degree of Doctor of Philosophy (in Political Science) on 1 November 2012 by the Council of the Faculty of Social Sciences and Education, University of Tartu. Supervisors: Prof. Andres Kasekamp, University of Tartu, Estonia Dr. Alexander Astrov, Central European University, Hungary Opponent: Prof. Hiski Haukkala, University of Tampere, Finland Commencement: 3 December 2012 Publication of this thesis is granted by the Institute of Government and Politics, University of Tartu and by the Doctoral School of Behavioural, Social and Health Sciences created under the auspices of the European Union Social Fund. ISSN 1736–4205 ISBN 978–9949–32–174–2 (print) ISBN 978–9949–32–175–9 (pdf) Copyright: Maria Groeneveld, 2012 University of Tartu Press www.tyk.ee Order No 559 TABLE OF CONTENTS ACKNOWLEDGEMENTS .......................................................................... 8 INTRODUCTION .......................................................................................... 9 CHAPTER 1. STATE AND SOCIETY RELATIONSHIP IN CONSTRUCTIVISM ............................................................................... 16 1.1. Rationalist approaches of International Relations ............................. 16 1.2. Constructivist approach of International Relations .......................... -

Eesti Ajutine Valitsus Priiuse Põlistumise Vaatepunktist
Eesti ajutine valitsus priiuse põlistumise vaatepunktist Ago Pajur 27. märtsil 2013 tähistati Eestis priiuse põlistumise püha, see tähendab möödus 7890 päeva 1991. aasta 20. augustist, mil taas tati Eesti iseseisvus, ning kaasaegne Eesti Vabariik sai niisama vanaks, kui oli maailmasõdade vaheline Eesti Vabariik 17. juunil 1940, mil omariiklus asendus Nõukogude okupatsiooniga. See täht päev annab põhjust heita pilk riikliku iseseisvuse kujunemisloole. Priiuse põlistumise püha tähistamise algatajad on lähtunud eeldusest, et Eesti Vabariik loodi küll 24. veebruaril 1918, kuid jõudis kesta vaid ühe päeva, sest juba 25. veebruaril algas Saksa okupat sioon. Seetõttu on riigi vanust arvestatud 11. novembrist 1918, mil väidetavalt lõppes Saksa okupatsioon ja taastus Eesti riigivõimu tegevus, ning lisatud saadud vanusele üks päev veebruarist – 24. veebruar 1918 (Ideon 2013). Kõikmõeldavad tähtpäevad kipuvadki olema kokkuleppelise iseloomuga, kuid siiski tekitavad arvutuste aluseks võetud daatumid (1918. aasta 24. ja 25. veebruar ning 11. november) lähemal vaatlusel kahtlusi. Sellega seoses tuleks vastata kolmele küsimusele. 1. Millal loodi Eesti riigivõim? 2. Millal katkes Eesti riigivõimu toimimine? 3. Millal taastus Eesti riigivõimu tegevus? Enne kui hakata neile küsimustele vastust otsima, leppigem kokku lähtekohtades: 1) Eesti riik sündis 24. veebruaril 1918 Tallinnas ja 2) riigivõimu kandjaks oli ajutine valitsus.1 1 Loomulikult võib Eesti riikluse alguseks pidada ka 1917. aasta 15. novembrit või 1918. aasta 23. veebruari, kuid selline lähtekoht eeldab, et riigivõimuna 79 Ago Pajur Eesti riigivõim asub tegutsema 1918. aasta 24. veebruari varahommikul asusid enamlased koos Vene soldatite ja madrustega Tallinnast põgenema ning rahvus likud jõud võisid alustada tegevust. Pärastlõunal kujunes iseseis vuslaste peamiseks keskuseks endise Venemaa riigipanga Tallinna osakonna (hilisema Eesti Panga) hoone (ill. -

In the Ottoman Empire
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Bilkent University Institutional Repository THE OTTOMAN-RUSSIAN RELATIONS BETWEEN THE YEARS 1774-1787 A Master’s Thesis by ABDÜRRAHİM ÖZER DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS BILKENT UNIVERSITY ANKARA August 2008 To my beloved sister, THE OTTOMAN-RUSSIAN RELATIONS BETWEEN THE YEARS 1774-1787 The Institute of Economics and Social Sciences of Bilkent University by ABDÜRRAHİM ÖZER In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of MASTER OF ARTS in THE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS BILKENT UNIVERSITY ANKARA August 2008 I certify that I have read this thesis and have found that it is fully adequate, in scope and in quality, as a thesis for the degree of Master of Arts in International Relations. --------------------------- Associate Prof. Hakan Kırımlı Supervisor I certify that I have read this thesis and have found that it is fully adequate, in scope and in quality, as a thesis for the degree of Master of Arts in International Relations. --------------------------- Assistant Prof. Dr. Oktay Özel Examining Committee Member I certify that I have read this thesis and have found that it is fully adequate, in scope and in quality, as a thesis for the degree of Master of Arts in International Relations. --------------------------- Dr. Hasan Ali Karasar Examining Committee Member Approval of the Institute of Economics and Social Sciences --------------------------- Prof. Dr. Erdal Erel Director ABSTRACT THE OTTOMAN-RUSSIAN RELATIONS BETWEEN THE YEARS 1774-1787 Özer, Abdürrahim M.A., Department of International Relations Supervisor: Associate Prof. Hakan Kırımlı August 2008 In this work, the diplomatic relations between the Ottoman Empire and Russia during the late 18th century will be analyzed. -

Roll Eesti Riigi Loomisel Ja Edendamisel (1917-1940)
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by DSpace at Tartu University Library Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond Ajaloo ja arheoloogia instituut Eesti ajaloo osakond RÜNDO MÜLTS AUGUST JÜRMANI (JÜRIMA) ROLL EESTI RIIGI LOOMISEL JA EDENDAMISEL (1917-1940) Magistritöö Juhendaja: dots. Ago Pajur Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS.......................................................................................................................3 Metodoloogiast ja struktuurist.................................................................................................4 Historiograafia........................................................................................................................6 Allikad..................................................................................................................................10 1.AUGUST JÜRMAN EESTI RIIKLUSE LOOMISEL (1917-1920)................................13 1.1. Eesti Maarahva Liitu asutamas......................................................................................15 1.2. 1917. aastal Pärnu maakonna agronoomina..................................................................21 1.3. Eesti iseseisvuse väljakuulutamine Pärnus....................................................................27 1.4. Saksa okupatsioon Pärnumaal ja August Jürman aastal 1918......................................33 1.5. Ajutise Valitsuse komissar............................................................................................38