1941-Vom Namen Unseres Landes
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
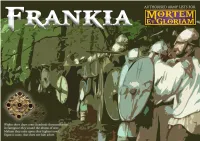
Meg-Army-Lists-Frankia-2019-03.Pdf
Army Lists Frankia Contents Tolosan Visigoth 419 to 621 CE Gallia Aquitania 628 to 632 CE Early Merovingian Frank 485 to 561 CE Charles Martel Frank 718 to 741 CE Burgundian 496 to 613 CE Astur-Leonese 718 to 1037 CE Provencal 496 to 639 CE Carolingian 741 to 888 CE Swabian Duchies 539 to 744 CE Charlemagne Carolingian (03) 768 to 814 CE Austrasia 562 to 639 CE Early Navarrese 778 to 1035 CE Neustria 562 to 639 CE East Frankish 888 to 933 CE Breton 580 to 1072 CE Early Medieval French 888 to 1045 CE Later Merovingian Frank 613 to 717 CE Norman 911 to 1071 CE Later Visigoth 622 to 720 CE Early Holy Roman Empire 933 to 1105 CE Version 2019.03: 31st March 2019 © Simon Hall Creating an army with the Mortem et Gloriam Army Lists Use the army lists to create your own customised armies using the Mortem et Gloriam Army Builder. There are few general rules to follow: 1. An army must have at least 2 generals and can have no more than 4. 2. You must take at least the minimum of any troops noted, and may not go beyond the maximum of any. 3. No army may have more than two generals who are Talented or better. 4. Unless specified otherwise, all elements in a UG must be classified identically. Unless specified otherwise, if an optional characteristic is taken, it must be taken by all the elements in the UG for which that optional characteristic is available. 5. Any UGs can be downgraded by one quality grade and/or by one shooting skill representing less strong, tired or understrength troops. -

Texte Zur Dorfgeschichte Von Untervaz
Untervazer Burgenverein Untervaz Texte zur Dorfgeschichte von Untervaz 2008 Churrätien im frühen Mittelalter Email: [email protected]. Weitere Texte zur Dorfgeschichte sind im Internet unter http://www.burgenverein-untervaz.ch/dorfgeschichte erhältlich. Beilagen der Jahresberichte „Anno Domini“ unter http://www.burgenverein-untervaz.ch/annodomini. - 2 - 2008 Churrätien im frühen Mittelalter Reinhold Kaiser Kaiser Reinhold: Churrätien im frühen Mittelalter. Ende 5. bis Mitte 10. Jahrhundert. Herausgegeben vom Institut für Kulturforschung Graubünden, Chur, in Verbindung mit dem Südtiroler Kulturinstitut, Bozen 2., überarbeitete und ergänzte Auflage Schwabe Verlag Basel 2008 - 3 - S. 229: Nachwort zur 2., überarbeiteten und ergänzten Auflage Was rechtfertigt es, ein Buch über «Churrätien im frühen Mittelalter» in einer verbesserten, zweiten Auflage herauszugeben und mit einem umfangreichen Nachwort zu versehen? Drei Gründe sprechen dafür: 1. Die erste Auflage von 1998 ist schon nach sechs Jahren vergriffen gewesen. Die seit 2004 andauernde stetige Nachfrage sowie die zahlreichen Rezensionen bestätigen die positive Aufnahme des Buches. Die Neuauflage erlaubt es, kleinere störende Fehler im Text und in den Legenden zu den Abbildungen und Karten zu verbessern, einige Karten neu zu gestalten und im Nachwort dem Forschungsfortschritt der letzten zehn Jahre Rechnung zu tragen. 2. Die Forschungen zum frühen Mittelalter - nicht nur die allgemein- historischen, sondern auch die regionalgeschichtlich orientierten - sind in den letzten Jahren zunehmend in den grösseren interdisziplinären Verbund der Forschungen zum Übergang von der Antike zum Mittelalter integriert. Als globales Phänomen des Kulturwandels stehen die Verwandlung der Mittelmeerwelt und die Herausbildung der drei mittelalterlichen Kulturkreise, des arabisch-islamischen, des griechisch-byzantinischen und des lateinisch okzidentalen, im Mittelpunkt des althistorischen, des mediävistischen und des universalhistorischen Interesses. -

Monarchia W Średniowieczu
M o n a r c h ia W ŚREDNIOWIECZU władza nad ludźmi, władza nad terytorium E f f iR I MONARCHIA W ŚREDNIOWIECZU władza nad ludźmi, władza nad terytorium Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi POD REDAKCJĄ JERZEGO PYSIAKA ANETY PIENIĄDZ-SKRZYPCZAK i MARCINA RAFAŁA PAUKA Towarzystwo Naukowe SOCIETAS VISTULANA Warszawa - Kraków 2002 Publikacja dofinansowana przez Wyższą Szkolę Humanistyczną w Pułtusku Na okładce: Koronacja Karola VI Walezjusza (1381), Les Grandes Chroniques de France (ok. 1382), Paris, Bibliothèque N ationale, Ms. fr. 2813 Opracowanie redakcyjne: Gabriela Marszalek Projekt okładki i stron tytułowych Jacek Szczerbiński /C5Ä&» (t^f) I ) Copyright by Towarzystwo Naukowe' „Soc4€taivistulana”,' " ' o * y Warszawa-Kraków 2002 ISBN 83-88385-11-9 Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana” 31-450 Kraków, ul. Ulanów 72/111, tel./fax411 47 36 BibL UAM EOr; W dniach 14, 15 i 16 grudnia 2000 r., w siedzibie Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk przy Rynku Starego Miasta w Warszawie, odbyła się konferen cja naukowa pt. Monarchia w średniowieczu - władza nad ludźmi,władza nad terytorium dedykowana Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi. Organizatorem konferencji był Instytut Historyczny Uniwersytetu War szawskiego, zaś jej pomysłodawcami - grono młodych mediewistów skupione w Instytucie Historycznym: Jerzy Pysiak, Aneta Pieniądz-Skrzypczak i Mar cin R. Pauk. Naszym celem było zaprezentowanie badań dotyczących podstaw ideowych, prawnych i społecznych monarchii średniowiecznej w możliwie szerokim kontekście porównawczym Europy łacińskiej. Stało się to możliwe dzięki zainteresowaniu, z jakim inicjatywa nasza spotkała się w wielu ośrod kach badawczych: w Warszawie, Lublinie, Opolu, Szczecinie, Pradze i Kra kowie. Niniejszy tom zawiera studia poświęcone monarchii wieków średnich w Europie od czasów jej ukształtowania się w barbarzyńskich społeczeństwach germańskich aż po późne średniowiecze. -

Werner Carigiet Lingua E Cultura Retoromance Rätoromanische
Babylonia Lingua e cultura retoromance Rätoromanische Sprache und Kultur Langue et culture rhétoromanches Lingua e cultura retorumantscha Responsabile di redazione per il tema: Werner Carigiet Con contributi di Arno Berther (Glion) Nicolas Bühler (Fribourg) Toni Cantien (Lenzerheide/Lai) Werner Carigiet (Dardin) Rico Cathomas (Fribourg) Georges Darms (Fribourg) Gion Antoni Derungs (Chur) Heidi Derungs-Brücker (Chur) Anna Maria Elmer-Cantieni (Landquart) Gian-Peder Gregori (Domat/Ems) Erwin Huonder (Samedan) Lia rumantscha (Cuira) Wally Liesch (Vella) Eveline Nay (Laax) Constantin Pitsch (Bern) Cla Riatsch (Bern) Clau Solèr (Chur) Christian Sulser (Chur) Claudio Vincenz (Chur) Con un inserto didattico di Werner Carigiet Questo numero ha potuto essere realizzato grazie al sostegno del Canton Grigioni, della Lia Rumantscha e del Dipartimento Istruzione e Cultura del Canton Ticino. Babylonia Trimestrale plurilingue edito dalla Fondazione Lingue e Culture cp 120, CH-6949 Comano ISSN 1420-0007 no 3 / anno VI / 1998 1 Babylonia 3/98 2 Babylonia 3/98 Sommario Inhalt Sommaire Cuntegn 4 Editoriale Tema Lingua e cultura retoromance Rätoromanische Sprache und Kultur Langue et culture rhétoromanches Lingua e cultura retorumantscha 6 Taidla tat, ins tucca ils zains-baselgia per Tschinquaisma Clau Solèr 7 Die Sprachgeographie Romanischbündens Lia rumantscha 9 Breve storia del retoromancio / Geschichte des Rätoromanischen Lia rumantscha 13 Das Rätoromanische in der Statistik Lia rumantscha 14 La Lia rumantscha Lia rumantscha 16 DRG: Institut dal Dicziunari -

Hannes Obermair
Hannes Obermair Il diritto della regio tirolese e trentina tra epoca tardoantica e altomedioevale [A stampa in Romani e Germani nel cuore delle Alpi tra V e VIII secolo, a cura del Südtiroler Kulturinstitut, Bolzano 2005, pp. 121-133 © dell’autore – Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”] Secondo Isidoro di Siviglia e altri autori altomedievali, i diversi gruppi sociali erano caratterizzati da origo (provenienza), lex (forme di diritto), mores (costumi e tradizioni), religio (concezioni morali e religiose), e lingua1 . Il presente saggio intende analizzare, in ambito regionale, i fondamenti sociali del diritto e il suo significato intrinseco di cultura e identità. Le norme legislative a noi tramandate sono uno dei risultati più significativi dell’alto medioevo europeo. La produzione di leggi e documenti si impone come elemento d’analisi determinante per lo studio della convivenza tra popolazioni romanze e germaniche nel territorio delle Alpi centrali: le forme di mescolanza devono infatti avere lasciato delle tracce nella scrittura. In questo senso risulta fondamentale indagare il tema delle tecniche culturali e della trasmissione della cultura2 . Senza la trasformazione dell’egemonico sapere orale delle gentes nella tradizione scritta degli strati sociali più alti e soprattutto della chiesa, in molti campi i processi di acculturazione non avrebbero avuto luogo, oppure non sarebbero stati duraturi3 . Questo vale naturalmente anche per gli antichi insediamenti vicino ai fiumi Inn, Isarco e Adige. Come ha efficacemente dimostrato Irmtraut Heitmeier sull’esempio di Inntal, val d’Isarco e Renon, località vicina a Bolzano, in tutte le fasi dell’epoca tardoantica e altomedievale, il territorio alpino tirolese si trovò, per la sua importante posizione di passaggio, al centro di traffici legati al potere e di rinnovamenti politico-strutturali4 . -

Il Rumantsch-Grischun Sco Favella Ncolatina
Il rumantsch-grischun sco favella ncolatina Autor(en): Schorta, Andrea Objekttyp: Article Zeitschrift: Annalas da la Societad Retorumantscha Band (Jahr): 72 (1959) PDF erstellt am: 03.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-224357 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch II rumantsch-grischun sco favella neolatina Andrea Schorta Undraivla raspada ladina, Ant ch'eu am sfuondra illa blerüra da dumandas ed ingiavi- neras chi's startuoglian intuorn il madal da meis pled dad hoz, al stögl eu dar clers terms e tischmuongias. Rumantsch-grischun ais il linguach chi vain discurri hoz illas vals renanas dal chantun Grischun, in Engiadina e Val Müstair. -

Zusammenfassung: Noricum Und Raetia I
Zusammenfassung: Noricum und Raetia I VON ERICH ZÖLLNER Die Tagung »Von der Spätantike zum Frühmittelalter. Aktuelle Probleme in histori scher und archäologischer Sicht« behandelte eine Thematik im Rahmen des Kontinui tätsproblems mit Hauptaugenmerk auf Siedlungs und Bevölkerungsgeschichte zunächst in zwei von vier regionalen Versuchsfeldern, nämlich in Noricum und in der Raetia I. Es galt dabei einige Gräben zu überbrücken. Da gibt es einmal die Epochengrenze zwi schen Altertum und Mittelalter, die in der traditionellen Ausbildung der Historiker sehr fühlbar ist man wendet sich entweder dem einen oder dem anderen Gebiet zu. Ähn lich steht es bisweilen bei den Archäologen, denn die Frühmittelalterarchäologie knüpft in der Regel mehr an urgeschichtliche Arbeitsweisen an als an jene der klassischen Ar chäologie. Es gibt ferner die Grenzen zwischen den beteiligten Disziplinen: der Ge schichte, der Archäologie (und ihren naturwissenschaftlichen Hilfswissenschaften), der Numismatik, Diplomatik, Philologie (etwa der Ortsnamenforschung) und der Siedlungs geographie (etwa der Flurformenkunde). Methodenschwindel und illegale Grenzübertrit te will der redliche Forscher vermeiden; er muß aber auch ohne jede Behinderung durch Scheuklappen die Ergebnisse der anderen Wissenschaften in Betracht ziehen. Die strate gische Maxime von Helmuth v. Moltke und Walter Schlesinger lautet bekanntlich: »Ge trennt marschieren vereint schlagen«; diesmal sind wir ein gutes Stück gemeinsam marschiert. Schließlich gibt es noch die Gräben zwischen den Nationen; zunächst der an den Ereignissen beteiligten gentes, vor allem aber der mit der Erforschung jener Ereig nisse beschäftigten Wissenschaftler. Es gab aber auf der Tagung keinen Nationalitätenha der. Das ist nicht selbstverständlich: Nationale Sympathien und Antipathien, Probleme der eigenen Zeit werden allzu leicht in die Vergangenheit projiziert. Auch bei gutem Willen wird Siedlungs und Bevölkerungsgeschichte nicht ganz sine ira et studio er forscht und gelehrt. -

Gertrude Ou Alphonse
UNIVERSITE DE NEUCHÂTEL Institut de Psychologie LES PROCESSUS DE NEGOCIATION AU MOMENT DU LANCEMENT DU PROJET POSCHIAVO Pascale Marro Avec la collaboration de S. Padiglia et S. Eichenberger Documents de travail du projet " Psychosocial Process of Learning Within Distance Education" No1 Sous la direction de A.-N. Perret-Clermont (requérante principale) « FNRS » 5004-4796 1 TABLE DES MATIERES 1. Introduction 2. Contexte géo-historique 2.1. Le canton des Grisons, un cas à part ? 2.2. Bref historique d’une latinité alpine. 2.3. Les Grisons de nos jours 2.3.1. La situation sociale aux Grisons 2.3.1.1.Le système politique 2.3.1.2.La situation économique 2.3.2. La situation linguistique 2.3.2.1. Le statut des langues 2.4. Les « valli » sud alpines du canton, problèmes contemporains. 2.4.1. la valle di Poschiavo 2.5. Identité et région 3. Qu’est-ce que le « Projet Poschiavo » ? 4. Les processus de négociation : une illustration, l’analyse de la première rencontre avec la population 4.1. Introduction 4.2. Une illustration : la première rencontre avec la population 4.1.1. Introduction 4.1.2. Problématique théorique 4.1.3. Description de la mise en scène et du déroulement de l’interaction 4.1.4. Méthodologie et outil d’analyse 4.1.5. Analyse du contenu 4.1.6. Statuts, rôles et places 4.1.7. Les items lexicaux 4.1.8. Les marqueurs d’identité 4.1.9. Réflexions générales 4.2.Transformation du projet initial 5. Conclusion : un modèle de transformation avec NTIC ancré dans une réalité communautaire 2 1.Introduction L’objectif de ce document est de décrire le contexte général dans lequel s’est ancré le « Projet Poschiavo », ainsi que sa transformation depuis le concept initial, jusqu’au dispositif tel qu’il a été appliqué concrètement. -
Codex Theodosianus: Historia De Un Texto the Figuerola Institute Programme: Legal History
CODEX THEODOSIANUS Historia de un texto José María Coma Fort Codex Theodosianus: historia de un texto The Figuerola Institute Programme: Legal History The Programme “Legal History” of the Figuerola Institute of Social Science History –a part of the Carlos III University of Madrid– is devoted to improve the overall knowledge on the history of law from different points of view –academically, culturally, socially, and institutionally– covering both ancient and modern eras. A number of experts from several countries have participated in the Programme, bringing in their specialized knowledge and dedication to the subject of their expertise. To give a better visibility of its activities, the Programme has published in its Book Series a number of monographs on the different aspects of its academic discipline. Publisher: Carlos III University of Madrid Book Series: Legal History Editorial Committee: Manuel Ángel Bermejo Castrillo, Universidad Carlos III de Madrid Catherine Fillon, Université Jean Moulin Lyon 3 Manuel Martínez Neira, Universidad Carlos III de Madrid Carlos Petit, Universidad de Huelva Cristina Vano, Università degli studi di Napoli Federico II More information at www.uc3m.es/legal_history Codex Theodosianus: historia de un texto José María Coma Fort UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 2014 Historia del derecho, 28 © 2014 José María Coma Fort Venta: Editorial Dykinson c/ Meléndez Valdés, 61 – 28015 Madrid Tlf. (+34) 91 544 28 46 E-mail: [email protected] http://www.dykinson.com Diseño: TALLERONCE Ilustración de cubierta: Fotografía realizada por María y Pablo Coma ISBN: 978-84-9085-106-7 ISSN: 2255-5137 Depósito Legal: M-25020-2014 Versión electrónica disponible en e-Archivo http://hdl.handle.net/10016/19297 Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España Herrn Professor Dr. -

Candidature UNESCO World Heritage | Rhaetian Railway in the Albula/Bernina Cultural Landscape |
Candidature UNESCO World Heritage | Rhaetian Railway in the Albula/Bernina Cultural Landscape | www.rhb-unesco.ch 2.b.2. From ancient to modern: state, society, economy and culture in the Albula / Bernina region The Albula/Bernina region shares the destiny of alpine Rhaetia. The entire region was incor- porated in the Roman Empire and christianised; later it fell to the emergent Germanic Em- pire. The feudalisation process led to the dominion of the Bishop of Chur. However, the com- munities soon became the most important political players: they joined forces in the Drei Bünden, the political predecessor of the Canton Graubünden. Under their auspices traffic flourished on the Albula/Bernina route from the late Middle Ages. In pre-modern times, the autonomy of the communities led to confessional schism in the Albula/Bernina region while maintaining trans-local solidarity. The social order presented a similar pattern: aristocratic families dominated the Drei Bünde, but they always had to seek their power base in several communities. Late antiquity: Christianisation also applies for the Albula/Bernina route. There The central alpine region was integrated in the are churches dedicated to St. Peter in Alvaschein Roman Empire relatively late. However, the in- (Mistail), Bergün/Bravuogn, Samedan and fluence of Roman civilisation was all the more Poschiavo. long-lasting. The alpine peoples, primarily the Rhaetians, developed into loyal custodians of the Early Middle Ages: Regionalisation Roman cultural heritage: Christianity and the After the collapse of the western Roman Empire Latin language. only the “Raetia Curiensis” or “Churrätien” – About 300 AD, Chur was promoted to the capi- significant elements of the provincial organisa- tal of the province “Raetia Prima” – the alpine tion – survived in Raetia Prima. -

Stefan Esders, Öffentliche Vorträge, 2004-2017
Univ.-Prof. Dr. Stefan Esders (Freie Universität Berlin) Öffentliche Vorträge 2004‒2017 1. Die römischen Wurzeln der fiskalischen inquisitio der Karolingerzeit “L’enquête au moyen âge”. Colloque international, École française de Rome, 29.-31. Januar 2004, Leitung: François Bougard, Jacques Chiffoleau, Claude Gauvard. 2. Politik und Ehezwang im anglonormannischen England Habilitationsvortrag Universität Bochum, 3. Februar 2004. 3. Die Auswirkungen der Karolingerherrschaft auf den Eigenkirchenbesitz von Führungsgruppen in Baiern „Les élites au moyen âge. Crise et renouvellement”. Colloque international, École française de Rome, 6.-8. Mai 2004, Leitung: François Bougard, Laurent Feller, Régine Le Jan. 4. Individuelle und gruppenbezogene Rechtsvorstellungen in der Konfliktwahrnehmung des frühen Mittelalters „Rechtsverständnis und Handlungsstrategien im mittelalterlichen Konfliktaustrag“. Internationales Symposion aus Anlass des 65. Geburtstages von Hanna Vollrath, Ruhr-Universität Bochum, 2.-5. Juni 2004, Leitung: Stefan Esders, Michael Oberweis, Christine Reinle, Dieter Scheler. 5. Zwangstaufen in Byzanz und im Westen: Überlegungen zur frühmittelalterlichen "Missions- und Bekehrungsgeschichte" Antrittsvorlesung, Ruhr-Universität Bochum, 11. Juni 2004. 6. Wurden im Merowingerreich zur Bekehrung von Heiden Zwangstaufen durchgeführt? „‘Christianisation‘ et transformations sociales aux marges de l’Occident chrétien“ / „‘Christianisierung‘ und Sozialwandel am Rande des christlichen Abendlandes“. Journée d’études, Mission historique française en Allemagne, Göttingen, 7. Juli 2004, Leitung: Philippe Depreux. 7. Das Karolingerreich als Handlungs- und Kommunikationsraum der fideles Dei et regis „Raum, Konflikt und Identität im früheren Mittelalter“. Sektion auf dem 45. Deutschen Historikertag, Universität Kiel, 15. September 2004, Leitung: Stefan Esders, Thomas Scharff. 8. Der Raumbezug frühmittelalterlicher Eliten nach den Rechtstexten: Überlegungen zu einem Spannungsverhältnis „Les élites et leurs espaces: mobilité, rayonnement, domination (VI e–XI e siècle)“. -

Mortem Et Gloriam Army Lists Use the Army Lists to Create Your Own Customised Armies Using the Mortem Et Gloriam Army Builder
Army Lists Frankia Contents Tolosan Visigoth 419 to 621 CE Gallia Aquitania 628 to 632 CE Early Merovingian Frank 485 to 561 CE Charles Martel Frank 718 to 741 CE Burgundian 496 to 613 CE Astur-Leonese 718 to 1037 CE Provencal 496 to 639 CE Carolingian 741 to 888 CE Swabian Duchies 539 to 744 CE Charlemagne Carolingian 768 to 814 CE Austrasia 562 to 639 CE Early Navarrese 778 to 1035 CE Neustria 562 to 639 CE East Frankish 888 to 933 CE Breton 580 to 1072 CE Early Medieval French 888 to 1045 CE Later Merovingian Frank 613 to 717 CE Norman 911 to 1071 CE Later Visigoth 622 to 720 CE Early Holy Roman Empire 933 to 1105 CE Version 2020.01: 1st January 2020 © Simon Hall Creating an army with the Mortem et Gloriam Army Lists Use the army lists to create your own customised armies using the Mortem et Gloriam Army Builder. There are few general rules to follow: 1. An army must have at least 2 generals and can have no more than 4. 2. You must take at least the minimum of any troops noted and may not go beyond the maximum of any. 3. No army may have more than two generals who are Talented or better. 4. Unless specified otherwise, all elements in a UG must be classified identically. Unless specified otherwise, if an optional characteristic is taken, it must be taken by all the elements in the UG for which that optional characteristic is available. 5. Any UGs can be downgraded by one quality grade and/or by one shooting skill representing less strong, tired or understrength troops.