Ballonfieber Und „Ärostatische Wuth“ Im Wien(N)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Lives in Engineering
LIVES IN ENGINEERING John Scales Avery January 19, 2020 2 Contents 1 ENGINEERING IN THE ANCIENT WORLD 9 1.1 Megalithic structures in prehistoric Europe . .9 1.2 Imhotep and the pyramid builders . 15 1.3 The great wall of China . 21 1.4 The Americas . 25 1.5 Angkor Wat . 31 1.6 Roman engineering . 38 2 LEONARDO AS AN ENGINEER 41 2.1 The life of Leonardo da Vinci . 41 2.2 Some of Leonardo's engineering drawings . 49 3 THE INVENTION OF PRINTING 67 3.1 China . 67 3.2 Islamic civilization and printing . 69 3.3 Gutenberg . 74 3.4 The Enlightenment . 77 3.5 Universal education . 89 4 THE INDUSTRIAL REVOLUTION 93 4.1 Development of the steam engine . 93 4.2 Working conditions . 99 4.3 The slow acceptance of birth control in England . 102 4.4 The Industrial Revolution . 106 4.5 Technical change . 107 4.6 The Lunar Society . 111 4.7 Adam Smith . 113 4.8 Colonialism . 119 4.9 Trade Unions and minimum wage laws . 120 4.10 Rising standards of living . 125 4.11 Robber barons and philanthropists . 128 3 4 CONTENTS 5 CANALS, RAILROADS, BRIDGES AND TUNNELS 139 5.1 Canals . 139 5.2 Isambard Kingdon Brunel . 146 5.3 Some famous bridges . 150 5.4 The US Transcontinental Railway . 156 5.5 The Trans-Siberian railway . 158 5.6 The Channel Tunnel . 162 6 TELEGRAPH, RADIO AND TELEPHONE 171 6.1 A revolution in communication . 171 6.2 Ørsted, Amp`ereand Faraday . 174 6.3 Electromagnetic waves: Maxwell and Hertz . -

Katalog Herbst 2018 Buch & Kunst Antiquariat
Peter Bierl Antiquariatskatalog Herbst 2018 Buch & Kunst Antiquariat Schwabinger Bilderbogen SB Antiquariat FRANZISKA BIERL Katalog 178 ANTIQUARIAT Interessante Neueingänge Bücher & Graphik sowie 50 Zeichnungen & Aquarelle, vor allem des 19. Jahrhunderts Nr. 435 - Algier - Herrlich zeitgenössisch kolorierter Kupferstich Besuchen Sie uns im Internetrnet www.bierl-antiquariat.dee Über 65.000 alte Originalstichestiche und wertvolle Bücher Nr. 3 - Eines der schönsten deutschen Holzschnittbücher der Renaissance in der Erstausgabe Francesco Petrarca - »Von der Artzney bayder Glück« - Sammelband mit zwei Anhängen und insgesamt 488 Holzschnitten des Petrarcameisters Hans Weiditz Einband Doppelseite Nr. 465 - Jerusalem - Kapitalblatt von Eberhard Emminger in zeitgenössischem Kolorit Nr. 421 - Weimarer Schloß - Große, altkolorierte Umrißradierung nach Carl Ludwig Kaaz Nr. 217 - Freising - Kupferstich nach Jean Claude Sarron - Die wohl schönste Ansicht Freisings aus dem 18. Jahrhundert 3 Wissenswertes über uns Angebote, Leistungen, Service Nr. 517 - Sarntaler Trachten - Altkolorierte Umrißradierung von J.G. Schedler Nr. 805 - König Maximilan II. von Bayern - Altkolorierte Lithographie von Gustav Kraus Nr. 474 - Kreta - Altkolorierter Kupferstich von G. Mercator Amalienstraße 65, 80799 München Telefon 089 - 24 29 01 62 Fax 089 - 87 76 48 03 Suchen und fi nden im Internet. Bestellung zu allen Zeiten [email protected] Auf unseren Internetseiten fi nden Sie Telefon 08179-8282, www.antiquariat-franziska-bierl.de neben Informationen über das Anti- Montag bis Freitag quariat eine Aufstellung aller gültigen von 9 bis 17.30 Uhr, Kataloge, die Sie bequem herunterla- Samstag von 9 bis 12 Uhr. den können. Ferner fi nden Sie ausführ- Zu den übrigen Zeiten zeichnet unser Peter Bierl liche Erklärungen zu den »Graphischen Anrufbeantworter Ihre Wünsche auf. -
Vdpnachrichten Abhebenabheben Mitmit Charmecharme Undund Gefühlgefühl
Vereinigung Deutscher Pilotinnen e.V. Im Deutschen Aeroclub e.V · Mitglied bei AOPA Germany Member of the Federation of European Women Pilots VDPNachrichten AbhebenAbheben mitmit CharmeCharme undund GefühlGefühl Birgit Gräfin Stenbock-Fermor (VDP-Mitglied), ist eine der wenigen Frauen in Deutschland mit den Lizenzen für CPL & CHPL. Foto: Jochen Schmadtke, Hamburg Themen VDP-Jahreshaupt- Der Weg zur Vierte Wilhelmine versammlung Hubschrauberpilotin Reichard-Gedächt- Ausgabe Seite 6-7 Seite 12-14 nisfahrt in Freital Seite 16-18 1 www.pilotinnen.de 2004 INHALT EDITORIAL von Heidi Galland Seite 3 EINLADUNG zum Fly-In am Chieemsee, Motto „Natur“, 11. bis 13. Juni 2004 Seite 4 VERANSTALTUNGEN IN HODENHAGEN-EDVH für die Vereinigung Deutscher Pilotinnen e. V. Seite 5 36. JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG DER VDP Grusswort Seite 6 Programm Seite 7 PORTRAIT Claudia Jungschmidt Seite 8 Mag. Bärbel Kuchler Seite 9 ANMELDUNG zur 36. VDP – Jahreshauptversammlung 10. – 12. September 2004 in Friedrichshafen Seite 10 MITGLIEDERBERICHTE Fliegen ist Schöner! Seite 11 Der Weg zur Hubschrauberpilotin Seite 12-14 Oshkosh 2003 Seite 15 Vierte Wilhelmine-Reichard-Gedächtnisfahrt Seite 16-18 21. Treffen der Luftsportlerinnen des Baden-Württembergischen Luftfahrtverbandes Seite 19 Segelfliegerinnentreffen 2004 in Dortmund – „Hexen im Pott“ Seite 20-21 10–JÄHRIGES JUBILÄUM der Österreichischen Akademie für Flugmedizin in Zürs am Arlberg Seite 22 MADLENE’S WINTERSPAß Pilotinnen – Gaudi in Lenggries Seite 23-24 KONDENSSTREIFEN Madlene Clausen berichtet Seite 25-27 HISTORISCHES Nur eine Handvoll Wind unter den Flügeln - Deutsche Pilotinnen und kommerzielle Luftfahrt vor 1945 (Teil 1: Bis 1933) Seite 28-30 VDP-INTERN Ehrenmitglied Elly Beinhorn 97. Geburtstag! Seite 31 Trauer um Elke Röpke Seite 32 MITGLIEDER-ANTRÄGE Für alle, die es werden wollen Seite 33-34 TERMINE und Veranstaltungen Seite 35 Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 1. -

Der Aachener Kongress
I Vom Aachener Kongreß 1818 zu den Karlbader Beschlüssen Diese Datei enthält im Anhang eine Bearbeitung der Schrift: Karl Franz Meyer, Aachen, Der Monarchen-Kongreß im Jahr 1818 aus der Sammlung Peter Packbier Wenn auch der Schreibstil des Verfassers auf den heutigen Leser ─ gelinde gesagt ─ befremdlich wirkt, ist die Arbeit doch ein interessantes Zeit dokument. Allerdings ist mehr der äußere Ablauf des Kongresses Gegenstand dieser Schrift. Den Anhang und die Karte habe ich hier nicht aufgeführt, sie können in der oben angezeigten Quelle eingesehen werden. Zu diesem Text die Dateien Allgemeine Deutsche Biographie: Meyer, Karl Franz Wikipedia-Datei: Carl Franz Meyer Der Aachener Kongress (dazu auch eine Private Internet-Seite zum Kongress von Aachen) war erst der Beginn einer Reihe von vier Monarchenkongressen nach dem Wiener Kongress. Zu seiner Vorgeschichte gehörte natürlich zunächst der Wiener Kongress. Dort hatten nach dem endgültigen Sieg über Napoleon die Monarchen Zar Alexander I. von Rußland, Kaiser Franz II. von Österreich und König Friedrich Wilhelm III. von Preußen am 26. September 1815 die Heilige Allianz beschlossen. Vor allem Zar Alexander hoffte durch eine derartige Allianz, welche auch für weitere Staaten geöffnet werden sollte, den Frieden der Welt auf einer von den seitherigen politischen Bündnissen weit abweichenden Grundlage zu stellen. Kurz darauf, am 20. November 1815, wurde die Heilige Allianz durch die von dem englischen Staatsmann Castlereagh initiierte Große Allianz ergänzt, welche sich auf den Vertrag von Chaumont stützte. Nach Artikel VI des Allianz-Vertrages vom 20.11.1815 waren periodische „Réunions“ oder „Conferencen“ der Monarchen und Kabinette der Vierbund-Staaten vorgesehen. Die erste dieser Conferenzen wurde dann II auf Vorschlag des in diesem ganzen Geschehen wohl gewichtigsten Staatsmannes in diesem Zusammenhang, Fürst von Metternich, vom 27. -
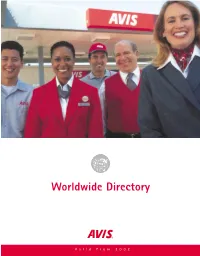
Worldwide Directory
Worldwide Directory Valid from 2002 WELCOME TO WORLDWIDE AVIS From the top of the world to its southernmost settlements, Avis keeps ‘trying harder’ to provide customers with the popular, low-mileage vehicles and excellent service they expect and deserve. Each year, millions of business travelers and vacationers turn to Avis for quality and value in car rentals. They know they can count on Avis. This directory is a guide to our rental locations throughout the world. Countries are divided into eight regions. To help you quickly locate the listing you need, we have incorporated an alphabetical list of countries. Keep your directory close at hand. It’s a valuable reference source on Avis around the world. If the information you require is not listed, please call the Avis reservations office located at the beginning of the country listing, or call the nearest Avis rental office. BOOKING RESERVATIONS Avis Worldwide Reservation Center (WRC) P.O. Box 690360, Tulsa, Oklahoma 74169-0360 Administration Office Tel. # 918-664-9600 IF YOU ARE IN: CONTACT: THE UNITED STATES For Local Reservations ........................... Your Nearest Avis Location For Reservations in the U.S.A. .....................................1-800-331-1212 For International Reservations ......................................1-800-331-1084 Calling From Hawaii or Alaska .....................................1-800-331-1212 Calling in Alaska for Alaska ......................The Nearest Avis Location For the Hearing Impaired .............................................1-800-331-2323 -

European Defence Industry Associations 2016 Catalogue Foreword
European Defence Industry Associations 2016 Catalogue Foreword In the area of Market & Industry the EDA promotes the efficiency and competitiveness of the European Defence Countries: Equipment Market (EDEM), strengthening of the European Defence Technological and Industrial Base (EDTIB), and supports government and industrial stakeholders in adapting into the EU regulatory environment. Austria Belgium Further to the development of actions and activities to support its Member States (shareholders), EDA has taken action Bulgaria in favour of the industry. Through different workstrands, EDA has developed a set of activities and tools to support the Croatia industry by addressing either supply chain related issues or the specificities of the SMEs. Those activities aim at Cyprus facilitating the access to EU fundings, the support to Innovation, the access to the European Defence supply Chain and Czech Republic the access to business opportunities. Estonia Finland France Those activities could only be thought through and implemented without a comprehensive knowledge and Germany understanding of the Defence Supply Chain in Europe. This EDTIB is made of companies that are so numerous and Greece diverse that EDA had to rely on groupings of those companies to better understand them. The Defence Industry Hungary Associations at national and European level are a set of groupings that became one of the main interlocutors of EDA. Ireland Italy This catalogue regroups at the time of its making, the national and European Defence Industry associations and their Latvia members and is a good information tool to start exploring for new potential partnerships. The web based tool will be Lithuania available soon. Luxembourg Malta Netherlands Norway Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia © The European Defence Agency (EDA) 2016. -
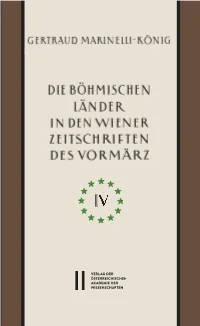
334585308.Pdf
Das Wiener Vormärz-Slavica-Projekt hat sich die Auswertung von Materialien aus Unterhaltungsblättern und gelehrten Zeitschriften, welche in Wien in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts erschienen sind, zur Aufgabe gestellt. Dies erfolgt in Form einer nach Themenbereichen gegliederten kritischen Bestands aufnahme. Der fünfte Band der Reihe (IV Teile + Registerband) erfasst das Material zu den böhmischen Ländern und deren kulturelle Verbindung mit Wien. Der vorlie- gende Teil IV erschließt die Themenbereiche „Religion“, „Recht“ „Landeskunde“, „Politische Ökonomie“, „Naturwissenschaften und Mathematik“. „Die Gesamtstaatsidee war freilich nicht nur ein imaginärer ‚habsburgischer Mythos‘ (Claudio Magris), sondern gleichermaßen auch ein wohldurchdachtes realpoliti- sches Instrumentarium gegenüber den Phänomenen von akzellerierten zentrifugalen subregionalen, d. h. nationalen Ausdifferenzierungstendenzen, Phänomenen also, die für das ‚lange neunzehnte Jahrhundert‘ kennzeichnend waren und bis in das 20. Jahrhundert andauern sollten.“ „Kultur insgesamt kann als eine von ‚Grenzen‘ durchzogene ‚Semiosphäre‘ (Jurij Lotman) begriffen werden. Solche Grenzen wurden im Vormärz auch in Böhmen wahrgenommen, jedoch nicht als unüberbrückbar empfunden.“ Aus: Moritz Csáky, Vorwort zu BÖHMEN III (2014) „Es ist ein bedeutender Erkenntnisgewinn dieser Edition, wie trotz kultureller Überlappungen und Verschränkungen im Königreich Böhmen (…) Differenzen ver- festigt wurden. Dennoch gilt es auch festzuhalten und zu betonen – und auch das ver- mittelt die vorliegende -

Airbus-Approved-Suppliers-List.Pdf
AIRBUS APPROVAL SUPPLIERS LIST 01 September 2021 AIRBUS APPROVAL SUPPLIERS LIST 01 September 2021 Country CAGE / Company Name code Street City Region Product Group 276086 2MATECH # 19 AVENUE BLAISE PASCAL AUBIERE France AFM-003-4 TEST LAB 305864 3A COMPOSITES GMBH # ALUSINGENPLATZ 1 SINGEN Germany AFM-002-2 MATERIAL PART MANUFACTURING 299679 3D ICOM GMBH & CO KG D3402 GEORG-HEYKEN-STR. 6 HAMBURG Germany AFM-001-2 AEROSTRUCTURE BUILD TO PRINT 309633 3D ICOM GMBH & CO KG # ZUM FLIEGERHORST 11 GROSSENHAIN Germany AFM-001-2 AEROSTRUCTURE BUILD TO PRINT 271379 3M ASD DIVISON PLANT # 801 NO MARQUETTE PRAIRIE DU CHIEN USA AFM-002-2 MATERIAL PART MANUFACTURING 285419 3M CO 8M369 610 N COUNTY RD 19 ABERDEEN USA AFM-002-2 MATERIAL PART MANUFACTURING 133367 3M COMPANY 6A670 3211 EAST CHESTNUT EXPRESS WAY SPRINGFIELD USA AFM-002-2 MATERIAL PART MANUFACTURING 305720 3M COMPANY 68293 2120 E AUSTIN BLVD NEVADA USA AFM-002-2 MATERIAL PART MANUFACTURING 133370 3M DEUTSCHLAND GMBH DL851 DUESSELDORFER STR. 121-125 HILDEN Germany AFM-002-2 MATERIAL PART MANUFACTURING 230295 3M DEUTSCHLAND GMBH D2607 CARL SCHURZ STR. 1 NEUSS Germany AFM-002-1 MATERIAL DISTRIBUTION 133374 3M ESPANA SL 0211B CL JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 19-25 MADRID Spain AFM-002-2 MATERIAL PART MANUFACTURING 311744 3M FAIRMONT 5K231 710 N STATE STREET FAIRMONT USA AFM-002-2 MATERIAL PART MANUFACTURING 133379 3M FRANCE F0347 ROUTE DE SANCOURT TILLOY LEZ CAMBRAI France AFM-002-2 MATERIAL PART MANUFACTURING 308272 3M FRANCE # AVENUE BOULE BEAUCHAMP France AFM-003-4 TEST LAB 133376 3M FRANCE SA -

Ipad and Iphone Game 'Dawindci' Released in Honour
iPad and iPhone game ‘daWindci’ released in honour of 200th anniversary of female balloonist Nothing but hot air: The video game “daWindci” brings back the exciting times of aviation and aeronautics. As a pilot of a homemade hot-air balloon you’re navigating around sharp cliffs, into amazing wind tunnels and dangerous electric fields – and see a lot of incredible inventions! The critically acclaimed title is available for iPhone, iPad and iPod touch – right on schedule with the 200th anniversary of Wilhelmine Reichard, Germany’s first female balloonist! Munich, April 2011 2011 is the official year of Wilhelmine Reichard in Germany. On April 16th 1811, the 23 years old was the first woman in Germany to fly with a gas balloon. The press was thrilled: A sensation was born! This year, it’s the 200th anniversary of this important event, which was history-charging for both the aviation business as well as gender equality. The German Aerospace Center (DLR) is launching a Reichard-Initiative to acknowledge her merits. Her earnings are underestimated, says Joachim Block, director of the DLR-quarter in Braunschweig.. „To change this, we dedicated our video game to this first female balloonist“, explains Dominik Abé. He’s a student at the Munich University of Mediadesign and one of the creators of the unique balloon-game. Right for the celebration on April 16th 2011, the game is released on iPad, iPhone and iPod touch in the AppStore. The release is accompanied by several big events in Germany – in Berlin on April 14th and Braunschweig on April 16th, just to name the largest.