PDF Download
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Programmaschema Npo Radio 4
PROGRAMMASCHEMA NPO RADIO 4 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 De Nacht Voor de Dag De Ochtend van 4 De Klassieken De Muziekfabriek Maatwerk Podium Passaggio Avondconcert Opium Margriet Carine Lacor, Hans Haffmans, Dieuwertje Wouter Pleijsier, Beitske Ab Nieuwdorp Sander Zwiep MAANDAG Vroomans Sander Zwiep e.a. Blok de Jong AVROTROS KRO-NCRV KRO-NCRV AVROTROS AVROTROS MAX NTR KRO-NCRV NTR AVROTROS De Nacht Voor de Dag De Ochtend van 4 De Klassieken De Muziekfabriek Maatwerk Podium Passaggio Avondconcert Opium Margriet Carine Lacor, Hans Haffmans, Dieuwertje Wouter Pleijsier, Beitske Ab Nieuwdorp Sander Zwiep DINSDAG Vroomans Sander Zwiep e.a. Blok de Jong AVROTROS KRO-NCRV KRO-NCRV AVROTROS AVROTROS MAX NTR KRO-NCRV NTR AVROTROS De Nacht Voor de Dag De Ochtend van 4 De Klassieken De Muziekfabriek Maatwerk Podium Passaggio Avondconcert Opium Margriet Carine Lacor, Hans Haffmans, Dieuwertje Wouter Pleijsier, Beitske Ab Nieuwdorp Sander Zwiep WOENSDAG Vroomans Sander Zwiep e.a. Blok de Jong AVROTROS KRO-NCRV KRO-NCRV AVROTROS AVROTROS MAX NTR KRO-NCRV NTR AVROTROS De Nacht Voor de Dag De Ochtend van 4 De Klassieken De Muziekfabriek Maatwerk Podium Passaggio Avondconcert Opium Margriet Carine Lacor, Hans Haffmans, Dieuwertje Wouter Pleijsier, Beitske Ab Nieuwdorp Sander Zwiep DONDERDAG Vroomans Sander Zwiep e.a. Blok de Jong AVROTROS KRO-NCRV KRO-NCRV AVROTROS AVROTROS MAX NTR KRO-NCRV NTR AVROTROS De Nacht Voor de Dag De Ochtend van 4 De Klassieken De Muziekfabriek Maatwerk Podium Passaggio Vrijdagavondconcert Opium Margriet Carine Lacor, Hans Haffmans, Dieuwertje Ab Nieuwdorp Sander Zwiep Hans van den Boom VRIJDAG Vroomans Sander Zwiep e.a. -
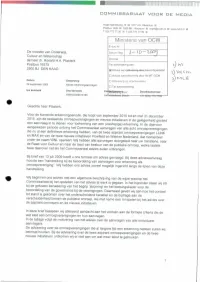
Inkomend Gescand Document 1-10-2009
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA Hoge Naarderweg 78 HUI 1217 AH Hilversum HUI Postbus 1426 HUI 1200 BK Hilversum HUI [email protected] HUI www.cvdm.nl T 035 773 77 00 Ulli F 035 773 77 99 Hill Ministerie van OCW E-doc Nr. De minister van Onderwijs, Datum Reg l-IQ-loo^ Cultuur en Wetenschap de heer dr. Ronald H.A. Plasterk Directie Postbus 16375 Ter behandeling aan: 2500 BJ DEN HAAG B'Advies aan/jildoening dmot bewindspersoon D Advies aan/afdoening door lid MT-OCW Datum Onderwerp D Afdoening op directieniveau 29 september 2009 Advies erkenningaanvragen G Ter kennisneming Uw kenmerk Ons kenmerk Col fcfttóSfilftpOoor; Doorkiesnummer 18895/2009014195 JariVoccolmon Boseh i 31 (005) 773 TT09 Geachte heer Plasterk, Voor de komende erkenningperiode, die loopt van september 2010 tot en met 31 december 2015, zijn de bestaande omroepverenigingen en nieuwe initiatieven in de gelegenheid gesteld een aanvraag in te dienen voor toekenning van een (voorlopige) erkenning. In de daarvoor aangewezen periode ontving het Commissariaat aanvragen van alle acht omroepverenigingen die nu al een definitieve erkenning hebben, van de twee aspirant omroepverenigingen LLiNK en MAX en van de twee nieuwe initiatieven PowNed en Wakker Nederland, dat momenteel onder de naam WNL opereert. Wij hebben alle aanvragen doorgeleid naar uw ministerie, naar de Raad voor Cultuur en naar de raad van bestuur van de publieke omroep, welke laatste twee daarover net als het Commissariaat advies zullen uitbrengen. Bij brief van 13 juli 2009 heeft u ons formeel om advies gevraagd. Bij deze adviesaanvraag hoorde een "handreiking bij de beoordeling van aanvragen voor erkenning als omroepvereniging". -

Curaçao Uitvalsbasis Hulp Van Onze Redactie Coördinatiecentrum Voor Nederlandse, Franse En Britse Bijstand Gaat Duren
Jaargang 14 nr. 241 - NAf 1,50/US$ 0,85 incl. OB Dinsdag 19 september 2017 Cft: Begroting 2 Focus op 4 Rojer steunt 10 Algenkwekerij 17 EU onderzoekt 24 2018 helder wederopbouw Davis Cup op Aruba datadeal VS Curaçao uitvalsbasis hulp Van onze redactie Coördinatiecentrum voor Nederlandse, Franse en Britse bijstand gaat duren. Koenders pleit Willemstad - Neder- voor een radicaal andere land, Frankrijk en het Staten. Het centrum len benodigd voor trans- met de Franse autoriteiten gers van de Caribische ei- aanpak en wil orkaan Irma wordt gevestigd op de ma- port, waaronder vliegtui- op Sint Maarten. ,,Tussen landen. Die ontmoeting aangrijpen om de eilan- Verenigd Koninkrijk rinebasis Parera in Wil- gen, zo efficiënt mogelijk het Franse en Nederland- stond grotendeels in het den klimaatbestendig te hebben rond de lemstad. in te zetten.” se gedeelte zijn de relaties teken van noodhulp aan maken. Algemene Vergade- ,,Ik weet van de plannen Minister Bert Koenders wel goed, maar historisch de getroffen eilanden. De ,,Als we nu niet helpen ring van de Verenigde om een dergelijk centrum van Buitenlandse Zaken is daar een beetje span- Verenigde Naties hebben de eilanden anders op te Naties (VN) in New bij mij op de basis in te (PvdA) noemt het coördi- ning tussen geweest, ook 12 miljoen dollar aan bouwen, dan gaat het bij York besloten om een richten”, zegt Comman- natiecentrum een belang- omdat ze verschillend noodhulp toegezegd en de volgende orkaan alle- dant der Zeemacht Cari- rijke stap. ,,Je kan wel van worden geregeerd. We VN-medewerkers zijn in- maal weer plat. Dat is niet coördinatiecentrum bisch gebied Peter Jan de alles afspreken op het ni- hebben hier afgesproken middels op Sint Maarten nodig.” In dat kader heeft op te richten op Vin tegen het Antilliaans veau van regeringsleiders om de samenwerking te gearriveerd om de schade hij gesproken met de Curaçao. -

NPO-Fonds Presentatie Cijfers 2018
CIJFERS 2018 Gebaseerd op 1 jaar feitelijke gegevens NPO-fonds (met uitzondering van de diverse talentontwikkelingstrajecten) !1 ALGEMEEN 2018 !2 Hoeveel aanvragen zijn er in totaal bij het NPO-fonds ingediend en toegekend? 2018 !3 TOTAAL INGEDIENDE AANVRAGEN Ontwikkeling Productie Totaal 160 153 140 120 100 89 81 80 72 60 47 40 42 40 30 24 15 20 10 9 0 Video drama Video documentaire Audio Totaal 2018 !4 TOTAAL TOEGEKENDE AANVRAGEN Ontwikkeling Productie Totaal 100 91 90 80 70 56 60 51 50 40 40 28 28 30 22 17 20 13 7 10 5 6 0 Video drama Video documentaire Audio Totaal 2018 !5 TOTAAL SLAGINGS% Ontwikkeling Productie Totaal 100% 80% 67% 67% 63% 63% 60% 59% 60% 57% 55% 54% 50% 52% 47% 40% 20% 0% Video drama Video documentaire Audio Totaal 2018 !6 Hoe is de verhouding tussen indieningen en toekenningen per omroep? 2018 !7 TOTAAL INGEDIEND PER OMROEP Ontwikkeling Productie Totaal 40 34 34 35 30 25 26 25 19 18 20 15 16 16 15 13 15 12 11 9 9 10 7 8 5 4 4 4 5 1 0 1 0 EO MAX NTR VPRO HUMAN BNNVARA AVROTROS KRO-NCRV 2018 !8 TOTAAL TOEGEKEND PER OMROEP Ontwikkeling Productie Totaal 25 20 19 20 18 18 15 13 9 10 10 9 9 10 7 8 7 5 6 5 3 3 5 2 1 0 0 0 0 EO MAX NTR VPRO HUMAN BNNVARA AVROTROS KRO-NCRV 2018 !9 2018 59% 52% 63% 69% Gemiddeld 60% 82% VPRO 80% 78% 81% NTR Totaal 0% 0% MAX 53% 50% Productie 56% !10 54% KRO-NCRV 50% OMROEP 56% HUMAN 56% Ontwikkeling 53% EO 60% 38% 75% TOTAAL SLAGINGS% PER 0% 50% BNNVARA 20% 71% AVROTROS 0% 20% 10% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Hoeveel geld is er in totaal toegekend? 2018 !11 2018 € 15.978.099 € 8.927.107 € 7.251.100 -
Bnn-Vara Jaarrekening 2014 2 3
1 BNN-VARA JAARREKENING 2014 2 3 INHOUDSOPGAVE MODEL PAG. Bedrijfsgegevens 4 Verslag van het bestuur 6 Balans per 31-12-2014 I 12 Categoriale exploitatierekening 2014 III 14 Kasstroomoverzicht 2014 II 15 Algemene toelichting 16 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 18 Toelichting op de balans per 31-12-2014 22 Toelichting op de exploitatierekening over 2014 IV 31 Overige gegevens 33 Verantwoording WNT 34 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant bij de jaarrekening 38 4 5 BEDRIJFSGEGEVENS RAAD VAN TOEZICHT Omroepvereniging BNN-VARA B.V. is op 11 september De Raad van Toezicht van Omroepvereniging BNN-VARA is per 2013 opgericht met als doel om hier per 1 januari 2014 de 31-12-2014 als volgt samengesteld: gezamenlijke omroepactiviteiten van Vereniging BNN en mevrouw W.E.L. van Kerkvoorden (voorzitter) Omroepvereniging VARA in onder te brengen. Tot en met 31 mevrouw G.J.J. Prins december 2013 hebben er binnen de omroepvereniging BNN- mevrouw S.E. Harmsen-Kuhl VARA B.V. geen activiteiten plaatsgevonden. Op 6 november de heer R.A. Koole 2013 zijn alle activa en passiva van VARA en BNN, onder de heer F.I.M. Houterman algemene titel, overgegaan (afgesplitst) van Omroepvereniging VARA naar de daarbij opgerichte BV VARA respectievelijk RESULTAATBESTEMMING 2014 van Omroepvereniging BNN naar een daarbij opgerichte BV De winst over 2014 bedraagt voor de BNN. Deze omroep BV’s zijn vervolgens op 1 januari 2014 omroepactiviteiten € 3.428 K. “weggefuseerd” in een door BNN en VARA gezamenlijk daartoe opgerichte tijdelijke fusie BV, de BV BNN-VARA. Direct na De winst over 2014 bedraagt voor de de fusie van de omroep BV’s en de fusie BV, dus op 1 januari verenigingsactiviteiten € 716 K. -

Paris, 6-7 June Who's Who
Paris, 6-7 June Who's who Yassmin Abdel-Magied Mechanical engineer, Social advocate, Writer, Petrol Head, 2015 Queensland Young Australian of the Year . Ms. Abdel-Magied is a mechanical engineer, social advocate, writer and 'petrol head'. Debut author at 24 with the coming-of-age-memoir, Yassmin¶s Story, the 2015 Queensland Young Australian of the Year advocates for the empowerment of youth, women and those from racially, culturally and linguistically diverse backgrounds. Ms. Abdel-Magied is passionate about making 'diversity' the norm. At age 16, she founded Youth Without Borders, an organisation that empowers young people to realise their full potential through collaborative, community based programs. She was named one of Australia¶s most influential engineers by Engineers Australia, and has been recognised for her work in diversity by the United Kingdom¶s Institute of Mechanical Engineers. The youngest woman named in Australia¶s 100 Women of Influence by the Australian Financial Review in 2012, Ms. Abdel-Magied was the Young Muslim of the Year in 2007 and Muslim Youth of the Year in 2015. A sought-after advisor for federal governments and international bodies, she currently sits on the Boards of ChildFund, The Council for Australian-Arab Relations (CAAR) and the domestic violence prevention organisation, OurWatch. She is the Gender Ambassador for the Inter-American Development Bank and has represented Australia through multiple diplomatic programs across the globe. You can also find Ms. Abdel-Magied presenting on TV, currently hosting ABC's weekly show, Australia Wide. She is a regular on Q&A, The Drum, The Project, and internationally on the BBC. -

Jarin Van Oort
Curriculum Vitae - Jarin van Oort Persoonlijke gegevens: Volledige naam en titel: ing. Jasper Christiaan (Jarin) van Oort Adres: Smidsgilde 21, 3994 BG Houten Telefoonnummer: 06-16408076 E-mail: [email protected] LinkedIn profiel: linkedin.com/in/jarin Geboortedatum: 26 november 1976 Professionele werkervaring: 2011 – heden: Leading Projects (Houten) Zelfstandig Projectmanager in ICT / Multimedia • 18 jaar achtergrond in Telecom/Broadcasting (HTS Telematica, KPN, Imtech, EO, Solcon, NPO, AVROTROS, BVN TV, KRO-NCRV, e.a.) en Universiteit Leiden • Ervaren in specialistische ICT-projecten: Streaming Video, IPTV, Multimedia, Telecom en Infrastructuur, 24/7 realtime omgevingen Recente opdrachtgevers: § KRO-NCRV (National Broadcaster) 2017 Sr. Projectmanager&Consultant Vernieuwing externe netwerk-infrastructuur KRO-NCRV (firewalls, glasvezel- infrastructuur TV / Radio / Data); Verbeteronderzoek Videomontage-workflow; Coaching teamleiders (Agile, projectleiding); Sparring partner t.b.v. ICT-manager Marktoriëntaties (Ericsson, NEP, KPN, etc.), Programma van Eisen, Aanbesteding, Implementatie § Universiteit Leiden 2014-2016 Sr. Projectmanager&Consultant Aanbesteding en implementatie Cloud Video Platform t.b.v. 30.000 users; Integratie in Blackboard (SSO); Publieke portal (video.leidenuniv.nl); SAML-integratie campus Identity Management; Migratie video content; Opstart supportorganisatie Programma van Eisen; Aanbesteding; Pilots; Leveranciersmanagement; Stuurgroep; Supportproces § AVROTROS (National Broadcaster) 2015 Consultant Onderzoek -

Jaarverslag Vereniging Kro-Ncrv
JAARVERSLAG 2020 VERENIGING KRO-NCRV 1 Jaarverslag 2020 Inhoudsopgave Verslag van het bestuur bij de jaarrekening 2020 5 Verslag van de Raad van Toezicht 35 Jaarrekening 2020 43 Balans per 31 december 2020 44 Exploitatierekening over 2020 46 Kasstroomoverzicht over 2020 4 7 Algemene toelichting op de jaarrekening 52 Toelichting op de balans per 31 december 2020 60 Toelichting op de exploitatierekening over 2020 69 Nadere toelichtingen - Model IV - Exploitatierekening 2020 per kostendrager 82 - Model VI - Nevenactiviteiten per cluster 84 - Model VII - Sponsorbijdragen en bijdragen van derden 86 - Model VIII - Bartering 90 - Model IX - Verantwoording kosten per platform en per domein 9 1 Overige gegevens 91 Controleverklaring 92 2 Jaarverslag 2020 Jaarverslag 2020 3 1 VERSLAG VAN HET BESTUUR BIJ DE JAARREKENING 2020 The PassionJaarverslag 2020 1.1. Inleiding: het jaar 2020 en grote (sport)evenementen doorgeschoven naar van Gehandicaptenzaken, een initiatief van KRO- 3D-audiotechnieken waardoor de insectenwereld Het programma BinnensteBuiten waarin KRO-NCRV 2021. Dit bood enerzijds mogelijkheden om extra NCRV, een akkoord gekomen tussen grote belan- op unieke wijze tot leven komt en door middel van op tv, online, met (3D)podcasts en zelfs met een programma’s te maken. Anderzijds heeft dit er ook genverenigingen en de politiek om meer inclusieve Augmented Reality de insecten levensgroot in huis eigen (online) festival actief oproept om de wereld toe geleid dat er weinig ruimte was om de voorge- speeltuinen te bouwen en hebben de vragen aan kunnen worden geprojecteerd. Maar ook met het en de natuur om ons heen te ontdekken en om nomen extra investeringen in nieuw media-aanbod de Minister geresulteerd in een gebarentolk bij de You-Tube-kanaal Spot On waarbij interactie en de duurzamer te leven, is een aansprekend voorbeeld te doen en ook voor andere nieuwe initiatieven die persconferenties over de coronacrisis. -
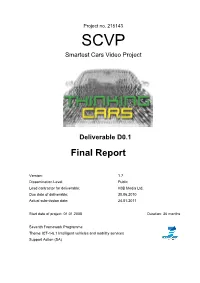
Final Report
Project no. 215143 SCVP Smartest Cars Video Project Deliverable D0.1 Final Report Version: 1.7 Dissemination Level: Public Lead contractor for deliverable: H3B Media Ltd. Due date of deliverable: 30.06.2010 Actual submission date: 24.01.2011 Start date of project: 01.01.2008 Duration: 36 months Seventh Framework Programme Theme ICT-1-6.1 Intelligent vehicles and mobility services Support Action (SA) SCVP 24.01.2011 Authors Richard Bishop, H3B Media Project Co-ordinator Mr. Luis Hill H3B Media Ltd phone +44 280 254 9406 e-mail [email protected] Partners H3B Media Ltd. Ian Catling Consultancy Copyright: SCVP Consortium 2008 Copyright on template: Irion Management Consulting GmbH 2008 Deliverable D01 1.7 ii SCVP 24.01.2011 Revision chart and history log Version Date Reason 1.0 06-24-10 First Draft (Bishop) 1.1 29-06-10 Comments / modifications (Hayward) 1.2 29-06-10 Bishop revisions based on Hayward 1.3 01-07-10 Bishop further revisions 1.4 01-07-10 Hayward further additions 1.5 14-07-10 Incorporation of RB comments 1.6 30-12-10 Update by Richard Bishop 1.7 24-01-11 Final check and additions M.Hayward Deliverable D01 1.7 iii SCVP 24.01.2011 Table of Contents Authors ...............................................................................................................................ii Project Co-ordinator............................................................................................................ii Partners ..............................................................................................................................ii -

CAO Voor Het Omroeppersoneel
CAO voor het omroeppersoneel 1 januari 2013 t/m 31 december 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Hoofdstuk 0 Rechten en plichten………………………………………… 3 Hoofdstuk 1 Indienstneming en ontslag…………………………….. 8 Hoofdstuk 2 Beloning………………………………………………………….. 15 Hoofdstuk 3 Arbeidsduur…………………………………………………….. 18 Hoofdstuk 4 Keuzemogelijkheden…………………………………….... 30 Hoofdstuk 5 Employability……………………………………………….…… 31 Hoofdstuk 6 Gezondheid en arbeidsongeschiktheid……….….. 34 Hoofdstuk 7 Werk en privé………………………………………………….. 36 Hoofdstuk 8 (Tijdelijk) Ouderdomspensioen………………………. 37 Hoofdstuk 9 Overige afspraken tussen partijen……………….… 39 Bijlage I. Definities…………………………………………………………. 43 Bijlage II. Partijen……………………………………………………………. 46 Bijlage III. Salaristabel…………………………………………………….. 48 Bijlage IV. Functieraster…………………………………………………… 49 Bijlage V. Mediawet artikelen 2.88 en 2.142…………………. 51 Bijlage VI. Vervallen………… 52 Bijlage VII. Voorschriften bij ziekte………………………………….. 53 Bijlage VIII. Uitgangspunten human resources beleid….….. 54 Bijlage IX. Reglement Beroepscommissie. Toetsingsprocedure functie-indelingen……….… 56 Bijlage X. Vervallen 59 Bijlage XI. ATW-bepalingen………………………………………….... 60 Bijlage XII. Arbeidsongeschiktheid vóór 1 januari 2004…. 69 Bijlage XIII. Reglement Vaste Commissie voor de CAO voor het Omroeppersoneel……………………………………….…… 72 Bijlage XIV Protocolafspraken …………….…… 74 Trefwoordenlijst………………………………………….….. 80 2 HOOFDSTUK 0 - RECHTEN EN PLICHTEN ARTIKEL 1: ALGEMEEN 1. Standaardkarakter van de CAO Het is de werkgever niet toegestaan in arbeidsovereenkomsten voorwaarden -

2010 Twitter: #PE10 #TVD01
TV DOCUMENTARY 01 Leuven Hulp At the beginning of 2009 a number of prisoners from the Leuven Help auxiliary prison in Leuven took part in a theatre workshop. The improvisations and rehearsals within the prison walls were filmed over a period of three months, culminating in a performance in front Belgium of an audience. For three months prisoners were filmed, often day and night - including in the cells, in which they were locked up 22 hours a day. The viewers are thus privileged witnesses of the day-to-day life of Entering organisation: Nico, Bogdan, Dilges, Christos, Peter, Antonio and Ali. They see Vlaamse Radio- en Televisieomroep - VRT them as they walk round the prison courtyard, as they go about the Contact: Franky Audenaerde tasks they are given to do and in their cells. They see them during Email: [email protected] the day, but also during the long nights. They observe their troubled relationship with the outside world, their often hopeless situations Author/s: and their survival strategies. Joeri Weyn, Yoohan Leyssens, Luc Haekens As a viewer you are constantly subjected to a conflict of feelings: on Directors: Joeri Weyn, Yoohan Leyssens, Luc Haekens the one hand you empathise with the person, on the other hand you Camera: Joeri Weyn & Yoohan Leyssens cannot avoid the reprehensible, often violent deeds of the criminal. Commissioning editor: Michel Vanhove Nico says to theatre-maker Thomas, ‘You often say ‘experienced’ but Email: [email protected] you should see it as ‘committed’. Dilges raps in his cell, ‘You know, Production company: Woestijnvis but you do it anyway, yo’. -
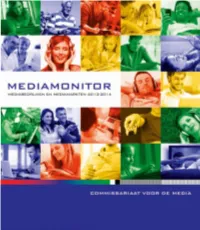
Blg-408114.Pdf
mediamonitor mediabedrijven en mediamarkten 2013-2014 © oktober 2014 Commissariaat voor de Media inhoudsopgave Voorwoord 7 Inleiding 9 Samenvatting 11 1. Trends en ontwikkelingen 19 2. Mediabedrijven 29 2.1 Overzicht 31 2.2 Ontwikkelingen grootste mediabedrijven 34 3. Mediamarkten 57 Colofon 3.1 Dagbladen 59 3.2 Publiekstijdschriften 66 De Mediamonitor is een uitgave van het Commissariaat voor de Media 3.3 Televisie 73 3.4 Radio 81 Redactie 3.5 Internet 87 Marcel Betzel 3.6 Distributie 90 Ivo Chamuleau Edmund Lauf Verdieping: Diversiteit van en tevredenheid met het aanbod in televisiepakketten 97 Rosa van Santen Rini Sierhuis 4. Diversiteit van televisiepakketten 100 Jan Vosselman Bosch 4.1 Pakketaanbieders 101 4.2 Standaardpakketten 104 Vormgeving 4.3 Pluspakketten 113 Studio FC Klap 4.4 Vergelijking 2014 met 2011 118 Druk 5. Tevredenheid met het aanbod in televisiepakketten 123 Roto Smeets GrafiServices 5.1 Televisiekijkers en abonnementhouders 124 5.2 Ontvangst en kijkgedrag 125 Commissariaat voor de Media 5.3 Abonnementen op televisiepakketten 127 Hoge Naarderweg 78 lllll 1217 AH Hilversum 5.4 Tevredenheid televisiepakketten 129 Postbus 1426 lllll 1200 BK Hilversum 5.5 Diversiteit en tevredenheid 135 T 035 773 77 00 lllll F 035 773 77 99 lllll [email protected] www.cvdm.nl lllll www.mediamonitor.nl Bijlagen 139 A. Over de Mediamonitor 141 ISSN 2211-2995 B. Bronnenlijst 143 C. Methodische verantwoording 151 4 5 voorwoord Ook dit jaar brengt het Commissariaat voor de Media met deze Mediamonitor de meest actuele trends, de voornaamste mediabedrijven en de concentratie op de mediamarkten in kaart. Deze keer gaan we daarbij in het bijzonder in op het zenderaanbod aan de Nederlandse televisiekijker.