Digitale UrkundenpräSentationen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Provenienzen Von Inkunabeln Der BSB
Provenienzen von Inkunabeln der BSB Nähere historisch-biographische Informationen zu den einzelnen Vorbesitzern sind enthalten in: Bayerische Staatsbibliothek: Inkunabelkatalog (BSB-Ink). Bd. 7: Register der Beiträger, Provenienzen, Buchbinder. [Redaktion: Bettina Wagner u.a.]. Wiesbaden: Reichert, 2009. ISBN 978-3-89500-350-9 In der Online-Version von BSB-Ink (http://inkunabeln.digitale-sammlungen.de/sucheEin.html) können die in der Bayerischen Staatsbibliothek vorhandenen Inkunabeln aus dem Besitz der jeweiligen Institution oder Person durch Eingabe des Namens im Suchfeld "Provenienz" aufgefunden werden. Mehrteilige Namen sind dabei in Anführungszeichen zu setzen; die einzelnen Bestandteile müssen durch Komma getrennt werden (z.B. "Abensberg, Karmelitenkloster" oder "Abenperger, Hans"). 1. Institutionen Ort Institution Patrozinium Abensberg Karmelitenkloster St. Maria (U. L. Frau) Aichach Stadtpfarrkirche Beatae Mariae Virginis Aldersbach Zisterzienserabtei St. Maria, vor 1147 St. Petrus Altdorf Pfarrkirche Altenhohenau Dominikanerinnenkloster Altomünster Birgittenkloster St. Peter und Paul Altötting Franziskanerkloster Altötting Kollegiatstift St. Maria, St. Philipp, St. Jakob Altzelle Zisterzienserabtei Amberg Franziskanerkloster St. Bernhard Amberg Jesuitenkolleg Amberg Paulanerkloster St. Joseph Amberg Provinzialbibliothek Amberg Stadtpfarrkirche St. Martin Andechs Benediktinerabtei St. Nikolaus, St. Elisabeth Angoulême Dominikanerkloster Ansbach Bibliothek des Gymnasium Carolinum Ansbach Hochfürstliches Archiv Aquila Benediktinerabtei -

Rottenburger Jahrbuch Für Kirchengeschichte
Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte Rottenburger Im Jahr 1907 versuchte der Vatikan mit dem Dekret „Lamentabili“ und der Enzy- Rottenburger klika „Pascendi“ moderne Denkansätze in der katholischen Theologie zu unter- Jahrbuch für binden. Ausgehend von diesen zentra- len Dokumenten zeichnen die Beiträge Kirchengeschichte im neuen Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte die Entwicklung der Zensur Kontrolle von Wissen durch Kirche und Staat im neuzeitlichen Europa nach. abweichender Meinungen Aktuelle Forschungsergebnisse zur rö- mischen Inquisition und Indexkongre- durch Kirche und Staat gation werden aufgegriffen. Ein besonderes Augenmerk legen die Beiträge auf den Modernismusstreit in- nerhalb der katholischen Kirche. Ein ei- gener Abschnitt ist den „Modernisten“ der Diözese Rottenburg gewidmet. 2009 Geschichtsverein der Diözese 28 Rottenburg-Stuttgart Thorbecke Band 28 | 2009 ISBN 978-3-7995-6378-9 ISSN 0722-7531 7 8 3 7 9 9 5 6 3 7 rjkg28_cover.indd 1 05.05.11 16:52 63789_rjkg28_s1_4.qxd:Titelei_RJKG_25 02.05.2011 8:36 Uhr Seite 1 Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte Band 28 · 2009 63789_rjkg28_s1_4.qxd:Titelei_RJKG_25 02.05.2011 8:36 Uhr Seite 2 63789_rjkg28_s1_4.qxd:Titelei_RJKG_25 02.05.2011 8:36 Uhr Seite 3 Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte Band 28 · 2009 Herausgegeben vom Geschichtsverein der Diözese Rottenburg-Stuttgart Jan Thorbecke Verlag 63789_rjkg28_s1_4.qxd:Titelei_RJKG_25 02.05.2011 8:36 Uhr Seite 4 Bei unverlangt eingehenden Rezensionsexemplaren kann keine Gewähr für Besprechung und Rücksendung übernommen werden. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © 2011 by Jan Thorbecke Verlag der Schwabenverlag AG, Ostfildern www.thorbecke.de · [email protected] Alle Rechte vorbehalten. -
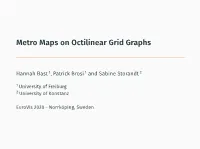
Metro Maps on Octilinear Grid Graphs
Metro Maps on Octilinear Grid Graphs Hannah Bast 1, Patrick Brosi 1 and Sabine Storandt 2 1 University of Freiburg 2 University of Konstanz EuroVis 2020 - Norrköping, Sweden TubeMotivation map - Official London Tube Map 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Outside fare zones Outside Check before you travel Cheshunt Epping § East Ham Chesham Watford Junction fare zones No step-free access to the eastbound 9 Chalfont &8 7 8 7 6 5 Enfield Town 8 7 Theydon Bois Theobalds Grove 9 Latimer District line from Tuesday 23 July 2019 Watford High Street Bush Hill Debden Shenfield until early January 2020. Watford Cockfosters Amersham Park Turkey Street High Barnet Loughton --------------------------------------------------------------------------- A Chorleywood Bushey Oakwood A § Heathrow Croxley Totteridge & Whetstone Southbury Chingford Buckhurst Hill 6 TfL Rail customers should change at Rickmansworth Carpenders Park Southgate Brentwood Woodside Park Edmonton Green Terminals 2 & 3 for free rail transfer Moor Park Roding Grange to Terminal 5. Arnos Grove Valley Hill 5 Hatch End Mill Hill East West Finchley Silver Street --------------------------------------------------------------------------- Northwood Highams Park Edgware Harold Wood Stanmore Bounds Green Chigwell § Hounslow West West Ruislip Headstone Lane 4 White Hart Lane Northwood Hills Hainault Step-free access for manual Finchley Central Woodford Gidea Park Hillingdon Ruislip Harrow & Canons Park Burnt Oak Wood Green Bruce Grove Pinner Wealdstone wheelchairs only. Ruislip Manor Harringay Wood Street Fairlop Romford Green South South --------------------------------------------------------------------------- Uxbridge Queensbury Colindale East Finchley Turnpike Lane Woodford Ickenham North Harrow Lanes Tottenham Eastcote Barkingside § Services or access at these stations are Crouch Snaresbrook Emerson Park Kenton Kingsbury Hendon Central Highgate Blackhorse subject to variation. -

Application of Link Integrity Techniques from Hypermedia to the Semantic Web
UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON Faculty of Engineering and Applied Science Department of Electronics and Computer Science A mini-thesis submitted for transfer from MPhil to PhD Supervisor: Prof. Wendy Hall and Dr Les Carr Examiner: Dr Nick Gibbins Application of Link Integrity techniques from Hypermedia to the Semantic Web by Rob Vesse February 10, 2011 UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON ABSTRACT FACULTY OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND COMPUTER SCIENCE A mini-thesis submitted for transfer from MPhil to PhD by Rob Vesse As the Web of Linked Data expands it will become increasingly important to preserve data and links such that the data remains available and usable. In this work I present a method for locating linked data to preserve which functions even when the URI the user wishes to preserve does not resolve (i.e. is broken/not RDF) and an application for monitoring and preserving the data. This work is based upon the principle of adapting ideas from hypermedia link integrity in order to apply them to the Semantic Web. Contents 1 Introduction 1 1.1 Hypothesis . .2 1.2 Report Overview . .8 2 Literature Review 9 2.1 Problems in Link Integrity . .9 2.1.1 The `Dangling-Link' Problem . .9 2.1.2 The Editing Problem . 10 2.1.3 URI Identity & Meaning . 10 2.1.4 The Coreference Problem . 11 2.2 Hypermedia . 11 2.2.1 Early Hypermedia . 11 2.2.1.1 Halasz's 7 Issues . 12 2.2.2 Open Hypermedia . 14 2.2.2.1 Dexter Model . 14 2.2.3 The World Wide Web . -

Lake Constance Sales Guide 2020/21
english Bodensee! LAKE CONSTANCE SALES GUIDE 2020/21 Four countries. One lake. Trade compass. www.bodensee.eu Germany, Austria, Switzerland and the Principality of Liechtenstein Welcome to Lake Constance Region! Lake Constance is a classic year-round European destination. Today‘s holidaymakers are looking for just that. Boundless, refreshing, high quality, traditional, nostalgic – all that fits us. YOUR CONTACT FOR THE FOUR-COUNTRY REGION: Internationale Bodensee Tourismus GmbH Tourist Board of Lake Constance Hafenstrasse 6, 78462 Constance, Germany Phone +49 7531 909430 [email protected] www.lake-constance.com Publisher & Copyright: Internationale Bodensee Tourismus GmbH Subject to changes Design: hggraphikdesign Heidi Lehmann, Radolfzell Fotos: Internationale Bodensee Tourismus GmbH & their partners, Achim Mende Cover Photo: Zeppelin NT, Photograph: Michael Häfner (www.michael-haefner.com) All information for tour operators and travel agencies can be found at www.bodensee.eu/trade © Paul Aschenborn © Paul Switzerland in spring Principality of Liechtenstein in summer Germany in autumn Austria in winter 2 | Sales Guide Bodensee Lake Constance. In the heart of Europe. GERMANY SWITZERLAND AUSTRIA PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN Sales Guide Bodensee | 3 Contents page Lake Constance Region and its Highlights ................................................................................................................................................ 8 General Information ......................................................................................................................................................................................... -

Kibizz – März 2020
Kultur in Biberach kiwww.kibizz-bvd.debizzMärz 2020 Das Veranstaltungsmagazin für den Landkreis Biberach für den Landkreis Das Veranstaltungsmagazin Marlies Blume Fünf Stunden Live Funkenfeuer Kultur in Heggbach Biberacher Musiknacht Brauchtumspflege Zeit für Bauhaus Die Junghans max bill beweist, dass weniger wirklich mehr sein kann. Puristisch durch und durch, lenkt sie den Blick auf das Wesentliche: die Zeit. Die Original Bauhausuhr von Max Bill: JUNGHANS max bill Automatic mit mecha nischem Werk. max bill Automatic Stil leben. ssEn und rinkEn im andkrEis iBErach www.junghans.de E T L B ASIATISCH Hotel-Restaurant Klosterhof Café-Restaurant Badstube TG-Heim Restaurant Am Kurpark 1, 88422 Bad Buchau Adenauerallee 11, Biberach Goldener Star Deluxe Schloßbezirk 2, Gutenzell Telefon 07582/800-1247 Telefon 07351/5772171 Freiburger Str. 18 / Rißstraße 19 Telefon 07352/9233-0 www.badstube-badbuchau.de Mo.–Fr. 11.30–14 Uhr & ab 17.30 Uhr Biberach, Telefon 07351/5771218 www.klosterhof-gutenzell.de Kein Ruhetag Sa. Gruppen n. Vereinbarung Mo.–So. 11.30–14.30 Uhr Di.–Do. ab 17.30 Uhr So. 9.30–14.30 Uhr und 17.30–22.30 Uhr Fr.–So. ab 11.30–14 & ab 17.30 Uhr Gasthaus Sonne Montag Ruhetag Buchauer Straße 8, Oggelshausen ITALIENISCH BISTRO Telefon 07582/8698 ITALIENISCH Gasthaus zur Linde www.sonne-am-federsee.de Bistro Restaurant TopSpin Lindenplatz 5, Rot an der Rot Ristorante Küche von 11.30–14 Uhr & 17–21 Uhr La Stazione Grenzenstraße 4, Ochsenhausen Telefon 08395/1493 Dienstag Ruhetag Telefon 07352/9260 [email protected] Bahnhofstr. 26, Biberach www.topspin-ochsenhausen.de Fr.–Mi. -

Deutsche Nationalbibliografie 2015 a 32
Deutsche Nationalbibliografie Reihe A Monografien und Periodika des Verlagsbuchhandels Wöchentliches Verzeichnis Jahrgang: 2015 A 32 Stand: 05. August 2015 Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main) 2015 ISSN 1869-3946 urn:nbn:de:101-ReiheA32_2015-0 2 Hinweise Die Deutsche Nationalbibliografie erfasst eingesandte Pflichtexemplare in Deutschland veröffentlichter Medienwerke, aber auch im Ausland veröffentlichte deutschsprachige Medienwerke, Übersetzungen deutschsprachiger Medienwerke in andere Sprachen und fremdsprachige Medienwerke über Deutschland im Original. Grundlage für die Anzeige ist das Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek (DNBG) vom 22. Juni 2006 (BGBl. I, S. 1338). Monografien und Periodika (Zeitschriften, zeitschriftenartige Reihen und Loseblattausgaben) werden in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen (z.B. Papierausgabe, Mikroform, Diaserie, AV-Medium, elektronische Offline-Publikationen, Arbeitstransparentsammlung oder Tonträger) angezeigt. Alle verzeichneten Titel enthalten einen Link zur Anzeige im Portalkatalog der Deutschen Nationalbibliothek und alle vorhandenen URLs z.B. von Inhaltsverzeichnissen sind als Link hinterlegt. In Reihe A werden Medienwerke, die im Verlagsbuch- chende Menüfunktion möglich. Die Bände eines mehrbän- handel erscheinen, angezeigt. Auch außerhalb des Ver- digen Werkes werden, sofern sie eine eigene Sachgrup- lagsbuchhandels erschienene Medienwerke werden an- pe haben, innerhalb der eigenen Sachgruppe aufgeführt, gezeigt, wenn sie von gewerbsmäßigen Verlagen vertrie- ansonsten -

Stoedtner O J 1 L.Pdf
Fotokatalog Photographic Catalogue Catalogo fotografico Source: http://www.khi.fi.it/5201080/Fotokataloge Stable URL: http://wwwuser.gwdg.de/~fotokat/Fotokataloge/Stoedtner_o_J_1_l.pdf Published by: Photothek des Kunsthistorischen Instituts in Florenz, Max-Planck-Institut http://www.khi.fi.it Deutsche Plastil~ . des Mittelalters DR. FRANZ STOEDTNER BERLIN Deutsche Plastik des Mittelalters von der Völkerwanderung . bis zur Reformation I1l 'Jtach der Jubiläumsausgabe (1935) meines Kataloges über "Deutsche Kunst", die aus dem Gesamtgebiet nur 3'/, Tausend ausgewählter Bilder gab. lasse ich jett in kurzen Abständen weitere vollständige Verzeichnisse folgen, die über Baukunst, Plastik und Malerei das nötige Handwerkszeug für den Unterricht darbieten und reiches. unbekanntes Studienmaterial ent· halten. Das erste Verzeichnis betrifft mein Lieblingsgebiet. die deutsche Plastik von der Völkerwanderung bis zur Reformation. Ich habe 'mich nicht auf unsere politischen Grenzen beschränkt, sondern ich gebe auch die Plastik jener Länder, die einstmals deutsch waren oder starke deutsche Beeinflussun gen erfahren haben. So Hndet man hier neben der niederländischen, bur gundischen auch die Schweizer Plastik (die des Elsass ganz selbstverständ• lich), dann die Tiroler und die Plastik der Ostmark (das frühere österreich), die böhmische und die Plastik in den Kolonisationsgebieten des deutschen Ritterordens und der Hansa. Das Verzeichnis beginnt mit der Kunst der Völker seit der großen Wan~ dcrung. geht dann vom Oberrhein (Schwaben) über Mittelrhein nach Fran· ken, Böhmen, BayerI.l mit Tirol und Ostmark. sett sich fort mit dem Nie derrhcin (einschließlich Niederlande) über Westfalen in das Niedersachsen- land und endet mit dem Nordosten. Den häßlichen und irreführenden Namen der Romanik oder romanischen Zeit lehne ich für unsere germanische und deutsche Plastik des Mittelalters ab. -

Magazine English Edition
BODENSEEMAGAZINE ENGLISH EDITION Germany/Austria € 5,– Switzerland CHF 6.50 GERMANY | SWITZERLAND | AUSTRIA | PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN 10001 4 197329 305001 TRIPS & SIGHTS, CULTURE & HISTORY, FOOD & WINE BÜNDNER ALPEN GLARNER ALPEN URNER ALPEN BERNER ALPEN SÄNTIS A LTMANN 2502 m 2436 m A LVIER DREI SCHWESTERN 2343 m 2052 m CHURFIRSTEN 2306 m RIGI MYTHEN SPEER 1699 m Zürich HOHER KASTEN M ATTSTOCK 1899 m 1795 m Ebenalp 1936 m 1950 m 1644 m TANZBODEN Chur KRONBERG 1443 m 1663 m Schwägalp V ierwaldstätter LIECHTENSTEIN Buchs 1278 m Neßlau See LUZERN VADUZ W asserauen Ebnat 868 m Montafon/Arlberg FÄHNERNSPITZ Zugersee Gonten W attwil H 1506 m W eißbad U r näsch Z ü C Lichtensteig r i c h ZÜRICH FELDKIRCH s e I W aldstatt G r e Hundwil e i f Pfäffiker e n s Appenzell e e E Rankweil See GMBH, www.teamwerk-neubert.de © TEAMWERK NEUBERT Oberriet USTER Hegnau KARREN R HERISAU KLOTEN 976 m Gais WIL Götzis A 13 Teufen T h u r Münchwilen R Altstätten GOSSAU Diepoldsau Speicher Wängi Hohenems Widnau BÜLACH S T. GALLEN E WINTER THUR Bödele Bischofszell Tobel T Heiden Wittenbach W alzenhausen DORNBIRN LUSTENAU A 1 Kradolf St. Margr ethen W olfhalden Zihlschlacht FRAUENFELD S RORSCHACH Berg Sulgen A 14 S Thal A 4 i n Rheineck C Amlikon Z h e Staad Hor n Felben R Höchst Steinach H I Andelfingen Erlen W E A l t Hagenwil ÖBregenzer W ald Fußach Gaissau e r ARBON W einfelden Kleinandelfingen R Pfyn T h u r Bizau h e Märstetten i Altenrhein Frasnacht Amriswil Ossingen Rheinau W olfurt n Neukir ch Berg Dettighofen Marthalen Lauterach R h e i n Egnach -

Germany 2019 International Religious Freedom Report
GERMANY 2019 INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM REPORT Executive Summary The constitution prohibits religious discrimination and provides for freedom of faith and conscience and the practice of one’s religion. The country’s 16 states exercise considerable autonomy on registration of religious groups and other matters. Unrecognized religious groups are ineligible for tax benefits. The federal and some state offices of the domestic intelligence service continued to monitor the activities of certain Muslim groups and mosques. Authorities also monitored the Church of Scientology (COS), which reported continued government discrimination against its members. Certain states continued to ban or restrict the use of religious clothing or symbols, including headscarves, for some state employees. In May federal anti-Semitism commissioner Felix Klein, responding to what he stated was the rising number of anti-Semitic incidents in the country, said he could “no longer recommend Jews wear a kippah at every time and place in Germany.” Many Jewish leaders in the community were supportive of Klein, but some prominent politicians, Jewish leaders, and national media responded negatively. Senior government leaders continued to condemn anti-Semitism and anti-Muslim sentiment. Seven additional state governments appointed anti- Semitism commissioners for the first time, bringing the total number of states with such commissioners to 13 (out of 16), in addition to the federal Jewish life and anti-Semitism commissioner. In July the government announced it would increase social welfare funding for Holocaust survivors by 44 million euros ($49.4 million) in 2020, including for the first time pension payments to Holocaust survivors’ widowed spouses. There were numerous reports of anti-Semitic, anti-Muslim, and anti-Christian incidents. -

Günter Hütter / Gerhard Thalheimer Aalen. Wallfahrtskirche St. Maria Unterkochen
Günter Hütter / Gerhard Thalheimer Aalen. Wallfahrtskirche St. Maria Unterkochen. Reihe: Kleine Kunstführer 1756 16 S., 13 Farbabb., 2 s/w-Abb., 12 x 17 cm ISBN 978-3-7954-5466-1 € 2.50 [D] Paul Hövels / Alois Nühlse Ahlen / Westf.. Kath. Pfarrkirche St. Marien. Reihe: Kleine Kunstführer 2116 20 S., 6 Farbabb., 10 s/w-Abb., 12 x 17 cm ISBN 978-3-7954-5852-2 € 3.00 [D] Willibald Hauer Aldersbach. Kath. Pfarrkirche - Zisterzienserklosterkirche, English Edition. Reihe: Kleine Kunstführer 698e 24 S., 10 Farbabb., 8 s/w-Abb., 12 x 17 cm ISBN 978-3-7954-4445-7 € 3.00 [D] Paul Hövels / Alois Nühlse Ahlen / Westf.. Kath. Pfarrkirche St. Marien. Reihe: Kleine Kunstführer 2116 20 S., 6 Farbabb., 10 s/w-Abb., 12 x 17 cm ISBN 978-3-7954-5852-2 € 3.00 [D] Hasso v. Poser und Groß-Naedlitz Alfeld. St. Nikolai. Reihe: Kleine Kunstführer 1607 24 S., 9 Farbabb., 14 s/w-Abb., 12 x 17 cm ISBN 978-3-7954-5317-6 € 3.00 [D] Günter Kolb Alpirsbach. Kloster, Ehem. Benediktinerabtei. Reihe: Kleine Kunstführer 617 36 S., 3 Farbabb., 19 s/w-Abb., 12 x 17 cm ISBN 978-3-7954-4391-7 € 3.00 [D] Manfred Akermann / Walter Ziegler Adelberg. Kloster. Reihe: Kleine Kunstführer 1104 24 S., 3 Farbabb., 17 s/w-Abb., 12 x 17 cm ISBN 978-3-7954-4830-1 € 3.00 [D] Günter Kolb Alpirsbach. Kloster, Ehem. Benediktinerabtei. Reihe: Kleine Kunstführer 617 36 S., 3 Farbabb., 19 s/w-Abb., 12 x 17 cm ISBN 978-3-7954-4391-7 € 3.00 [D] L. -

Ochsenhausen Erleben 2018“! Sem Jahr Wieder in Einer Ausstellung Vor Und Belohnen Die Besten Fotografen Mit Einem Ihr Preis
Ochsenhausen erleben Informationen Veranstaltungen Umweltkalender 2018 Herzlich Willkommen IN OCHSENHAUSEN Liebe Ochsenhauserinnen und Ochsenhauser, verehrte Gäste, ein Bild sagt be- Neben den schönen Fotos finden Sie in unse- kanntlich mehr als rem Magazin „Ochsenhausen erleben“ aber tausend Worte! – auch wieder jede Menge Informationen, die Ih- Diesem bewährten nen helfen sollen, unsere Stadt besser kennen- Grundsatz sind wir zulernen. Zusätzlich zeigt ein umfangreicher auch bei der neu- Veranstaltungskalender, was in Ochsenhausen, en Bürgerbroschü- Mittelbuch und Reinstetten das ganze Jahr re „Ochsenhausen über los ist. erleben 2018“ treu geblieben. Sie fin- Das Zusammentragen und Aktualisieren al- den deshalb in ler Daten und Inhalte ist keine ganz einfache diesem Heft wie- Aufgabe. Die Hauptarbeit leistet hier Frau Mar- der jede Menge toller Fotos, die unsere Stadt got Welte vom Rathaus, der ich für ihr großes aus den verschiedensten Blickwinkeln zeigen. Engagement ganz herzlich danke und bei der unser Heft in besten Händen ist. Ebenfalls mein Das Schönste daran: viele dieser Bilder sind Dank gilt Herrn Christian Denzel und Frau Julia von Ihnen, unseren Leserinnen und Lesern. Schöllhorn von der Firma Denzel Werbedesign: Sie haben sich mit der Kamera auf die Pirsch Beide haben auch in diesem Jahr die Broschüre begeben, um die bekannten und unbekannten wieder perfekt gestaltet und in Form gebracht. Seiten Ochsenhausens zu entdecken und da- Dafür mein Kompliment! mit unser Magazin zu bereichern. Doch nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim Dafür ganz herzlichen Dank. Die schönsten Lesen und viele spannende Entdeckungen in eingereichten Fotos stellen wir auch in die- unserem Heft „Ochsenhausen erleben 2018“! sem Jahr wieder in einer Ausstellung vor und belohnen die besten Fotografen mit einem Ihr Preis.