Rottenburger Jahrbuch Für Kirchengeschichte
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Relationship Between Church and State, Canon Law and Civil Law: Problems and Prospects
IUSTITIA Vol. 9, No. 1 (June 2018) Page: 11-50 RELATIONSHIP BETWEEN CHURCH AND STATE, CANON LAW AND CIVIL LAW: PROBLEMS AND PROSPECTS Paul Pallatir First of all the author examines the Lateran Pacts between the Holy See and the Italian State which constitutes the foundation for the relationship between the Catholic Church and the State even in modern times. Then an overview of the teaching of Vatican II on the autonomy and independence of the Church and civil society in their respective fields is presented, indicating the possibility and manner of observing canon law in democratic, theocratic, confessional, secular, atheistic or totalitarian states. After attempting a compendium of the canons on the theme, the final sections are dedicated to highlight the principles and directives provided by the Codes of canon law regarding the relationship between canon law and civil law, followed by the exemplification of three particular themes: marriage, temporal goods of the Church and penal law. 1. Introduction The Christian faithful, including cardinals, bishops, priests, religious and lay people, are at the same time members of the Church and citizens of a nation. Hence their life and activities are regulated by two orders, canonical and civil, deriving rights and obligations from both. Hence the peaceful life of Christian citizens in any country depends on the harmonious and equilibrated application of canon law and civil Prof. Paul Pallath holds doctorate in Eastern canon law from the Pontifical Oriental Institute in Rome and in Latin canon law from the Pontifical Lateran University. From 1995 to 2011 he rendered service as an official of the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments and then for two years as an official of the Tribunal of the Roman Rota. -

54. Jahrgang 21. Januar 2021 KW 3
54. Jahrgang 21. Januar 2021 KW 3 Öffnungszeiten des Rathauses Apothekenbereitschaftsdienst Montag 9.00 – 12.00 Uhr / 15.00 – 18.00 Uhr Fr., 22.01.Marien-Apotheke, Ehingen Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr Sa., 23.01.St. Martins-Apotheke, Allmendingen Mittwoch 9.00 – 12.00 Uhr So., 24.01.7 Schwaben-Apotheke, Laupheim Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr / 15.00 – 17.00 Uhr Mo., 25.01.Alpha-Apotheke, Ehingen Durch Wahrnehmung von Terminen außerhalb des Di., 26.01.Apotheke am Bronner Berg, Laupheim Rathauses können Sprechzeiten des Bürgermeisters Mi., 27.01.Apotheke Dr. Mack, Munderkingen entfallen. Wichtige Termine, auch außerhalb der Do., 28.01.Schloss-Apotheke, Obermarchtal normalen Sprechzeiten, können jederzeit telefonisch vereinbart werden. Tel. dienstl. 1648 privat 07357/2672 Standesamtliche Nachrichten Wir gratulieren den Eltern Diana und Julian Rapp Ärztlicher Notfalldienst zur Geburt Ihrer Tochter Pauline am 12.01.2021 Bereitschaftsdienst: Notrufnummer 116 117 Bereitschaftsdienst-Zeiten: Mo, Di, Do ab 18 Uhr bis 8 Uhr des Folgetages; Mi ab 13 Uhr bis 8 Uhr des Folgetages; Abfallsammlungen Fr ab 16 Uhr bis 8 Uhr des Folgetages; Hausmüll: Mi, 27.01. Sa, So, Feiertage ab 8 Uhr bis 8 Uhr des Folgetages. Abholung Gelber Sack: Do, 28.01. Öffnungszeiten Notfallpraxis im Kreiskrankenhaus Ehingen (gegenüber Information am Haupteingang) Sa, So, Feiertage (auch 24./31.12.) 8 bis 22 Uhr. Terminvereinbarung nicht erforderlich. Notfallpraxis an normalen Werktagen geschlossen. Zahnärztlicher Notfalldienst Zu erfragen unter Tel . 01805 / 911 601 Zahnmedizinische -

Œwięty Ojcze Pio
GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE Numer 3(12) Mierzeszyn, marzec 2011 r. ISSN 2082-0089 Rok 2 ŒWIÊTY OJCZE PIO ... Naucz nas prosimy Cię pokory serca, abyśmy zostali zaliczeni do owych prostaczków z Ewangelii, którym Ojciec obiecał objawić tajemnicę swojego Królestwa. Wyjednaj nam spojrzenie wiary, zdolne rozpoznawać natychmiast w ubogich i cierpiących oblicze samego Jezusa. Wspieraj nas w godzinie walki i próby, a jeśli upadniemy, spraw, abyśmy doświadczyli radości sakramentu pojednania. Przekaż nam Twoją czułą pobożność do Maryi Matki Jezusa i naszej. Bądź z nami w ziemskiej pielgrzymce do Ojczyzny, którą mamy nadzieję osiągnąć, aby kontemplować na wieki Chwałę Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. JAN PAWEŁ II U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 3(12) marzec 2011 2 tłumaczenie tekstu z 1. strony: PROGRAM BEATYFIKACJI JANA PAWŁA II Beatyfikacja Jana Pawła II będzie wielkim wydarzeniem kościelnym, na które złożą się następujące momenty: Czuwanie przygotowuj¹ce będzie miało miejsce w sobotę 30 kwietnia wieczorem (od godz. 20:00 przygotowanie; od 21:00 do 22:30 czuwanie). Odbędzie się ono na antycznym stadionie Circo Massimo. Jest organizowane przez diecezję Rzymu, której czcigodny sługa Boży był biskupem. Czuwanie poprowadzi kard. Agostino Vallini, papieski wikariusz dla diecezji rzymskiej. Benedykt XVI duchowo połączy się z zebranymi za pośrednictwem wideo. Uroczystoœci beatyfikacyjne w niedzielę 1 maja na Placu św. Piotra rozpoczną się o godz. 10 rano. Przewodniczyć będzie Ojciec Święty. Na liturgię nie ma biletów. Wstęp na Plac i w okolice Watykanu kierowany będzie przez odpowiednie służby. Oddanie czci doczesnym szcz¹tkom nowego B³ogos³awionego będzie przez wiernych możliwe już w niedzielę 1 maja, zaraz po uroczystościach beatyfikacyjnych. -

Immersion Into Noise
Immersion Into Noise Critical Climate Change Series Editors: Tom Cohen and Claire Colebrook The era of climate change involves the mutation of systems beyond 20th century anthropomorphic models and has stood, until recent- ly, outside representation or address. Understood in a broad and critical sense, climate change concerns material agencies that im- pact on biomass and energy, erased borders and microbial inven- tion, geological and nanographic time, and extinction events. The possibility of extinction has always been a latent figure in textual production and archives; but the current sense of depletion, decay, mutation and exhaustion calls for new modes of address, new styles of publishing and authoring, and new formats and speeds of distri- bution. As the pressures and re-alignments of this re-arrangement occur, so must the critical languages and conceptual templates, po- litical premises and definitions of ‘life.’ There is a particular need to publish in timely fashion experimental monographs that redefine the boundaries of disciplinary fields, rhetorical invasions, the in- terface of conceptual and scientific languages, and geomorphic and geopolitical interventions. Critical Climate Change is oriented, in this general manner, toward the epistemo-political mutations that correspond to the temporalities of terrestrial mutation. Immersion Into Noise Joseph Nechvatal OPEN HUMANITIES PRESS An imprint of MPublishing – University of Michigan Library, Ann Arbor, 2011 First edition published by Open Humanities Press 2011 Freely available online at http://hdl.handle.net/2027/spo.9618970.0001.001 Copyright © 2011 Joseph Nechvatal This is an open access book, licensed under the Creative Commons By Attribution Share Alike license. Under this license, authors allow anyone to download, reuse, reprint, modify, distribute, and/or copy this book so long as the authors and source are cited and resulting derivative works are licensed under the same or similar license. -

Provenienzen Von Inkunabeln Der BSB
Provenienzen von Inkunabeln der BSB Nähere historisch-biographische Informationen zu den einzelnen Vorbesitzern sind enthalten in: Bayerische Staatsbibliothek: Inkunabelkatalog (BSB-Ink). Bd. 7: Register der Beiträger, Provenienzen, Buchbinder. [Redaktion: Bettina Wagner u.a.]. Wiesbaden: Reichert, 2009. ISBN 978-3-89500-350-9 In der Online-Version von BSB-Ink (http://inkunabeln.digitale-sammlungen.de/sucheEin.html) können die in der Bayerischen Staatsbibliothek vorhandenen Inkunabeln aus dem Besitz der jeweiligen Institution oder Person durch Eingabe des Namens im Suchfeld "Provenienz" aufgefunden werden. Mehrteilige Namen sind dabei in Anführungszeichen zu setzen; die einzelnen Bestandteile müssen durch Komma getrennt werden (z.B. "Abensberg, Karmelitenkloster" oder "Abenperger, Hans"). 1. Institutionen Ort Institution Patrozinium Abensberg Karmelitenkloster St. Maria (U. L. Frau) Aichach Stadtpfarrkirche Beatae Mariae Virginis Aldersbach Zisterzienserabtei St. Maria, vor 1147 St. Petrus Altdorf Pfarrkirche Altenhohenau Dominikanerinnenkloster Altomünster Birgittenkloster St. Peter und Paul Altötting Franziskanerkloster Altötting Kollegiatstift St. Maria, St. Philipp, St. Jakob Altzelle Zisterzienserabtei Amberg Franziskanerkloster St. Bernhard Amberg Jesuitenkolleg Amberg Paulanerkloster St. Joseph Amberg Provinzialbibliothek Amberg Stadtpfarrkirche St. Martin Andechs Benediktinerabtei St. Nikolaus, St. Elisabeth Angoulême Dominikanerkloster Ansbach Bibliothek des Gymnasium Carolinum Ansbach Hochfürstliches Archiv Aquila Benediktinerabtei -

Mitteilungsblatt KW 03/21
Mitteilungsblatt der Gemeinde Balzheim NEUIGKEITEN AUS OBER- UND UNTERBALZHEIM Freitag, 22. Januar 2021/Nr. 03 AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN Termine Diese Bündelung der 55 einzelnen Kom- Corona-Verordnung 22.01.2021 Abfuhr Gelber Sack Einreise-Quarantäne munen stärkt die fachliche Kompetenz im Bereich der Grundstücksbewertung, ermöglicht eine qualifiziertere Marktbe- Zum 18.01.2021 ist eine erneute Ände- 23.01.2021 Recyclinghof wertung und lässt eine rechtssichere rung der CoronaVO EQ in Kraft getreten. Carl-Otto-Weg 16 Ableitung der Bodenrichtwerte zu. Diese neue Verordnung regelt die Quaran- 10.30 – 12.00 Uhr täne. Die Testpflicht (2 Stufen Testung) wird nun einheitlich über die Bundesver- Auch die Gemeinde Balzheim gehört diesem Gremium an. Der lokale Gutachter- ordnung geregelt. 25.01.2021 Gemeinde Balzheim ausschuss beendete seine Tätigkeiten Gemeinderatssitzung mit zum 31. Januar 2021. Ab dem 01. Februar Bei Einreise aus einem Risikogebiet Einsetzung und 2021 wird der gemeinsame Gutachteraus- besteht weiterhin grundsätzlich eine Verpflichtung des neuen schuss dessen Aufgaben übernehmen. zehntägige Quarantänepflicht, die frühe- Bürgermeisters stens mit einem ab dem fünften Tag der Herrn Maximilian Die Führung einer Kaufpreissammlung, die Quarantäne erhobenen negativen Tester- Hartleitner, Ermittlung von Bodenrichtwerten, die gebnis beendet werden kann. Es gilt zu- Dorfgemeinschaftshaus, Erstattung von Gutachten, die Erteilung sätzlich eine Testpflicht bei Einreise. großer Saal, 18:00 Uhr von Auskünften und weitere Verwaltungs- Der Testpflicht kann durch eine Testung Hinweis: Zugang nur für aufgaben, wie diese im Baugesetzbuch binnen 48 Stunden vor Anreise oder durch geladene Personen eine Testung unmittelbar nach Einreise geregelt sind, werden künftig über den nachgekommen werden. gemeinsamen Gutachterausschuss abge- wickelt. 29.01.2021 Recyclinghof Bitte wenden Sie sich in diesen Fällen an Von einer Coronavirus-Infektion „Gene- Carl-Otto-Weg 16 die dortige Geschäftsstelle: sene“ sind von der Quarantänepflicht be- 15:00 – 16:30 freit. -

24. Januar 2020 Nr. 4 Gemeindeverwaltung: Telefon 07393 953516 Telefax 07393 953517 Homepage: E–Mail: Info@Hausen–Am–Bussen.De
Redaktionsschluss Amtsblatt: Mittwoch 08:00 Uhr 24. Januar 2020 Nr. 4 Gemeindeverwaltung: Telefon 07393 953516 Telefax 07393 953517 Homepage: www.hausen–am–bussen.de E–Mail: info@hausen–am–bussen.de AMTLICHE MITTEILUNGEN DER GEMEINDE Sprechzeiten des Bürgermeisters In der nächsten Woche gelten folgende Öffnungszeiten in den Rathäusern in Hausen am Bussen und in Unterwachingen: Rathaus Unterwachingen: Donnerstag von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr Rathaus Hausen am Bussen: Donnerstag von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr. In dringenden Fällen ist Herr Bürgermeister Rieger unter der Telefon–Nr. 07393 3516 erreichbar. – Bürgermeisteramt – Öffentliche Sitzung des Gemeinderats in Hausen am Bussen Am Dienstag, den 28. Januar 2020, findet um 19:30 Uhr, im Rathaus in Hausen am Bussen die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderats statt. Zu dieser Sitzung ergeht hiermit freundliche Einladung. T A G E S O R D N U N G : 1.) Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2020 einschließ- lich Finanzplanung 2019 – 2023 2.) Spenden an die Gemeinde – Zustimmung des Gemeinderats nach § 78 Gemeindeordnung (GemO) 3.) Bekanntgaben 4.) Verschiedenes, Wünsche, Anfragen Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. Hans Rieger – Bürgermeister Abfuhr des „Gelben Sackes“ Die nächste Abfuhr der „Gelben Säcke“ in unserer Gemeinde erfolgt am kommenden Dienstag, den 28. Januar 2020 durch die Firma Gebr. Braig, Ehingen–Berkach. Wir möchten auf diesen Termin hinweisen und gleichzeitig bitten, das Sammelgut ab 06:30 Uhr bereitzulegen. Besucherrekord bei der diesjährigen CMT in Stuttgart SWR–Wetterreporter Harry Röhrle am Stand von „Ferien rund um den Bussen“ Von links: BM a. D. Manfred Weber, BM Hans Rieger, Harry Röhrle vom SWR. -
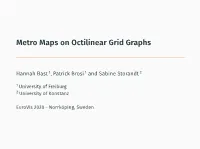
Metro Maps on Octilinear Grid Graphs
Metro Maps on Octilinear Grid Graphs Hannah Bast 1, Patrick Brosi 1 and Sabine Storandt 2 1 University of Freiburg 2 University of Konstanz EuroVis 2020 - Norrköping, Sweden TubeMotivation map - Official London Tube Map 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Outside fare zones Outside Check before you travel Cheshunt Epping § East Ham Chesham Watford Junction fare zones No step-free access to the eastbound 9 Chalfont &8 7 8 7 6 5 Enfield Town 8 7 Theydon Bois Theobalds Grove 9 Latimer District line from Tuesday 23 July 2019 Watford High Street Bush Hill Debden Shenfield until early January 2020. Watford Cockfosters Amersham Park Turkey Street High Barnet Loughton --------------------------------------------------------------------------- A Chorleywood Bushey Oakwood A § Heathrow Croxley Totteridge & Whetstone Southbury Chingford Buckhurst Hill 6 TfL Rail customers should change at Rickmansworth Carpenders Park Southgate Brentwood Woodside Park Edmonton Green Terminals 2 & 3 for free rail transfer Moor Park Roding Grange to Terminal 5. Arnos Grove Valley Hill 5 Hatch End Mill Hill East West Finchley Silver Street --------------------------------------------------------------------------- Northwood Highams Park Edgware Harold Wood Stanmore Bounds Green Chigwell § Hounslow West West Ruislip Headstone Lane 4 White Hart Lane Northwood Hills Hainault Step-free access for manual Finchley Central Woodford Gidea Park Hillingdon Ruislip Harrow & Canons Park Burnt Oak Wood Green Bruce Grove Pinner Wealdstone wheelchairs only. Ruislip Manor Harringay Wood Street Fairlop Romford Green South South --------------------------------------------------------------------------- Uxbridge Queensbury Colindale East Finchley Turnpike Lane Woodford Ickenham North Harrow Lanes Tottenham Eastcote Barkingside § Services or access at these stations are Crouch Snaresbrook Emerson Park Kenton Kingsbury Hendon Central Highgate Blackhorse subject to variation. -

NEWSLETTER 2010 | Vol
Postgraduate Programme PPRE Renewable Energy NEWSLETTER 2010 | Vol. 29 Published by: Carl von Ossietzky University of Oldenburg, Faculty of Physics, Department of Energy and Semiconductor Research, Postgraduate Programme Renewable Energy—PPRE, D - 26111 Oldenburg phone: +49-441-798.3544, fax: +49-441-798.3990, e-mail: [email protected], web: http://www.ppre.de Editor: Edu Knagge Typesetting & Layout: Hauke Beck Printer: Druckzentrum, CvO University Oldenburg - 800 copies Content Editorial 4 News from Oldenburg DAAD summer school and PPRE excursion 5 Biogas Workshop 2010, University of Oldenburg 10 Excursion to Science Box 11 First job and education fair for renewable energies and energy efficiency 12 Personal comments about first job and education fair 13 Company Presentations at PPRE, Oldenburg 14 External /Guests lectures PPRE 2009/10 15 Experience Reports from students / graduates Experience with Lahmeyer Int., Bad Vibel, Germany 16 Practical Training experience in Indonesia 16 Experiences gained at Solar Power Group in Essen 18 Half a million efficient fire wood stoves for Kenya 20 My external practical training experience at TaTEDO 21 My experience gained at Woods Hole Oceanographic Institution, USA 22 Wind Turbine Workshop 23 MSc-Thesis Projects 25 News from Alumni Biomass 27 Solar Thermal / CSP 28 Photovoltaics 28 Wind Energy 30 RE related Subjects 33 Careers 38 Reports from Alumni Sustainability of energy supplies in Kenya 42 Training on renewable energy in Kenya 43 International conference on the Developments in Renewable -

THE PILGRIM HERALD October 2017
THE PILGRIM HERALD October 2017 PILGRIM EV. LUTHERAN CHURCH The Lutheran Church-Missouri Synod 462 Meadowbrook Dr., West Bend, WI 53090 (262) 334-0375 Rev. Joseph M. Fisher, Pastor (262) 335-6736 Rev. Christopher Raffa, Pastor (262) 388-8287 www.pilgrimlutheran-westbend dently the poor souls believe that when they The Pilgrim Herald have bought indulgence letters they are then as- Pilgrim Ev. Lutheran Church LC-MS sured of their salvation. They are likewise con- 462 Meadowbrook Drive, West Bend, WI 53090 vinced that souls escape from purgatory as soon October 2017 as they have placed a contribution into the chest. FROM THE DESK OF PASTOR FISHER Further, they assume that the grace obtained 3 Romans 4:3-5 For what does the Scripture through these indulgences is so completely effec- say? “Abraham believed God, and it was tive that there is no sin of such magnitude that it 4 counted to him as righteousness.” Now to cannot be forgiven. (Luther’s Works 48:46) the one who works, his wages are not And then, Luther states the proper way: The 5 counted as a gift but as his due. And to the first and only duty of the bishops, however, is to one who does not work but believes in him see that the people learn the gospel and the love who justifies the ungodly, his faith is of Christ. For on no occasion has Christ ordered counted as righteousness, that indulgences should be preached, but he Greetings in the Name of our Lord and Savior forcefully commanded the gospel to be Jesus Christ. -

Resignations and Appointments
N. 180605a Tuesday 05.06.2018 Resignations and Appointments Resignation of bishop of Fulda, Germany Appointment of bishop of Nanterre, France Resignation of bishop of Fulda, Germany The Holy Father Francis has accepted the resignation from the pastoral care of the diocese of Fulda, Germany, presented by H.E. Msgr. Heinz Josef Algermissen. Appointment of bishop of Nanterre, France The Pope has appointed as bishop of the diocese of Nanterre, France, the Rev. Matthieu Rougé of the clergy of Paris, currently dean and parish priest of Saint-Ferdinand-des-Ternes. Rev. Matthieu Rougé The Rev. Matthieu Rougé was born on 7 January 1966 in Neuilly-sur-Seine in the then archdiocese of Paris, present-day diocese of Nanterre. In 1985 he entered the seminary in Paris. He attended the first cycle of philosophical studies at the Catholic University of Louvain-la-Neuve, Belgium, and continued his ecclesiastical studies at the Pontifical Gregorian University in Rome. During his studies in Rome he attended the Pontifical French Seminary. He was ordained a priest on 25 June 1994 for the archdiocese of Paris. After ordination he continued his theological studies in Rome. In 1999 he received a doctorate in theology from the Pontifical Gregorian 2 University. He has held the following positions and ministries: study mission in Rome (1994-1996) and in Paris (1996-1998); parish vicar in Saint-Séverin-Saint-Nicolas (1998-2000); special secretary to the archbishop of Paris (2000- 2003); pastor-rector of the Basilica Sainte-Clotilde (2003-2012), director of the Service Pastoral d’Etudes Politiques (2004-2012); and a sabbatical year in Madrid-San Dámaso University (2012-2013). -

Application of Link Integrity Techniques from Hypermedia to the Semantic Web
UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON Faculty of Engineering and Applied Science Department of Electronics and Computer Science A mini-thesis submitted for transfer from MPhil to PhD Supervisor: Prof. Wendy Hall and Dr Les Carr Examiner: Dr Nick Gibbins Application of Link Integrity techniques from Hypermedia to the Semantic Web by Rob Vesse February 10, 2011 UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON ABSTRACT FACULTY OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND COMPUTER SCIENCE A mini-thesis submitted for transfer from MPhil to PhD by Rob Vesse As the Web of Linked Data expands it will become increasingly important to preserve data and links such that the data remains available and usable. In this work I present a method for locating linked data to preserve which functions even when the URI the user wishes to preserve does not resolve (i.e. is broken/not RDF) and an application for monitoring and preserving the data. This work is based upon the principle of adapting ideas from hypermedia link integrity in order to apply them to the Semantic Web. Contents 1 Introduction 1 1.1 Hypothesis . .2 1.2 Report Overview . .8 2 Literature Review 9 2.1 Problems in Link Integrity . .9 2.1.1 The `Dangling-Link' Problem . .9 2.1.2 The Editing Problem . 10 2.1.3 URI Identity & Meaning . 10 2.1.4 The Coreference Problem . 11 2.2 Hypermedia . 11 2.2.1 Early Hypermedia . 11 2.2.1.1 Halasz's 7 Issues . 12 2.2.2 Open Hypermedia . 14 2.2.2.1 Dexter Model . 14 2.2.3 The World Wide Web .