Naturparkplan Bericht 160209
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Schwalm-Nette-Platte Mit Grenzwald Und Meinweg Am Niederrhein the Bird Sanctuary “Schwalm-Nette-Platte Mit Grenzwald Und Meinweg“ at the Lower Rhine Von S
Vogel und Luftverkehr, 25. Jg., Heft 1/2005 Seite 60-73 Das Vogelschutzgebiet Das Vogelschutzgebiet Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg am Niederrhein The bird sanctuary “Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg“ at the Lower Rhine von S. PLEINES u. Dr. A. REICHMANN, Nettetal Zusammenfassung: Das Vogelschutzgebiet liegt in den Kreisen Kleve, Vier- sen, Heinsberg sowie der Stadt Mönchengladbach und hat eine Flächengröße von 7221 ha. Es zeichnet sich aus durch sehr unterschiedliche Biotoptypen großer ökologischer Bedeutung: Heide-/Sandtrockenrasen, Waldbereiche und Feuchtlebensräume unterschiedlichen Trophiegrades. Die Bedeutung des Vo- gelschutzgebietes liegt in den ungewöhnlich hohen Brutbestandsschätzungen z.B. bei Teichrohrsänger, Heidelerche und Uferschwalbe. Auch die Bestände der Zugvögel und Wintergäste sind z.T. erheblich z.B. bei Löffelente, Tafelente und Gänsesäger. Innerhalb des Gebietes erfolgt ein Austausch zwischen den Rastgebieten im Norden und Süden sowie dem Maastal. Die stabilen Brut- bzw. Rastbestände von Graureiher, Graugand, Kormoran und Möwe unterstreichen die Bedeutung des Gebietes insbesondere für den Luftsport und den militäri- schen Tiefflug. Summary: The bird sanctuary stretches across the administrative districts of Kleve, Viersen and Heinsberg and the city of Mönchengladbach and has a total area of 7,221 hectares. It is characterized by a range of highly different habitat types of major ecological importance: heath/dry grassland, wooded areas and wetland habitats of various trophic levels. The importance of the sanctuary lies in is unusually high breeding populations of e.g. Reed Warbler, Woodlark and Sand Martin. The populations of some migratory birds and winter visitors are also considerable, e.g. those of Shoveler, Pochard and Goosander. Within the area, an exchange takes place between the roosting areas in the North, in the South and in the Maas valley. -

Umsetzungsfahrplan Schwalm Für Die Wasserkörper Der Planungseinheit PE SWA 1400 Schwalm
Umsetzungsfahrplan Schwalm für die Wasserkörper der Planungseinheit PE_SWA_1400 Schwalm März 2012 Landesgeschäftsstelle Wasserrahmenrichtlinie Bezirksregierung Düsseldorf Cecilienallee 2 40474 Düsseldorf Bearbeitung Kooperationsleitung Schwalmverband Borner Straße 45a 41379 Brüggen Bearbeitung Ingenieur- und Planungsbüro Lange GbR Carl-Peschken-Str. 12 47441 Moers Umsetzungsfahrplan der Regionalen Kooperation PE_SWA_1400 Beteiligte Kooperationspartner Arbeitsgemeinschaft Wasserkraftwerke LVR - Rheinisches Amt für Denkmalpflege NRW e.V. Bezirksregierung Düsseldorf (Dezernat Landwirtschaftskammer NRW – 54/54.1/33) Bezirksstelle für Agrarstruktur Bezirksregierung Köln (Dezernat 54) NABU Kreisverband Heinsberg e.V. / Ortsgruppe Wegberg Biologische Station Krickenbecker Seen NABU Naturschutzstation e.V. Biologische Station Kreis Heinsberg Naturpark Schwalm-Nette BUND NRW Kreisgruppe Viersen Niederrhein Tourismus GmbH Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Niederrhein Energie und Wasser (NEW AG) Gemeinde Brüggen Rheinischer Fischereiverband e.V. Gemeinde Niederkrüchten Rheinischer Landwirtschaftsverband e.V. Kreisbauernschaft Krefeld – Viersen e.V. Gemeinde Schwalmtal Rheinischer Landwirtschaftsverband e.V. Kreisbauernschaft Neuss – Mönchengladbach e.V. Grundbesitzerverband NRW e.V. Rheinischer Mühlenverband e.V. Heinsberger Tourist-Service e.V. RWE Power AG Wasserwirtschaft – Langfrist.-und Entwicklungsplanung Kreis Heinsberg Schwalmtalwerke AöR Kreis Viersen Stadt Erkelenz Landesbüro der Naturschutzverbände Stadt Mönchengladbach NRW Landesgemeinschaft -

Press Release 4.7.2017
Press Release 4.7.2017 Page 1 of 2 More goods on the rails Contargo AG further expands its rail transports Basel, 4 July 2017 – On 3 July 2017, Contargo AG‘s first Basel- Kaldenkirchen Shuttle (BKS) completed the journey from Basel to Kaldenkirchen, North Rhine Westphalia (situated in Nettetal in the Viersen district). From now on, Contargo is offering this rail con- nection five times a week in both directions. Thus Contargo Süd is continuing to expand the share of handling to/from rail in its transactions, and supporting the policy of a modal transport shift in Switzerland. The BKS sets out daily both from Basel and from Kaldenkirchen, Mon- day to Friday, reaching its destination the next day. “In the BKS we have a fast, reliable connection for continental cargoes between Swit- zerland and the Ruhr area and the East Netherlands”, says Holger Bochow, Co-Managing Director of Contargo AG. “Our location in the Border Triangle functions as a hub, since the trailers can be sent on from here by rail or truck to other parts of Switzerland – but also to Germany or France, or even to Italy.” As well as the BKS, Contargo Süd offers five other rail connections in Basel: the trimodal Basel Multimodal Express (Basel/Weil – Em- merich), the Basel-Duisburg Shuttle (Basel/Weil – Duisburg), the Rhein Romandie Shuttle (Basel – Chavornay – Geneva), the Alfred Escher Shuttle (Basel – Dietikon – Gossau) and the ROCO Shuttle (Basel/Weil – Rotterdam and Antwerp). Contargo AG realises these rail products jointly with Contargo Rail Service as operator, i.e. they develop, organ- ise and market the lines themselves and take on the capacity utilisation risk. -

Flächennutzungsplan Erläuterungsbericht
22000044 EERRLLÄÄUUTTEERRUUNNGGSSBBEERRIICCHHTT FLÄCHENNUTZUNGSPLAN (Rechtswirksamkeit) 2004 04. Juni ERLÄUTERUNGSBERICHT FNP NETTETAL Flächennutzungsplan Erläuterungsbericht erstellt durch: PLANUNGSBÜRO B.M. WEGMANN STADTPLANUNG & ARCHITEKTUR ALMASTRASSE 8 45130 ESSEN TEL. 0201-777721 FAX 0201-777741 MAIL [email protected] WEB www.stadtplanung-bmwegmann.de FNP NETTETAL Inhaltsverzeichnis 1 Rahmenbedingungen und Grundlagen...................................7 1.1 Rechtliche Grundlage und Aufgabe der Flächennutzungsplanung............................................................7 1.2 Planungsanlass ..........................................................................9 1.2.1 Planungszeitraum................................................................................ 10 1.2.2 Verwendete Gutachten und Planungen ............................................. 10 1.3 Lage im Raum, regionale Verflechtungen .................................12 1.4 Historische Entwicklung ............................................................13 1.5 Naturräumliche Gegebenheiten ................................................14 1.5.1 Morphologie / Geologie....................................................................... 14 1.5.2 Klima..................................................................................................... 14 1.5.3 Ökologische Wertigkeiten................................................................... 15 1.6 Ziele der Raumordnung und Landesplanung ............................16 1.6.1 Landesentwicklungsplan -

Kalender-2020-Flowpaper.Pdf
Herzlich willkommen in Kaldenkirchen Hartelijk welkom in Kaldenkerken Guten Tag Goede dag liebe Leserinnen und Leser, beste lezers, herzlich Willkommen in Kaldenkirchen! Kal- hartelijk welkom in Kaldenkerken! „Kal- denkirchen Aktiv begrüßt Sie mit der neuen denkirchen Aktiv” begroet U wederom met Ausgabe unseres sehr beliebten Einkaufsrat- deze nieuwe uitgave van onze geliefde gebers einmal mehr in unserem bezaubern- inkoopbrochure van ons toverachtige den Städtchen. stadje. Nachdem wir mit der vorherigen Ausgabe Nadat wij met de vorige uitgave van onze unserer informativen Broschüre unsere 10. informatieve brochure onze tiende editie Auflage feiern durften, gilt es in diesem Jahr, mochten vieren, hebben we dit jaar weer ein weiteres großartiges Jubiläum hochleben een prachtig jubileum voor de boeg: de zu lassen. Di e Stadt Nettetal feiert ihren 50. stad Nettetal viert haar 50ste verjaardag Geburtstag, und alle Stadtteile feiern ein gan- en alle stadsdelen vieren een heel jaar lang zes Jahr lang mit! Zu diesen besonderen Ver- mee! Voor deze bijzondere evenementen anstaltungen und Aktionen laden wir Sie, en acties nodigen wij onze inwoners en liebe Mitbürger/-innen und Gäste herzlich gasten hartelijk uit. Informatie over de fees- ein. Informationen zu den Festen und die Ter- ten en de data vindt U in deze brochure en mine finden Sie im Innenteil dieser Broschüre dagelijks op www.nettetal50.de. Natuurlijk und tagesaktuell auf www.nettetal50.de. Na- zullen wij in Kaldenkerken de stad Nettetal türlich lassen auch wir in Kaldenkirchen die ter ere van dit 50ste jubeljaar met veel at- Stadt zu Ehren des 50. Jubeljahres mit vielen tractieve evenementen, georganiseerd in attraktiven Events hochleben – organisiert in samenwerking met de stad Nettetal en de Zusammenarbeit mit der Stadt Nettetal und plaatselijke verenigingen en instanties in de ortsansässigen Vereinen sowie Institutionen. -
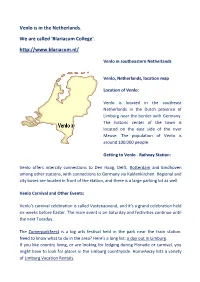
Venlo Is in the Netherlands. We Are Called 'Blariacum College'. Http
Venlo is in the Netherlands. We are called 'Blariacum College'. http://www.blariacum.nl/ Venlo in southeastern Netherlands Venlo, Netherlands, location map Location of Venlo: Venlo is located in the southeast Netherlands in the Dutch province of Limburg near the border with Germany. The historic center of the town is located on the east side of the river Meuse. The population of Venlo is around 100,000 people. Getting to Venlo - Railway Station: Venlo offers intercity connections to Den Haag, Delft, Rotterdam and Eindhoven among other stations, with connections to Germany via Kaldenkirchen. Regional and city buses are located in front of the station, and there is a large parking lot as well. Venlo Carnival and Other Events: Venlo's carnival celebration is called Vastenaovend, and it's a grand celebration held six weeks before Easter. The main event is on Saturday and festivities continue until the next Tuesday. The Zomerparkfeest is a big arts festival held in the park near the train station. Need to know what to do in the area? Here's a long list: a day out in Limburg. If you like country living, or are looking for lodging during Floriade or carnival, you might have to look for places in the Limburg countryside. HomeAway lists a variety of Limburg Vacation Rentals. Closest Airports: Venlo is served by the airports of Düsseldorf (Germany), Maastricht, Eindhoven and Weeze (Germany). Tourist Office: VVV Venlo: The address of the tourist office is Nieuwstraat 40-42, 5911 Venlo. It's open Monday through Friday from 10 am to 5:30 pm and Saturday from 10am to 5pm. -

Herzlich Willkommen in Der Freizeitregion Schwalm-Nette
A warm welcome to the Schwalm-Nette recreation area Dear guests, We are delighted to welcome you to the recreation area in the Schwalm-Nette Nature Reserve. You might be wondering why you don‘t have to pass through a gate or even a fence to reach us. The simple reason is that the Schwalm-Nette Nature Reserve is a region that has evolved naturally, one which is equally well known for its beautiful countryside with numerous lakes and rivers as for its historic buildings and countless recreational activities. Whether you are visiting for just a few hours or planning to spend your holiday here, one thing is certain – there’s no risk of you getting bored. Are you a keen cyclist? Our region is criss-crossed by a dense network of good cycle paths and farm lanes that are well away from busy roads and traffic. Or do you prefer to walk or hike through natural surroundings? Countless clearly marked routes run through the Schwalm-Nette recreation area – and since recently, their suitability for wheelchair users is indicated too. Our towns and districts, many of which have historic centres, are ideal for a stroll and a spot of shopping. Leave all your cares behind and relax for a while, enjoying a delicious cappuccino or savouring regional gastronomic specialities at one of the many local cafes and restaurants. If you would like to explore our region more fully, why not arrange to stay for a mini break – accommodation is available in all shapes and sizes, with something to suit everyone. -

Rheindahlen HIVE November 2010
Guide to Mönchengladbach Produced by Rheindahlen HIVE November 2010 DISCLAIMER ! The content of any brochure or advertisements displayed in the HIVE does not necessarily reflect the policies or the opinions of HM Government, The Ministry of Defence or Tri-Service HIVE. The accuracy of brochures displayed is not guaranteed ! ! ! CONTENTS Discover Mönchengladbach Page 3 Travel Information Page 3+4 Shopping Page 4 The Altstadt Page 4 Eating Out Page 5+6 Mostly Green Page 7 On Your Bikes Page 8 Breweries Page 9 Places of Interest Page 10 Useful Phone Numbers and Websites Page 11 DISCOVER MÖNCHENGLADBACH Mönchengladbach (MG) is a wonderful place to live. With its population of almost 270,000, it is the largest city to the left of the Lower Rhine. Its character derives from an attractive combination of urban flair and rural charm ±the city, with its many parks and woods, is also FDOOHGWKHµFLW\LQWKHFRXQWU\VLGH¶0|QFKHQJODGEDFKKDVso much more to offer; such as the arts and culture. There are important historical buildings, world famous museums, a UHQRZQHGWKHDWUHDQGDOLYHO\FDEDUHWDQGµOLWWOHDUWV¶VFHQH7KRVHZKROLNHVKRSSLQJQHHG look no further than Mönchengladbach which has many pedestrian precincts and shopping arcades which cater for all tastes. There are plenty of ways to get to know this city. In this booklet you will find a few suggestions on where to go and what to see for Art lovers, for shoppers for nature lovers and for night revellers too. This booklet is just an insight into places of interest you may wish to visit in Mönchengladbach. For further details and more ideas, check out the website: www.moenchengladbach.de TRAVEL INFORMATION The city can be reached quickly and easily via the excellent motorway, rail networks and by bus. -

1986 News-Caster (Top of Page 55)
THE CASTOR FAMILY ASSOCIATION OF AMERICA FAMILY ORIGINS We have started our newsletter each year with this article. It is a good intro- duction. We believe it is worth repeating for the benefit of the new members. Some updating occurs. There are several different origins of the Caster/Castor/Kaster/Kastor families. Some came to this country as Caster, Castor, Kaster or Kastor; and some came as something entirely different. For example, in 1736, Hans Georg Gerster and his wife, Eve Gisin, arrived in Philadelphia aboard the ship Princess Agusta which had come from Cowes, Isle of Wight, England. Hans was born 1710 in Basel, Switzerland. Hans and Eve married in 1735, and after their arrival in this country, they had a family of eight. Although their surname was Gerster, it was soon pronounced Gaster or Garster in this country, and was corrupted into Caster or Castor. By 1762, Hans had become John George Castor, and more frequently, George Castor. Most of his descendants carry the surname Castor, although some are Caster. Other Gerster families came to America in 1748, 1749, 1768, 1803, 1804 and 1805, and most of their descendants are today either Caster or Castor. And then there was John de Castorer who was born 1748 in New London, Connecticut. John married 1770 Anna Calkins, and they lived near Spencertown, New Your from where John enlisted in 1776 for the Revolutionary War. After the war, they moved to Redfield, New York, and later to Ellisburg, New York. Their surname shortened to Caster, and their nine children were styled either Caster or Castor. -

Introduction 3RX Investment Costs
Introduction Over the past two years a feasibility study has been carried out of the Rhein-Ruhr Rail Connection (3RX), a rail route between the North Sea Ports and the Rhein-Ruhr area in Germany. The study was commissioned by the Flemish Government and co-financed by the European Union. A steering committee, consisting of representatives from all five governments involved (i.e. The Netherlands, Germany, Belgium, Nordrhein-Westfalen and Flanders), has overseen the study. The study was carried out by the ARTECORAIL, a consortium of consultancy companies from all three countries. 3RX 3RX connects Antwerp (Belgium) with Mönchengladbach (Germany), via Lier and Mol (Belgium), Weert, Roermond, Venlo (all in The Netherlands) and Viersen (Germany). As the section Antwerp – Lier is common with the Montzen route, the study has concentrated on the section between Lier and Mönchengladbach. The 3RX is an alternative for revitalisation of the historical Iron Rhine route and for the previously studied A52 route and makes as much as possible use of existing rail infrastructure. The study compares the 3RX with these two alternatives. The 3RX concept was developed to expand capacity of the east-west rail routes, thereby supporting a modal shift policy towards rail. The 3RX not only relieves existing routes, such as the Montzen route, but also provides an alternative route in case one of the existing east-west rail routes would be temporarily unavailable; consequently, rail freight traffic on the East-West corridor will be more reliable. Investment costs The study has developed various options for each section of the 3RX route, assuming a design capacity of 72 trains per day (both ways), full electrification and state of the art safety systems. -

Naturpark Schwalm-Nette
Einband_NPSW_2.qxp_Gerlach 11.02.16 08:20 Seite 1 e d nd n a a l l 9 r ch e s d t e u i 58 WachtendonkWacWaWachchhthtehtendotenteendonkonk N De F 221 – Premium-WanderwegPrPPreree 40 – RadtourRRaad 67 N – e Extraroute/barrierefreiExExxttr t t Venlo e Kempen Das sollten Sie nicht verpassen: A Natur-NNaNatata und Umweltbildungszentrum/ Heimatmuseum Leudal 73 509 Tegelenegeggegeleelel n 5099 E B BeBBesBesucherzentrumees De Meinweg Steyleeyeylyyll HHiHinHinsbeckiinnsbnnssbbecbeb c GrefrathGrefefrarathh Gerlach Birgit Baarlo KaldKKaldenkirchenddeenenknkikircirc c en Oedt Elmpter Schwalmbruch 01 S. 7 C Naturpark-InformationsstelleNNatNat Burg Brüggen Nette Belfeldlfllfefefeelldld NettetalNetteNettetaNeN ttteettall D NaturparkzentrumNaNat Wildenrath ListZentrum 7 Das Libellenparadies in alter Moorlandschaft LobberichLobLoLLobbeobbbe E InfozentrumInfnfoo Krickenbecker Seen Vorst 221 BreyellBBreBreyeeyeyyeell Maas F Naturparkzentrum Wachtendonk im Haus Püllen 7 SüchtelnSüchteSSüchtüch ln ln BrachtBra achchhht Anrath 61 Borner See 03 S. 25 e d n a d Roggeloggggggegelell rl n e la d ie sch Die malerische Heimat von Fischotter Patschel t N u e Dülken Heythuysenseseen D BrüggenBBrügBrrüggeügggeggen Viersen NunhemNunununhemhe C A Swalmenmemenen Schwalm AmernAmAmmermeerrnn 2211 Molenplas 08 S. 61 Elmpt BremptB t 52 SchwalmtalS 2 Eine Insel in der Maas Roer- Niederkrüchten mond Mönchen- HaupHaHHauptquartieruuptqu uptquartiepptqptquartie q uuart rtierrtiier 221 gladbach Wassenberger Bergfried 10 S. 77 73 N ie Herkenboschrkkeennnbbbobosoossschsch -

Foreign-Owned Companies in the Mittlerer Niederrhein Region Contents | Publishing Information
Chamber of Commerce and Industry Mittlerer Niederrhein Krefeld | Moenchengladbach | Neuss | Viersen www.mittlerer-niederrhein.ihk.de International AT HOME: Foreign-owned companies in the Mittlerer Niederrhein region CONTENTS | PUBLISHING INFORMATION Contents | Publishing information 2 Key facts – the essentials at a glance 3 The Rhineland – an economic heavyweight 4 The Mittlerer Niederrhein region 6 In great company – business communities 8 Published by: Chamber of Commerce and Industry Mittlerer Niederrhein Authors | Editors: Manfred Meis I Meis-Medienservice, Nettetal Roland Meißner, Wolfram Lasseur, Jörg Raspe, Lutz Mäurer, Gregor Werkle I CCI Mittlerer Niederrhein Editor-in-chief: Roland Meißner Chamber of Commerce and Industry Mittlerer Niederrhein Managing Director International Department Phone: +49 2131 9268 540 I Fax: +49 2131 9268 549 Email: [email protected] Translation: United Language Services, Linsburg Design: 360 Grad Design, Ulrike Wiest, Krefeld Printed by: Scan+Proof elektronische Druckformen GmbH, Krefeld As at: March 2012 All the information provided in this brochure has been collated and drafted with the utmost care. Chamber of Industry & Commerce Mittlerer Niederrhein does not provide any guarantees in respect of the accuracy and completeness of the content nor is it liable for any interim changes. Reprints, even just extracts, are permitted only if the source is acknowledged. Specimen copy requested. 2 AT HOme: Foreign-owned companies in the Mittlerer Niederrhein region KEY FACTs – THE ESSENTIALS AT A GLANCE Out of a total of 78,790 corporate members of the Chamber of Commerce and Industry (CCI) Mittlerer Niederrhein, 7,162 or 9.1 percent are foreign-owned. Or put another way, 1 in 11 businesses is owned by a non-German or has non-German majority shareholders.