Jahrbuch Für Kulturpolitik 2009 Jahrbuch Für Kulturpolitik 2009 · Band 9 INSTITUT FÜR KULTURPOLITIK DER KULTURPOLITISCHEN GESELLSCHAFT E
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

9783791358291-Sample.Pdf
6 7 PREFACE This exhibition is devoted to two artists who shared ideas about art, and in the process helped Franz Marc, The First Animals, 1913, gouache create the movement known as Expressionism in early twentieth-century Germany. But it is really and pencil on paper. Private Collection about the power of friendship. Franz Marc and August Macke met as young artists in Munich in 1910. In the four years prior to Macke’s untimely death in 1914 (Marc himself died in 1916), they wrote each other scores of letters, visited each other’s homes, traveled together, and often discussed the development of their work. What grew out of this friendship were paintings and drawings of tremendous power, works that had the ability to challenge the primacy of French art in breaking boundaries and setting new directions. Seen side by side, the works seem to speak to each other, continuing this conversation even into the present day. I first came across an exhibition devoted to these two artists at the Kunstmuseum Bonn in 2014, a show that traveled to the Lenbachhaus in Munich. It was very moving to think about these artists, whose work I had long admired and collected, and to understand them as two young men finding their way in the world. I thought about the founding of the Neue Galerie New York, and how it had developed as a result of my friendship with the art dealer and curator Serge Sabarsky. What began as a series of freewheeling conversations about life and art eventually took root, and over the course of several years, the museum took shape. -
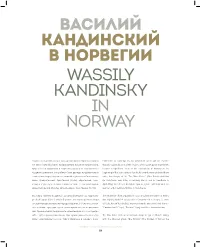
Василий Кандинский В Норвегии WASSILY KANDINSKY in Norway
василий кандинский в Норвегии WASSILY KANDINSKY in Norway Значительным событием в культурной жизни Норвегии начала Exhibitions of paintings by the prominent artist and art theorist ХХ века стали выставки произведений Василия Кандинского, Wassily Kandinsky, one of the leaders of the avant-garde movement, крупнейшего художника и теоретика, одного из лидеров аван- became a significant event in the cultural life of Norway at the гардного движения. Его работы были дважды представлены в beginning of the 20th century. Kandinsky’s works were exhibited there этой стране: в 1914 году на выставке объединения «Синего всад- twice, first in 1914 at the “Der Blaue Reiter” (Blue Rider) exhibition ника» (февраль–март, Христиания (Осло); апрель–май, Трон- (in Christiania, now Oslo, in February-March, and in Trondheim in хейм) и в 1916 году на совместной выставке с немецкой худож- April-May), and then in April-June 1916, at a joint exhibition with the ницей Габриэлой Мюнтер (апрель–июнь, Христиания (Осло)). German artist Gabriele Münter in Christiania. Выставка «Синего всадника», организованная в 1913 году гале- The Blue Rider show, organized in 1913 by Galerie Der Sturm in Berlin, реей «Штурм» («Der Sturm») в Берлине, в несколько измененном was slightly modified to tour other European cities. In 1914, it came составе путешествовала по городам Европы. В Осло она состоя- to Oslo; five of Kandinsky’s important works were exhibited there – лась в начале 1914 года, здесь экспонировалось пять программ- “Composition V” (1911), “Pastoral” (1913), and three improvisations. ных произведений Кандинского: «Композиция V», «Пастораль» (оба – 1911) и три импровизации. Круг художников «Синего всад- The Blue Rider circle of artists took shape in 1911 in Munich. -
Our History. Germany Since 1945
Our History. Germany since 1945 Guide through the exkhibition k k A Cordial Welcome to the Museum of Contemporary History of the Federal Republic p Our History. of Germany Germany since 1945 We invite you to tour the Permanent Exhibition – “Our History. Germany since 1945”. Spread over 4,000-plus square metres, it is a lively and up-to-date panorama of contemporary German history, with individual perspectives set in an inkternational context. It showcases original artefacts. There are many inter- active stations plus interviews with contemporary witnesses to escort you on your way from the end of the Second World War to the present. 1945 – 1949 Burden of the Past and Germany’s Division World War II, unleashed by Germany, ends with the surrender of the German armed forces on 8 May 1945. What remains is largely a traumatized and devastated country. The Allies occupy Germany and divide it into four zones. Many people are dead or missing; families are torn apart. The enormity of the Nazi crimes raises questions about accountability: Who knew, who shared the blame? But widespread public discussion doesn’t get started in Germany until the 1960s. The ravages of war and the country’s division have devastated the economy. Rationing is supposed to assure the distribution of basic supplies, but the black market is booming. In 1948 the deutschmark is introduced in the western zones, laying the groundwork for an economic upturn. The occupied zones grow apart politically and economically: In the west is born the Federal Republic of Germany, a parliamen - tary democracy; in the east the GDR, a coercive communist state modelled on the Soviet Union. -

Dossier Geschichte Und Erinnerung
Dossier Geschichte und Erinnerung bpb.de Dossier: Geschichte und Erinnerung (Erstellt am 23.09.2021) 2 Einleitung Debatten wie beispielsweise um das Denkmal für die ermordeten Juden Europas zeigen, wie gegenwärtig die Vergangenheit ist. Der Umgang mit der deutschen Geschichte wird auch in Zukunft Thema in Politik und Gesellschaft sein, wird Wissenschaft und Unterricht beschäftigen und auch in den Familien immer wieder diskutiert werden – denn Geschichte wird in jeder Generation neu erzählt. Und dies geschieht zunehmend auch als Medienereignis und lockt Millionen vor die Fernseher. Aber können Dokudramen und historische Spielfilme den Geschichtsunterricht ersetzen? Wie verändern die neuen Medien unser Bild von der Vergangenheit? Und wie vermittelt man Geschichte an die kommenden Generationen und an Jugendliche z.B mit polnischen oder türkischen Wurzeln? Das Dossier bietet einen Überblick über die Geschichte der Erinnerungskultur in beiden deutschen Staaten, blickt zurück auf vergangene Kontroversen und sucht nach Antworten, wie die Erinnerung in Zukunft aussehen könnte. Dabei geht es auch um die Frage, inwieweit nationale kollektive Erinnerungen von einem gemeinsamen europäischen oder transnationalen Gedächtnis abgelöst werden können. bpb.de Dossier: Geschichte und Erinnerung (Erstellt am 23.09.2021) 3 Inhaltsverzeichnis 1. Geschichte - Erinnerung - Politik 5 1.1 Gedächtnis-Formen 6 1.2 Politik mit Geschichte – Geschichtspolitik? 9 1.3 Geschichtsmythen und Nationenbildung 14 1.4 Mythen der Neutralität 18 1.5 Kollektives Gedächtnis 26 1.6 -

Mehr Mode Rn E Fü R D As Le N Ba Ch Ha Us Die
IHR LENBACHHAUS.DE KUNSTMUSEUM IN MÜNCHEN MEHR MEHR FÜR DAS MODERNE LENBACHHAUS LENBACHHAUS DIE NEUERWERBUNGEN IN DER SAMMLUNG BLAUER REITER 13 OKT 2020 BIS 7 FEB 2021 Die Neuerwerbungen in der Sammlung Blauer Reiter 13. Oktober 2020 bis 7. Februar 2021 MEHR MODERNE FÜR DAS LENBACHHAUS ie weltweit größte Sammlung zur Kunst des Blauen Reiter, die das Lenbachhaus sein Eigen nennen darf, verdankt das Museum in erster Linie der großzügigen Stiftung von Gabriele Münter. 1957 machte die einzigartige Schenkung anlässlich des 80. Geburtstags der D Künstlerin die Städtische Galerie zu einem Museum von Weltrang. Das herausragende Geschenk umfasste zahlreiche Werke von Wassily Kandinsky bis 1914, von Münter selbst sowie Arbeiten von Künstlerkolleg*innen aus dem erweiterten Kreis des Blauen Reiter. Es folgten bedeutende Ankäufe und Schen- kungen wie 1965 die ebenfalls außerordentlich großzügige Stiftung von Elly und Bernhard Koehler jun., dem Sohn des wichtigen Mäzens und Sammlers, mit Werken von Franz Marc und August Macke. Damit wurde das Lenbachhaus zum zentralen Ort der Erfor- schung und Vermittlung der Kunst des Blauen Reiter und nimmt diesen Auftrag seit über sechs Jahrzehnten insbesondere mit seiner August Macke Ausstellungstätigkeit wahr. Treibende Kraft Reiter ist keinesfalls abgeschlossen, ganz im KINDER AM BRUNNEN II, hinter dieser Entwicklung war Hans Konrad Gegenteil: Je weniger Leerstellen verbleiben, CHILDREN AT THE FOUNTAIN II Roethel, Direktor des Lenbachhauses von desto schwieriger gestaltet sich die Erwer- 1956 bis 1971. Nach seiner Amtszeit haben bungstätigkeit. In den vergangenen Jahren hat 1910 sich auch Armin Zweite und Helmut Friedel sich das Lenbachhaus bemüht, die Sammlung Öl auf Leinwand / oil on canvas 80,5 x 60 cm erfolgreich für die Erweiterung der Sammlung um diese besonderen, selten aufzufindenden FVL 43 engagiert. -

Die Marginale Repräsentation Sozialer Demokratie Im Kultur! Historischen Museum
ERINNERUNGSKULTUREN DER SOZIALEN DEMOKRATIE DIE MARGINALE REPRÄSENTATION SOZIALER DEMOKRATIE IM KULTUR! HISTORISCHEN MUSEUM Arbeitspapier aus der Kommission „Erinnerungskulturen der sozialen Demokratie“ Wolfgang Jäger – August 2021 HERMANN HELLER GLEICHHEIT TARIFVERTRAG SOZIALE BEWEGUNGEN SOLIDARITÄT ROSA LUXEMBURG MIGRATION HANS BÖCKLER LIEUX DE MEMOIRE ERINNERUNGSPOLITIK BREUNING FRITZ NAPHTALI ! ARBEITERBEWEGUNG GUSTAV BAUER THEODOR LOHMANN LOUISE OTTO!PETERS FRAUENBEWEGUNG CARL LEGIEN EDUARD BERNSTEIN STREIK BÜRGERLICHE SOZIALREFORM MITBESTIMMUNG CLARA ZETKIN OSWALD VON NELL VON OSWALD GEWERKSCHAFTEN HEINRICH BRAUNS LUJO BRENTANO MEMORY STUDIES MEMORY Wolfgang Jäger, Dr. phil., ist Research Fellow am Institut für soziale Bewe- gungen und Lehrbeauftragter der Ruhr-Universität Bochum. Von 2004 bis 2017 war er Geschäftsführer der Hans-Böckler-Stiftung. Zu seinen aktuellen Publikationen zählen: Mitbestimmung im Zeichen von Kohle und Stahl. De- batten um die Montanmitbestimmung im nationalen und europäischen Kon- text, hrsg. mit Karl Lauschke und Jürgen Mittag (2020); Gewerkschaften in revolutionären Zeiten. Deutschland in Europa 1917 bis 1923, hrsg. mit Stefan Berger und Anja Kruke (2020); Soziale Bürgerrechte im Museum. Die Re- präsentation sozialer Demokratie in neun kulturhistorischen Museen (2020); Soziale Sicherheit statt Chaos. Beiträge zur Geschichte der Bergarbeiterbe- wegung an der Ruhr (2018). Online ist er bei Twitter (@dr_wjaeger) und Fa- cebook (drwjaeger) zu finden. Zu dieser Publikation Auf Initiative der Hans-Böckler-Stiftung -

The Blue Rider
THE BLUE RIDER 55311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd 1 222.04.132.04.13 111:091:09 2 55311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd 2 222.04.132.04.13 111:091:09 HELMUT FRIEDEL ANNEGRET HOBERG THE BLUE RIDER IN THE LENBACHHAUS, MUNICH PRESTEL Munich London New York 55311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd 3 222.04.132.04.13 111:091:09 55311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd 4 222.04.132.04.13 111:091:09 CONTENTS Preface 7 Helmut Friedel 10 How the Blue Rider Came to the Lenbachhaus Annegret Hoberg 21 The Blue Rider – History and Ideas Plates 75 with commentaries by Annegret Hoberg WASSILY KANDINSKY (1–39) 76 FRANZ MARC (40 – 58) 156 GABRIELE MÜNTER (59–74) 196 AUGUST MACKE (75 – 88) 230 ROBERT DELAUNAY (89 – 90) 260 HEINRICH CAMPENDONK (91–92) 266 ALEXEI JAWLENSKY (93 –106) 272 MARIANNE VON WEREFKIN (107–109) 302 ALBERT BLOCH (110) 310 VLADIMIR BURLIUK (111) 314 ADRIAAN KORTEWEG (112 –113) 318 ALFRED KUBIN (114 –118) 324 PAUL KLEE (119 –132) 336 Bibliography 368 55311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd 5 222.04.132.04.13 111:091:09 55311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd 6 222.04.132.04.13 111:091:09 PREFACE 7 The Blue Rider (Der Blaue Reiter), the artists’ group formed by such important fi gures as Wassily Kandinsky, Franz Marc, Gabriele Münter, August Macke, Alexei Jawlensky, and Paul Klee, had a momentous and far-reaching impact on the art of the twentieth century not only in the art city Munich, but internationally as well. Their very particular kind of intensely colorful, expressive paint- ing, using a dense formal idiom that was moving toward abstraction, was based on a unique spiritual approach that opened up completely new possibilities for expression, ranging in style from a height- ened realism to abstraction. -

AVALANCHE SI 2012 English
AVALANCHE® SI the art of neuromonitoring the art of neuromonito the first impression It is the first impression that counts, as it captures the imagination and whets the appetite for more. Technology stimulates emotions just as electrifying as those inspired by the arts. Outstanding design, paired with unrivalled functionality, is the hallmark of our neuro- monitors. Let us inspire you! AVALANCHE® SI oring the art of neuromonitoring taken from real life Straightforward, intuitive operation User interfaces tailor-made for specific applications When watching surgeons at work, we realized that what they need are neuro- monitors that are intuitive to operate and do not require extensive training. It is up to us to ensure that learning to operate the system is child's play, while preventing accidental errors. The rest is left to you … AVALANCHE® SI Compact design suited to all applications Upgradable modular system As far as neuromonitors are concerned, we have been extraordinarily single-minded. Our first AVALANCHE® model was intro- duced in 2003 and has become a runaway success. Many things have been simplified and streamlined since, but the underlying idea has remained unchanged - the ability of a single portable device to handle a wide range of tasks. We are still leading the pack - worldwide! AVALANCHE® SI the art of neuromonitoring the connecting idea the art AVALANCHE® SI of neuromonitoring the finishing touch Outstanding quality made in Germany Reliable customer service Just like a violin that will only produce its rich sound if expertly touched with a well- prepared bow, our monitors will produce reliable, meaningful signals if used in com- bination with our high-quality accessories. -

National Museums in Germany: Anchoring Competing Communities Peter Aronsson & Emma Bentz
Building National Museums in Europe 1750-2010. Conference proceedings from EuNaMus, European National Museums: Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen, Bologna 28-30 April 2011. Peter Aronsson & Gabriella Elgenius (eds) EuNaMus Report No 1. Published by Linköping University Electronic Press: http://www.ep.liu.se/ecp_home/index.en.aspx?issue=064 © The Author. National Museums in Germany: Anchoring Competing Communities Peter Aronsson & Emma Bentz Summary From 1760-2010, Germany has been marked by several levels of nation-building as well as many different ideological and territorial projects. This inquiry has focused on processes of long continuity, spanning unification in both the nineteenth and twentieth centuries, adding the most important ruptures and institutional inventions to get a firm-enough basis for conclusions on the institutional role of museums vis-a-vis the state-making process. The most significant periods for the interaction between museums and nation-building can be labelled 1. The struggle, leading to Germany’s unification in 1871, where several regions made their bids through museums. 2. Imperial unity on display from 1871-1914. National museums were stabilizing and universalizing the German Empire in the world. 3. Nazi cultural policy, 1933-1945: Comprehensive museum plans for the Third Reich. 4. GDR (German Democratic Republic) national museums between 1949-1990 were dominated by the ideology of socialist culture. 5. The Federal republic, before and after 1990: inscribing Nazi and GDR as pasts contained within brackets. Germany’s history is marked by the processes of unification meeting dissociative forces resulting in dramatic political shifts and the persistence of a complex federal structure. -

Der Blaue Reiter Und Das Neue Bild. Von Der „Neuen Künstlervereinigung München" Zum „Blauen Reiter", Hrsg
380 Journal für Kunstgeschichte 4, 2000, Heft 4 Der Blaue Reiter und das Neue Bild. Von der „Neuen Künstlervereinigung München" zum „Blauen Reiter", Hrsg. Annegret Hoberg und Helmut Friedei; IMünchen: Prestel 1999; 400 S., zahl. Abb.; ISBN 3-7913-2065-3; DM 98,- An Publikationen über den „Blauen Reiter", die wahrscheinlich populärste Forma tion avantgardistischer Künstler in Deutschland vor 1914, mangelt es nicht. Die noch immer grundlegende, von Klaus Lankheit bereits 1965 besorgte dokumentarische Neuausgabe des Almanachs wird regelmäßig nachgedruckt 1, und ergänzend dazu hat sich insbesondere die wahrhaft voluminöse Quellensammlung von Andreas Hüneke , „Der Blaue Reiter - Dokumente einer geistigen Bewegung", bewährt12. Erst 1996 und 1998 befaßten sich zwei vielbeachtete, jeweils von großen Katalogen beglei tete Ausstellungen mit dem Thema - „Von der drücke 7 zum ,Blauen Reiter'" im Dortmunder Museum am Ostwall und ,„Der Blaue Reiter' und seine Künstler" im Berliner Brücke-Museum (letztere war von Januar bis März 1999 auch in der Tübin ger Kunsthalle zu sehen)3. Die Städtische Galerie im Lenbachhaus München, die in der deutschen Museumslandschaft geradezu zum Synonym für den „Blauen Reiter" geworden ist, hat ihre wunderbaren, in dieser Dichte und Qualität einmaligen Bestände in zwei umfangreichen Bildbänden dargestellt 4 . *Rosel G olleks zuerst 1982 veröffentlichter Sammlungskatalog mit dem Titel „Der Blaue Reiter im Lenbachhaus München" leistet die wissenschaftliche Grundlagenarbeit und dokumentiert minu tiös die von den einzelnen Künstlern jeweils vorhandenen Werke oder Werkgruppen, während das 1991 erschienene Buch mit dem selben Titel das Thema mit einem ein führenden Essay des Herausgebers Armin Zweite sowie Bildkommentaren von Annegret Hoberg zu ausgewählten Hauptwerken auf eindrucksvolle Weise zugleich präzise und publikumsgerecht aufbereitet. -

The Blue Rider
THE BLUE RIDER 55311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd 1 222.04.132.04.13 111:091:09 2 55311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd 2 222.04.132.04.13 111:091:09 HELMUT FRIEDEL ANNEGRET HOBERG THE BLUE RIDER IN THE LENBACHHAUS, MUNICH PRESTEL Munich London New York 55311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd 3 222.04.132.04.13 111:091:09 55311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd 4 222.04.132.04.13 111:091:09 CONTENTS Preface 7 Helmut Friedel 10 How the Blue Rider Came to the Lenbachhaus Annegret Hoberg 21 The Blue Rider – History and Ideas Plates 75 with commentaries by Annegret Hoberg WASSILY KANDINSKY (1–39) 76 FRANZ MARC (40 – 58) 156 GABRIELE MÜNTER (59–74) 196 AUGUST MACKE (75 – 88) 230 ROBERT DELAUNAY (89 – 90) 260 HEINRICH CAMPENDONK (91–92) 266 ALEXEI JAWLENSKY (93 –106) 272 MARIANNE VON WEREFKIN (107–109) 302 ALBERT BLOCH (110) 310 VLADIMIR BURLIUK (111) 314 ADRIAAN KORTEWEG (112 –113) 318 ALFRED KUBIN (114 –118) 324 PAUL KLEE (119 –132) 336 Bibliography 368 55311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd 5 222.04.132.04.13 111:091:09 55311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd311_5312_Blauer_Reiter_s001-372.indd 6 222.04.132.04.13 111:091:09 PREFACE 7 The Blue Rider (Der Blaue Reiter), the artists’ group formed by such important fi gures as Wassily Kandinsky, Franz Marc, Gabriele Münter, August Macke, Alexei Jawlensky, and Paul Klee, had a momentous and far-reaching impact on the art of the twentieth century not only in the art city Munich, but internationally as well. Their very particular kind of intensely colorful, expressive paint- ing, using a dense formal idiom that was moving toward abstraction, was based on a unique spiritual approach that opened up completely new possibilities for expression, ranging in style from a height- ened realism to abstraction. -

Der "Blaue Reiter" A
15 Der "Blaue Reiter" A er "Blaue Reiter" war ursprünglich ein Buch Die beiden Redakteure, der Russe Wassily Dtitel, der später auch auf Ausstellungen über• Kandinsky (1866 -1944) und der Münchner Franz tragen wurde. Eine feste Gruppe oder eine Ver Mare (1880 -1916) bildeten den Kern des Kreises einigung unter diesem Namen gab es nie. Den um den "Blauen Reiter". Sie hatten sich Ende noch bringt man mit ihm einen Kreis von gleich 1910 kennengelernt, nachdem sich Mare für die gesinnten Künstlern in Verbindung, die sich um Ausstellung der "Neuen Künstlervereinigung Wassily Kandinsky und Franz Mare scharten. Da München" begeistert geäußert hatte und im Ja beide jedoch nach größtmöglicher Freiheit streb nuar 1911 der Gruppe beigetreten war. Kan ten, wollten sie genau das vermeiden, was sie zu dinsky, spiritus rector der Münchner Künstler• vor schmerzlich in der "Neuen Künstlervereini• gruppe "Phalanx" und der "Neuen Künstlerverei• gung München" erfahren hatten: sie wollten keine nigung München" brachte erstmals frischen inter Satzungen, keine Verbindlichkeiten, also auch nationalen Geist nach München. Sein künstle• keine Gruppe: " ... ein neuer, neuster, allerneuster rischer Weitblick führte wenig später in die Ab Verein? Doch nicht! Eine wirklich freie, cliquen straktion, einer Kunst, die nicht mehr auf der Re lose, internationale (hoho!) Zeitschrift, ... " produktion der Wirklichkeit beruhte, sondern schrieb Kandinsky an Kubin. 1 Mit ihrer Auswahl die das naturunabhängige Bild zum Gegenstand der im Almanach und in den Ausstellungen ge des Ausdrucks erhob. Der wesentlich jüngere zeigten Künstler boten sie eine große Vielfalt und Mare war ebenfalls auf der Suche nach der "inne hohe Internationalität, was eher zu Heteroge ren Wahrheit" der Kunst, die er nicht mehr im nität als zu einer erkennbaren Gemeinsamkeit reinen Abbilden der äußeren Umwelt sah.