Formatvorlage Für Wissenschaftliche Arbeiten
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Karl Plagge Ein Gerechter Unter Den Völkern
Karl Plagge Ein Gerechter unter den Völkern – Begleitheft zur Ausstellung – Herausgegeben von der Darmstädter Geschichtswerkstatt e.V. Ausstellungsinformationen / Impressum Ausstellungsinformationen: KARL PLAGGE, ein „Gerechter unter den Völkern“ Ausstellung herausgegeben vom Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt. Ein Projekt der Darmstädter Geschichtswerkstatt e.V. Unterstützt von: Vilna Gaon Jewish State Museum (Vilnius), Studienkreis Deutscher Wider- stand 1933–1945 (Frankfurt a.M.), Hilfsfonds Jüdische Sozialstation e.V. (Freiburg i.Br.). Finanziell gefördert durch die Stadtsparkasse Darmstadt und weitere Spenden. Verantwortlich für den Inhalt der Ausstellung: Hannelore Skroblies und Christoph Jetter. Gestaltung der Ausstellung: archetmedia Darmstadt GbR (www.archetmedia.de). Druck der Ausstellungstafeln: roboplot Darmstadt (www.roboplot.de). Informationen: www.darmstaedter-geschichtswerkstatt.de Kontakt: [email protected] Die Ausstellung besteht aus: 6 Ausstellungstafeln 2 x 1 m, doppelseitig bedruckt, mit der Auf- stellungstechnik aufbewahrt in einer transportablen Kiste; benötigter Raum: mindestens 5 x 10 m. Die Ausleihe für Darmstädter Schulen und Bildungseinrichtungen bei Selbstabholung ist kostenlos, Ausleihe für andere Einrichtungen gegen Kaution. Vormerkung und Ausleihe über: Ludwig-Georgs-Gymnasium Darmstadt (Telefon: 06151-132562 – E-Mail: [email protected]). Impressum: Begleitheft zur Ausstellung „KARL PLAGGE, ein Gerechter unter den Völkern.“ Herausgegeben von der Darmstädter Geschichtswerkstatt -

Schoen Consulting Claims Conference Holocaust Topline – AUSTRIA, US, CANADA March 2019 Screening Questions
Schoen Consulting Claims Conference Holocaust Topline – AUSTRIA, US, CANADA March 2019 Screening Questions United States Canada Austria • {Age} 18 and older 100% Under 18 [TERMINATE] --1 General Awareness - Open Ended Questions Intro: Thank you for your participation in this survey. The next questions in the survey are about a particular historical topic – the Holocaust. These questions don’t have right or wrong answers, so please be as honest and open as you can. 1. Have you ever seen or heard the word Holocaust before? Yes, I have definitely heard about the 89% 85% 87% Holocaust Yes, I think I’ve heard about the Holocaust 7% 9% 9% No, I don’t think I have heard about the 3% 3% 2% Holocaust No, I definitely have not heard about the 1% 3% 2% Holocaust IF NO, SKIP TO Q9 2. In your own words, what does the term Holocaust refer to? OPEN ENDED WITH PRECODES (MULTIPLE ANSWERS ACCEPTED) Extermination of the Jews/Jewish people 62% 64% 58% Genocide generally 18% 19% 27% World War II 4% 32% 16% The Nazis 3% 24% 7% Adolf Hitler 3% 15% 6% Other 14% 8% 15% Not sure 3% 4% 5% 1 Throughout this document “--” indicates no response while a “blank space” indicates that the question or answer choice was not asked in that specific country. Schoen Consulting Claims Conference Holocaust Topline – AUSTRIA, US, CANADA March 2019 United States Canada Austria 3. Who or what do you think caused the Holocaust? OPEN ENDED WITH PRECODES (MULTIPLE ANSWERS ACCEPTED) Adolf Hitler 83% 48% 39% The Nazis 67% 19% 21% Jews 10% 3% 8% World War I 6% 3% 4% Germany 36% 12% 2% Antisemitism -- -- 2% Other 1% 18% 19% Not sure 4% 8% 6% 4. -

Jahrbuch 2009
www.doew.at Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (Hg.) JAHRBUCH 2009 Schwerpunkt Bewaffneter Widerstand Widerstand im Militär Redaktion: Christine Schindler Wien: LIT Verlag 2009 Inhalt – Jahrbuch 2009 www.doew.at Heinz Fischer, Festvortrag anlässlich der Jahresversammlung des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes, Wien, 13. März 2008 7 Schwerpunkt Bewaffneter Widerstand – Widerstand im Militär Wolfgang Neugebauer Bewaffneter Widerstand – Widerstand im Militär. Ein Überblick 12 Thomas Geldmacher Täter oder Opfer, Widerstandskämpfer oder Feiglinge? Österreichs Wehrmachtsdeserteure und die Zweite Republik 37 Stephan Roth Widerstand in der Wehrmacht am Beispiel der Artillerie-Ersatz- und Ausbildungsabteilung 109 60 Barbara Stelzl-Marx Carl Szokoll und die Operation „Radetzky“. Militärischer Widerstand in Wien 1945 im Spiegel sowjetischer Dokumente 95 Peter Pirker „Whirlwind“ in Istanbul. Geheimdienste und Exil-Widerstand am Beispiel Stefan Wirlandner 114 Irene Filip Frauen bei den Internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg 137 Inhalt Helena Verdel – Jahrbuch 2009 www.doew.at Widerstand der Kärntner Sloweninnen 145 Josef Vogl Ein Österreicher, der nur seine Pflicht getan hat. Markus Käfer und seine MitstreiterInnen im Kärntner Lavanttal 159 Brigitte Halbmayr „Das war eine Selbstverständlichkeit, dass wir da geholfen haben.“ Die Fallschirmagenten Albert Huttary und Josef Zettler und ihre UnterstützerInnen – ein Fallbeispiel 176 Heimo Halbrainer Erinnerungszeichen für PartisanInnen in der Steiermark -

Reichskommissariat Ostland from Wikipedia, the Free Encyclopedia
Create account Log in Article Talk Read Edit View history Reichskommissariat Ostland From Wikipedia, the free encyclopedia "Ostland" redirects here. For the province of the Empire in Warhammer 40,000, see Ostland (Warhammer). Navigation Reichskommissariat Ostland (RKO) was the civilian occupation regime established by Main page Germany in the Baltic states (Estonia, Latvia, and Lithuania), the north-eastern part of Reichskommissariat Ostland Contents Poland and the west part of the Belarusian SSR during World War II. It was also known Reichskommissariat of Germany Featured content [1] initially as Reichskommissariat Baltenland ("Baltic Land"). The political organization Current events ← → for this territory—after an initial period of military administration before its establishment— 1941–1945 Random article was that of a German civilian administration, nominally under the authority of the Reich Donate to Wikipedia Ministry for the Occupied Eastern Territories (German: Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete) led by Nazi ideologist Alfred Rosenberg, but was in reality Interaction controlled by the Nazi official Hinrich Lohse, its appointed Reichskommissar. Help The main political objective, which the ministry laid out in the framework of National Flag Emblem About Wikipedia Socialist policies for the east established by Adolf Hitler, were the complete annihilation Community portal of the Jewish population and the settlement of ethnic Germans along with the expulsion or Recent changes Germanization of parts of the native population -

Schulmaterial Zum Film Von Christian Frosch
Schulmaterial zum Film von Christian Frosch 1! INHALTSVERZEICHNIS Vorwort | Impressum..............................................3 Stab.............................................................4 Synopsis.........................................................5 Christian Frosch im Interview über MURER.........................6 GLOSSAR| Murer ..................................................9 Nationalsozialismus | Täter & Opfer.............................10 Vergangenheitsbewältigung | Recht & Gerechtigkeit...............13 FACT SHEETS | Franz Murer und seine Umfeld......................17 Inszenierung | Kamera | Musik...................................21 Arbeitsaufgaben.................................................23 Christian Frosch | Biografie, Filmografie.......................26 Ergänzungen | Material und Literatur............................27 2! VORWORT „Nicht die Erinnerung, sondern das Vergessen ist und bleibt die wahre Gefahr.“ (Primo Levi) Dieser Film lässt niemanden kalt. Regisseur Christian Frosch nimmt die ZuseherInnen mit auf Zeitreise. Mit Murer nehmen wir im Gerichtsaal Platz, hören die Verteidigung des Angeklagten, das Leid der Zeugen, das dramatische Plädoyer des Anwalts und das zwiespältige Urteil der Geschworenen. Dabei hinterfragt Christian Frosch nicht nur kritisch den Charakter Franz Murer, sondern auch den der politischen Parteien und Medien. Wie, so fragt mensch sich, kann ein Täter zum Opfer werden und die Opfer zu zweifelhaften ZeugInnen. Die ZuseherInnen bleiben betroffen zurück: Recht und Gerechtigkeit -
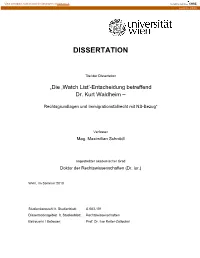
Dissertation
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by OTHES DISSERTATION Titel der Dissertation „Die ‚Watch List‘-Entscheidung betreffend Dr. Kurt Waldheim – Rechtsgrundlagen und Immigrationsfallrecht mit NS-Bezug“ Verfasser Mag. Maximilian Schnödl angestrebter akademischer Grad Doktor der Rechtswissenschaften (Dr. iur.) Wien, im Sommer 2010 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 083-101 Dissertationsgebiet lt. Studienblatt: Rechtswissenschaften Betreuerin / Betreuer: Prof. Dr. Ilse Reiter-Zatloukal Meinen Eltern. INHALTSVERZEICHNIS Abkürzungsverzeichnis (Begriffe und Literatur) 9 1. Abkürzungsverzeichnis (Begriffe) 9 2. Abkürzungsverzeichnis (Literatur) 11 Abbildungsverzeichnis 14 Danksagung 15 I. Beschreibung des Forschungsprojekts sowie seiner Methoden 17 1. Die Forschungsfrage(n) 17 2. Forschungsstand und Quellenlage 18 A. Die Watch List-Entscheidung im Lichte der 1987 geltenden Rechtslage 18 B. Die Watch List-Entscheidung im Lichte der von 1987 bis 2007 geltenden Rechtslage 21 C. Rechtsvergleichende bzw. rechtsphilosophische Aspekte 22 3. Angewendete Forschungsmethoden 22 4. Struktur der Arbeit 23 II. Inhaltliche Einführung 25 1. Vorbemerkungen 25 2. Registrierungsmechanismen und Übereinkommen der Alliierten 25 A. Initiale Konzeptionen 25 B. Die United Nations War Crimes Commission 26 C. Das Central Registry of War Criminals and Security Suspects 28 D. Die Moskauer Deklaration und ihre Folgen 28 3. Relevante internationale Rechtsvorschriften in Kurt Waldheims Fall 30 A. Die Nürnberger Charta 30 B. Das Kontrollratsgesetz Nr. 10 30 4. Exkurs: Gesetzeslage und Gerichtspraxis in Österreich ab 1945 32 A. Einführung 32 B. Rechtspolitische Zielsetzungen im Jahr 1945 32 C. Umsetzung der 1945 geschaffenen Gesetzesbestimmungen 34 D. Konsolidierung der Entnazifizierungsbemühungen 35 E. Die ab 1948 geschaffenen Amnestiebestimmungen 38 F. Weiterentwicklung der NS-Judikatur nach 1955/57 39 III. -
S: I. M. O. N. Shoah: Intervention
01/2020 S: I. M. O. N. SHOAH: INTERVENTION. METHODS. DOCUMENTATION. S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods. DocumentatiON. S:I.M.O.N. is the open-access e-journal of the Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies (VWI). It is committed to immediate open access for academic work. S: I.M.O.N. serves as a forum for discussion of vari- ous methodological approaches. The journal especially wishes to strengthen the exchange between researchers from different scientific communities and to integrate both the Jewish history and the history of the Holocaust into the different ‘national’ narratives. It also lays a special emphasis on memory studies and the analysis of politics of memory. The journal operates under the Creative Commons Licence CC-BY-NC-ND (Attribution- Non Commercial-No Derivatives). The copyright of all articles remains with the author of the article. The copyright of the layout and design of articles remains with S:I.M.O.N. Articles can be submitted in German or English. S:I.M.O.N. ist das Open-Access-E-Journal des Wiener Wiesenthal Instituts für Holocaust-Studien (VWI). Es setzt sich für einen sofortigen offenen Zugang zur wissenschaftlichen Arbeit ein. S:I.M.O.N. dient als Diskus- sionsforum für verschiedene methodische Ansätze. Die Zeitschrift möchte insbesondere den Austausch zwi- schen ForscherInnen aus unterschiedlichen Forschungszusammenhängen stärken und sowohl die jüdische Geschichte als auch die Geschichte des Holocaust in die verschiedenen „nationalen“ Erzählungen integrieren. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auch auf Ansätzen der Memory Studies und der Analyse der Geschichts- politik. Die Zeitschrift arbeitet unter der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND. -

MURER Anatomie Eines Prozesses
MURER Anatomie eines Prozesses von Christian Frosch Dramaturg Olaf Winkler Juristische Fachberatung Dr. Gabriele Pöschl Übersetzung Jiddisch/Hebräisch Tirza Lemberger Fassung 7.1 26.03.2017 © Prisma Film- und Fernsehproduktion GmbH © Paul Thiltges Distributions Rathausstrasse 3/18 27, zone industrielle A-1010 Wien L-8287 Kehlen (Luxembourg) Tel. +43 1 406 37 70 Tel. +352 250393 [email protected] [email protected] www.prismafilm.at www.ptd.lu 1. BÜRO WIESENTHAL INNEN/TAG Detail - man sieht, wie Frauenhände geschickt ein Tonband in ein tragbares Gerät einlegen. Im Hintergrund Off das Stimmen von Streichinstrumenten. SIMON WIESENTHAL (OFF) Sie schreiben für eine amerikanische Zeitung und sprechen Deutsch? ROSA SEGEV (OFF) Meine Familie ist 33 aus Deutschland emigriert. Zuerst London und dann in die Staaten. Bitte, Herr Wiesenthal… SIMON WIESENTHAL (OFF) 1,2,3,4,5. Sprechprobe Das Band spannt sich. Die Räder beginnen sich zu drehen. Es erklingen Streicher. 2. HOFBURG INNEN/TAG Ein Streichquartett spielt ein Potpourri aus Johann Strauß Walzern. Im Festsaal sitzt eine kleine Gruppe erlauchter Gäste. Auf dem Ehrenplatz das dänische Königspaar Frederik und Inge. Die Kamera streift über die Gäste hinaus in den Flur. 2A. HOFBURG – TOILETTENVORRAUM INNEN/TAG Eine Klofrau wippt zu der Melodie und blickt zum Toiletteneingang. Im Waschraum vor der Toilette steht MINISTER BRODA (48) und kontrolliert den Windsorknoten seiner Krawatte. Da sieht er im Spiegel ROBERT WALLNER (61). Im Gegensatz zum urbanen Broda trägt Wallner eine Festtracht. Wallner wäscht sich die Hände. WALLNER Herr Minister… Broda nimmt den Ball auf und antwortet grinsend, jede Silbe überdeutlich artikulierend. BRODA (IRONISCH) Herr Bauernbundpräsident... 2 Wallner grinst. -

Plunder of Jewish Property in the Nazi-Occupied Areas of the Soviet Union
Plunder of Jewish Property in the Nazi-Occupied Areas Of the Soviet Union Yitzhak Arad One of the by-products of the mass murder of the Jews in the Nazi- occupied areas of the Soviet Union between 1941 and 1944, was the confiscation and plunder of their property. This also fit into the broader policy of the Nazi exploitation of slave labor and economic resources in the occupied territories for the benefit of the German war economy. The aim was to supply the needs of the German armies in combat on the Eastern Front and of the German administration and its institutions in the occupied zones, and to help meet the essential needs of the population in Germany proper for agricultural produce. Due to the prevailing conditions in the Soviet Union, the murder and plunder of the Jews there differed from the murder in other German occupied countries. Soviet Jews were murdered at killing pits near their homes, and not in distant extermination camps. Consequently, all their money, valuables and other property were left on the spot at the disposal of the local authorities. Another significant difference lay in the concept of “private property” in a communist state including the property belonging to the individual Jew, which was different from the property kept by Jews in capitalist countries occupied by Nazi Germany. An array of German authorities operated in the occupied Soviet territories: the Wehrmacht and military administration, various SS formations, and the German civil administration. As a result, jurisdictional competition and the question of who rightfully “controlled” confiscated Jewish property were distinctive features associated with this pillage. -

Tracing and Documenting Nazi Victims Past and Present Arolsen Research Series
Tracing and Documenting Nazi Victims Past and Present Arolsen Research Series Edited by the Arolsen Archives – International Center on Nazi Persecution Volume 1 Tracing and Documenting Nazi Victims Past and Present Edited by Henning Borggräfe, Christian Höschler and Isabel Panek On behalf of the Arolsen Archives. The Arolsen Archives are funded by the German Federal Government Commissioner for Culture and the Media (BKM). ISBN 978-3-11-066160-6 eBook (PDF) ISBN 978-3-11-066537-6 eBook (EPUB) ISBN 978-3-11-066165-1 ISSN 2699-7312 This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial NoDerivatives 4.0 License. For details go to http://creativecommons.org/licens-es/by-nc-nd/4.0/. Library of Congress Control Number: 2020932561 Bibliographic Information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available on the Internet at http://dnb.dnb.de. © 2020 by the Arolsen Archives, Henning Borggräfe, Christian Höschler, and Isabel Panek, published by Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston Cover image: Jan-Eric Stephan Printing and binding: CPI books GmbH, Leck www.degruyter.com Preface Tracing and documenting the victims of National Socialist persecution is atopic that has receivedlittle attention from historicalresearch so far.Inorder to take stock of existing knowledge and provide impetus for historicalresearch on this issue, the Arolsen Archives (formerlyknown as the International Tracing Service) organized an international conferenceonTracing and Documenting Victimsof Nazi Persecution: Historyofthe International Tracing Service (ITS) in Context. Held on October 8and 92018 in BadArolsen,Germany, this event also marked the seventieth anniversary of search bureaus from various European statesmeet- ing with the recentlyestablished International Tracing Service (ITS) in Arolsen, Germany, in the autumn of 1948. -

Diplomarbeit
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by OTHES Diplomarbeit Titel der Diplomarbeit „Österreicher“ in den SS-Einsatzgruppen und SS-Brigaden Die Vernichtungsaktionen in den besetzten Gebieten der Sowjetunion 1941-1942 Verfasser Josef Fiala angestrebter akademischer Grad Magister der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 2009 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 312 Studienrichtung lt. Studienblatt: Geschichte Betreuer: Univ.-Prof. Dr. Arnold Suppan 2 3 Isabell, Gerhard und Heidi gewidmet 4 5 Inhaltsverzeichnis: Seite Einleitung 9 I. Allgemeine Organisation der SS und des SD 13 1.1. Wer wird in SS-Brigaden gezwungen 15 1.2. Die Führer im Reichssicherheitshauptamt 19 1.3. Erste Einsatzgruppen in Polen 22 1.4. Verbrecherische Befehle 26 1.4.1. Der Kriegsgerichtsbarkeitserlass 26 1.4.2. Der Kommissarbefehl 30 1.5. Die Einsatzgruppen A,B,C,D 37 1.5.1. Organisation der Einsatzgruppen 37 1.5.2. „Hitlerjunge Salomon“ 43 1.5.3. Babyn Yar 45 1.5.4. Gesamte Todesbilanz 54 1.5.5. Die „unbeteiligte“ Wehrmacht 56 1.5.6. Die zivilen „Helfer“ 63 II. Die „Österreicher“ 71 2.1. Vormals österreichische Polizisten 71 2.2. „Ganz normale Männer“ (Christopher Browning). Blinder Gehorsam oder Vernichtungswille 76 2.3. Curricula vitae der NS-Verbrecher 80 2.3.1. Dr. Auinger Josef 80 2.3.2. Dr. Bast Gerhard 82 2.3.3. Dr. Berger Friedrich 85 2.3.4. Dr. Schönpflug Egon 86 2.3.5. Murer Franz 88 2.3.6. Pachschwöll Norbert 91 III. Die gerichtliche Verfolgung der Täter nach 1945 94 3.1. Einsatzgruppen-Prozess in Nürnberg 94 3.2. -

Schoen Consulting Claims Conference Holocaust Poll – AUSTRIA March 2019 Screening Questions
Schoen Consulting Claims Conference Holocaust Poll – AUSTRIA March 2019 Screening Questions • {Age} 18 and older 100% Under 18 [TERMINATE] --1 General Awareness - Open Ended Questions Intro: Thank you for your participation in this survey. The next questions in the survey are about a particular historical topic – the Holocaust. These questions don’t have right or wrong answers, so please be as honest and open as you can. 1. Have you ever seen or heard the word Holocaust before Yes, I have definitely heard about the 87% Holocaust Yes, I think I’ve heard about the Holocaust 9% No, I don’t think I have heard about the 2% Holocaust No, I definitely have not heard about the 2% Holocaust IF NO, SKIP TO Q9 2. In your own words, what does the term Holocaust refer to? OPEN ENDED WITH PRECODES (MULTIPLE ANSWERS ACCEPTED) Extermination of the Jews/Jewish people 58% Genocide generally 27% World War II 16% The Nazis 7% Adolf Hitler 6% Other 15% Not sure 5% 1 Throughout this document “--” indicates no response Schoen Consulting Claims Conference Holocaust Poll – AUSTRIA March 2019 3. Who or what do you think caused the Holocaust? OPEN ENDED WITH PRECODES (MULTIPLE ANSWERS ACCEPTED) Adolf Hitler 39% The Nazis 21% Jews 8% World War I 4% Germany 2% Antisemitism 2% Other 19% Not sure 6% 4. Who were victims during the Holocaust? OPEN ENDED WITH PRECODES (MULTIPLE ANSWERS ACCEPTED) Jews (Austrian and other) 94% The disabled / People with disabilities 42% Roma-Sinti (Gypsies) 39% Homosexuals 35% Resistance workers 30% Communists 25% Jehovah’s Witnesses 24% Non-Jewish Poles 13% Austrians (Non-Jewish) 12% Rescuers 10% Other 5% Not sure 4% Schoen Consulting Claims Conference Holocaust Poll – AUSTRIA March 2019 5.