Jubb Geschäftsbericht
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
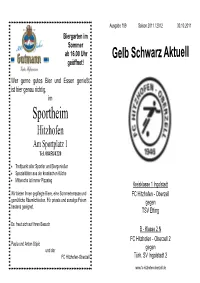
GSA 189 TSV Etting.Pub
Ausgabe 189 Saison 2011 / 2012 30.10.2011 Biergarten im Sommer ab 16.00 Uhr Gelb Schwarz Aktuell geöffnet! Wer gerne gutes Bier und Essen genießt ist hier genau richtig, im Sportheim Hitzhofen Am Sportplatz 1 Tel. 08458/4220 • Treffpunkt aller Sportler und Biergenießer • Spezialitäten aus der kroatischen Küche • Mittwochs ist immer Pizzatag Kreisklasse 1 Ingolstadt Wir bieten Ihnen gepflegte Biere, eine Sommerterrasse und FC Hitzhofen - Oberzell gemütliche Räumlichkeiten. Für private und sonstige Feiern gegen bestens geeignet. TSV Etting Es freut sich auf Ihren Besuch B - Klasse 2 N FC Hitzhofen - Oberzell 2 Paula und Anton Stipic und der gegen FC Hitzhofen-Oberzell Türk. SV Ingolstadt 2 Seite 32 www.fc-hitzhofen-oberzell.de Seite 1 Liebe Fußballfans ! Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen und Auftragsvergaben vor allem diejenigen Firmen, die durch Bandenwerbung und Inserate die Arbeit der Fußballabteilung unterstützen und dadurch maßgeblich zur Förderung des Sports in unserem Ort bei- tragen. Veranstaltungskalender 2011: Ehrenabend FC HO 16. Nov. Altpapiersammlung 19. Nov. Blutspendemobil 22. Nov. Weihnachtsfeier 17. Dez. Änderungen behalten wir uns vor! Seite 2 Seite 31 Anpfiff in Hitzhofen Liebe Mitglieder und Fans des FC Hitzhofen-Oberzell, PROMI-TIPP Zum letzten Vorrunden-Heimspieltag begrüßt euch das Redaktionsteam von Gelb-Schwarz Aktuell im Waldstadion. Ein sportlicher Gruß geht an unsere heuti- gen Gäste, dem TSV Etting und dem Türk. SV Ingolstadt. Ein herzlicher Willkom- mensgruß natürlich auch an die beiden Unparteiischen: Thomas Renner, als Lei- FC Hitzhofen - Oberzell ter des Kreisklassenspiels sowie Daniel Weise, Schiedsrichter beim Vorspiel. gegen Unsere Erste hat die 1:2 Heimniederlage gegen Gaimersheim vergangene Wo- che beim Kreisliga-Absteiger SpVgg Wolfsbuch wieder wett gemacht. -

Beschlussprotokoll Der 01. Kreisausschusssitzung Vom 20
Beschlussprotokoll über die KREISAUSSCHUSSSITZUNG am Mittwoch, 20.02.2013, 14:00 Uhr, im kleinen Sitzungssaal des Landratsamtes in Eichstätt, Residenzplatz 1. Sämtliche Mitglieder sind form- und fristgerecht geladen. I. Öffentlicher Teil 1. Stellenplan 2013 2. Denkmalpflege; Kreiszuschuss an die Stadt Beilngries für die Sanierung des Seelennonnenturms 3. Römerprogramm; Kreiszuschuss für Rekonstruktionen beim Römerkastell in Pförring 4. Kreiszuschuss für die Errichtung eines Bienenlehrstandes durch den Imker- Kreisverband Eichstätt e.V. 5. Wertstofferfassung; Kreiszuschüsse für den Ausbau der Wertstoffhöfe in Böhmfeld, Buxheim, Dolln- stein, Großmehring, Mindelstetten, Schernfeld, Stammham und Titting 6. Zweckverband Gymnasium Gaimersheim; Übernahme der Investitionsumlage des Verbandsmitglieds Stadt Ingolstadt im Rahmen des Investitionsausgleichs durch den Landkreis Eichstätt 7. Gymnasium Beilngries; Grundsatzbeschluss zur Errichtung einer Mensa 8. Verschiedenes II. Nichtöffentlicher Teil Seite 2 von 3 I. Öffentlicher Teil Top I/1 Stellenplan 2013 Beschluss: 13:0 Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag, den Stellenplanentwurf 2013, wie von der Verwaltung vorgelegt, im Rahmen der Beratung des Kreishaushalts 2013 zu genehmigen. Top I/2 Denkmalpflege; Kreiszuschuss an die Stadt Beilngries für die Sanierung des Seelennonnenturms Beschluss: 13:0 Der Kreisausschuss bewilligt der Stadt Beilngries für die Sanierung des Seelennonnen- turms einen Kreiszuschuss in Höhe von 6.400 €. Der Zuschussbemessung liegen zuwen- dungsfähige Kosten in Höhe von 128.000 € zugrunde. Die notwendigen Haushaltsmittel sind bei HSt. 3650.9820 als Haushaltsausgabereste verfügbar. Top I/3 Römerprogramm; Kreiszuschuss für Rekonstruktionen beim Römerkastell in Pförring Beschluss: 13:0 Der Kreisausschuss bewilligt dem Markt Pförring für die Inwertsetzung des Römerkastells in Pförring einen Kreiszuschuss in Höhe von 52.100 €. Der Zuschussbemessung liegen 521.000 € zugrunde. Die Finanzierung erfolgt aus Haushaltsausgaberesten bei HSt. -

Adelschlag – Egweil– Nassenfels
DAS MITTEILUNGSBLATT DER VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT NASSENFELS 01 2021 ADELSCHLAG – EGWEIL– NASSENFELS Foto: Gabler Seite 16 Seite 18 Seite 19 Langer, kalter schneereicher Winter vor Weihnachtliche Stimmung in Egweil Papiersammlung durch den FC Nassenfels 10 Jahren in Pietenfeld Bürgerservice Öffnungszeiten der VG Nassenfels Rufnummern Vormittags: VG Nassenfels Mo., Mi., Do. und Fr. 8.00–12.00 Uhr Di. geschlossen Die Rufnummer der VG lautet: (0 84 24) 89 11 0, Fax: 89 11 55 Nachmittags: Vorsitzender der VG 1. Bürgermeister Montag 14.00–17.00 Uhr Andreas Birzer 89 11 30 Mittwoch 16.00–18.00 Uhr Geschäftsleitung Robert Flauger 89 11 26 (bis 19.00 Uhr ist nur das Einwohnermeldeamt besetzt!) Sitzungsdienst Florian Kleinhans 89 11 58 Bürgermeistersprechstunden: Adelschlag: Donnerstag von 16.30–17.15 Uhr EDV Markus Burtz 89 11 59 Pietenfeld: Donnerstag von 17.30–18.15 Uhr Einwohnermeldeamt, Passamt Brigitte Redl, Bastian Schneider 89 11 20 Ochsenfeld: Donnerstag von 18.30–19.15 Uhr Rente Brigitte Redl 89 11 28 Möckenlohe: nach Vereinbarung Ordnungsamt Natalie Wunder 89 11 23 Weitere Sprechstunden nach Vereinbarung. Franz Schlamp 89 11 22 Egweil: Dienstag von 18.30–19.30 Uhr im Gemeindezentrum und nach Vereinbarung Kämmerei Bernd Fieger 89 11 32 Nassenfels: Mittwochsiehe von 17.30–18.30 Seite Uhr und5 nach Vereinbarung zu Christa Hirschberger 89 11 21 den Öffnungs zeiten des Rathauses Alexandra Husterer 89 11 31 E-Mail: [email protected]. Aushang Abgaben/Gebühren/Abfall Cornelia Niederwald 89 11 34 Homepage: VG Nassenfels: www.vg-nassenfels.de -

Köschinger Anzeiger, | 15
Nummer 9 | September 2021 ® mit amtlichen Mitteilungen [email protected] des Marktes Kösching Die Bürgerzeitung für Kösching, Kasing, Bettbrunn, Lenting, Hepberg, Großmehring und Stammham ANZEIGEN IDEEN MIT NATURSTEIN, - GRO ß FLIESEN UND MOSAIK & EINZEL HANDEL FLIESEN SALVIA & KÄSER RUPPERTSWIES 10 85092 KÖSCHING TEL. (0 84 56) 278 60-70 WWW.FLIESEN-SK.DE Der neue Grieche „KAVALA” Vom Boden aus steigt Nebel in den blauen Himmel. Leserin Lea Im Interpark-Kösching Mayer gelang dieses beeindruckende Foto. (im Erdgeschoss „Hotel Intergroup”) Tel. 08456/9239800 Kopernikusstraße 17 85092 Kösching/Interpark www.kavala-restaurant-koesching.de AB-LAGER-VERKAUF Fr., 23.09.21,18–20Uhr Fr., 08.10.21,18–20Uhr 10 JahreWeinpassion-Felix Fürjede reinsortige Kiste gilt 5+1 d.h. Sie bezahlen nur 5Flaschen je Kiste. Ruppertswies 34 ·85092 Kösching Gilt für alle Bestellungen bis 30.09.21 HEIZUNG & BAD KEMPA www.meister-kempa.de Wir sind kreative Handwerker, Meister, Dienstleister, Wegbegleiter – seit über 45 Jahren. Wir bei Gunvor LOKALES | 3 VdK Kösching spendet 500 Euro ANZEIGEN für den Köschinger Sozialfonds www.wisse.de er VdK Ortsverband Kö- bei den Verantwortlichen des sching überreichte 500 VdK, auch im Namen derjeni- DEuro an Manfred Hofwe- gen, die unterstützt werden. Die ber, Vorsitzender des Köschinger geplanten Veranstaltungen im Sozialfonds. „Da in Coronazei- Herbst und Winter werden auf ten keine eigenen Veranstaltun- Grund der wieder ansteigen- gen durchgeführt werden konn- den Corona-Infektionen erneut Ihre Füße in Händen! ten, möchte der VdK dazu verschoben. Die Jahreshaupt- besten beitragen die Sozialen Härten versammlung mit Neuwahl der Wisse OOrthopädirthopädie-Schuhtechnik in dieser Zeit ein wenig zu lin- Vorstandschaft, die für 5. -

Ingolstadt - Buxheim - Eichstätt
9233 Ingolstadt - Buxheim - Eichstätt RBA Regionalbus Augsburg GmbH, 86199 Augsburg, Tel. 0180 5 722287, (14 ct/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 42 ct/min), [email protected] BahnCard wird anerkannt, jedoch nicht innerhalb von Verkehrsverbünden. Am Buß- und Bettag Verkehr wie an schulfreien Tagen. Am 24. u. 31.12. - wenn Werktag - Verkehr wie am Samstag Am letzten Schultag vor den Ferien können die Fahrzeiten abweichen - bitte informieren Sie sich Gültig ab 11. Sept. 18 Montag - Freitag Samstag Kurs 3301 3303 3307 3309 3305 3369 3313 3341 3317 3323 3329 3333 3351 3355 2501 2503 2507 2509 3305 2569 2513 2541 2517 2523 503 2533 5010 5011 VERKEHRSHINWEIS S FA S S S FA Ingolstadt, ZOB (Steig 16) 07.56 11.15 18.25 08.35 13.25 - Haltmayrstraße 08.01 11.20 18.30 08.40 13.30 - Klinikum 08.04 11.23 18.33 08.43 13.33 - Am Dachsberg 08.06 11.25 18.35 08.45 13.35 - Jupiterstraße 08.08 11.27 18.37 08.47 13.37 Eitensheim, Gaimersheimer Str. 11.35 - Bräuweg 11.36 Buxheim, Wolkertshofener Str. 06.59 06.50 - Dorfplatz 06.39 08.13 18.42 08.52 13.42 - Eitensheimer Str. 06.41 07.01 06.52 08.15 18.44 08.54 13.44 - Jurastr. 06.42 07.02 06.53 08.16 14.00 18.45 08.55 13.45 Tauberfeld, Post 08.20 - Buxheimer Straße 07.06 08.22 11.40 16.51 Buxheim, Jurastr. 08.25 - Eitensheimer Str. 08.26 - Wolkertshofener Straße 08.28 - Tauberfelder Straße 06.44 06.55 11.44 14.02 16.55 18.47 08.57 13.47 Wolkertshofen, Kirchstraße 06.47 07.00 08.32 11.47 14.05 16.58 18.50 09.00 13.50 Nassenfels, Schule 06.50 07.04 08.36 11.50 14.08 17.01 18.53 09.03 13.53 Meilenhofen -

Testzentren Im Landkreis Eichstätt
Testzentren im Landkreis Eichstätt Stand: 28.04.2021 Testzentren Landkreis Eichstätt In Aufbau und Planung befindliche Schnellteststationen im Landkreis Eichstätt PCR-Testzentrum Öffnungszeiten Eichstätt Montag bis Freitag 08:00 bis 16:00 Uhr Beilngries Montag bis Freitag 08:00 Uhr bis 12 Uhr Schnelltestzentrum Starttermin Öffnungszeiten Adelschlag 01.04.2021 Mittwoch und Freitag: 18:00 bis 20:00 Uhr verschiedene Testorte, aktuelle Samstag bei Bedarf: 15:00 bis 17:00 Uhr Informationen: www.adelschlag.de Altmannstein 16.04.2021 Mittwoch und Freitag, 18:00 bis 20:00 Uhr Beilngries 01.04.2021 Montag bis Freitag 08:30 Uhr bis 09:00 Uhr Am Ludwigskanal 2 sowie 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr 92339 Beilngries Böhmfeld – Kotterhof 19.04.2021 Montag und Freitag, 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr Hofstetter Straße 3 85113 Böhmfeld Buxheim - Tauberfeld 14.04.2021 Mi 14.04. 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr Kirchplatz 4 Fr. 16.04. 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr 85114 Tauberfeld je nach Nachfrage weitere Termine Denkendorf 06.05.2021 Donnerstag: 18:00 bis 20:00 Uhr Turnhalle der Grund- und Mittelschule Samstag: 10:00 bis 12:00 Uhr Ringstraße 31 85095 Denkendorf Eichstätt 16.04.2021 Täglich geöffnet, Volksfestplatz - siehe Buchungsportal 85072 Eichstätt Gaimersheim 01.04.2021 Täglich geöffnet, Martin-Ludwig-Straße 15 - siehe Buchungsportal - 85080 Gaimersheim Großmehring 15.04.2021 Donnerstag 18:00 bis 20:00 Uhr Dammweg 1 85098 Großmehring Hitzhofen 28.04.2021 Mittwoch, 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr Hofstetten Florianweg 1 / Sport- und Freitag, 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr Hitzhofen Jugendtreff -

Bauen Im Landkreis Eichstätt Bauen Im
BAUEN IM LANDKREIS EICHSTÄTT INFORMATIONEN FÜR BAUWILLIGE 4. AUFLAGE Fliesen + Naturstein Transportbeton Kies- und Splittwerke Bauunternehmen Franz Schimmer GmbH / Schlehenweg 7 Ihr Partner am Bau 85114 Buxheim / Fon 0 84 58-39 02-0 Fax 0 84 58-39 02-22 / www.schimmer-buxheim.de Fenster – Türen Baier’s Wintergärten SCHREINEREI REUDER Bauelemente Terrassenüberdachungen TÜREN • MÖBEL • INNENAUSBAU Hauptstraße 27 Tel. 08461 - 700 247 Industriestraße 4 92339 Beilngries Fax 08461 - 700 249 85072 Eichstätt Öffnungszeiten Ausstellung: www.baiers-bauelemente.de Telefon 0 84 21 / 900 37 90 Mo. - Fr. 8.00 - 14.00 Uhr Schausonntag von Telefax 0 84 21 / 900 37 89 ab 14.00 Uhr nach Vereinbarung 14.00 - 17.00 Uhr E-Mail: [email protected] Internorm Internet: www.schreinerei-reuder.de Holzbau und Sanierung Holzbau Roland Wutz Zimmerei Bedachungen Tel./Fax: 08406 / 911 96 www.holzbau-wutz.de Johann Eichinger Holzbearbeitung GmbH Ulrich-von-Stein-Straße 7 Kirchstraße 7 · 85125 Haunstetten 93336 Altmannstein Telefon 0 84 67 / 9 05 · Telefax 0 84 67 / 7 18 GRUSSWORT DES LANDRATS Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, der Landkreis Eichstätt gibt in regelmäßigen Abständen eine Infor- denen Themen darstellen. Wenn Sie Fragen für Ihr konkretes Vor- mationsschrift als kleinen Ratgeber mit Informationen,Tipps und Hin- haben klären wollen, stehen Ihnen hierfür selbstverständlich meine weisen für Bauwillige heraus. Die derzeit vorliegende 3. Auflage Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landratsamt zur Verfügung. Im bedurfte einer Überarbeitung, da seit Herausgabe der 3.Auflage u.a. Interesse der Verfahrensbeschleunigung empfehle ich Ihnen, auf die sowohl das Baugesetzbuch als auch die Bayer. Bauordnung in vie- Vollständigkeit und inhaltliche Korrektheit der Antragsunterlagen zu len Punkten geändert wurden.Vor allem die seit dem 1. -

Des CSU-Ortsverbandes Pollenfeld Mit Auszügen Aus Dem Protokollbuch Und Aus Dem Gründungsprotokoll
1 Chronik des CSU-Ortsverbandes Pollenfeld mit Auszügen aus dem Protokollbuch und aus dem Gründungsprotokoll Am 24. September 1971 trafen sich 18 CSU-Mitglieder um 20,00 Uhr im Gasthaus Hogl (heute Gasthaus Breitenhuber) in Seuversholz, um einen CSU-Ortsverband zu gründen. Alle Anwesenden stimmten der Gründung eines „CSU-Ortsverband Berg, Sitz Seuversholz“, zu. Der erste CSU- Ortsvorsitzende wurde nach dem Gründungsprotokoll Josef Braun, Pollenfeld Nr. 26. Zum Stellvertreter wurde gewählt Bartholomäus Meyer, Seuversholz Nr. 6. Zum Schriftführer wurde Hans Stadler, Wachenzell Nr. 16 bestellt. Zum Kassier gewählt wurde Karl Priborsky, Pollenfeld, Siedlung 134. Beiräte wurden Lorenz Strauß, Weigersdorf, Franz Ablassmeier, Weigersdorf und Johann Weber, Pollenfeld. Eine namentliche Aufführung der Gründungsmitglieder konnte dem Protokollbuch nicht entnommen werden. Eine weitere Versammlung war dann am 16. Januar 1972 im Gasthaus Pfaller in Pollenfeld. Zu diesem Zeitpunkt umfasste der Ortsverband bereits 2 einen Gesamtmitgliederstand von 48 Personen. 29 waren der Einladung gefolgt. Vorsitzender Josef Braun informierte die Mitglieder darüber, dass der Vorstandschaft neu konstituiert werden müsse. Die erneute Wahl ergab, dass der Vorsitzende, der Stellvertreter, der Schriftführer und der Kassier gegenüber der Gründungsversammlung unverändert blieben. Als Beisitzer wurden gewählt Lorenz Strauß, Weigersdorf, und Bauer Karl, Sornhüll. Zu Delegierten für die Kreisversammlung wurde der gesamte Vorstandschaft samt den Beisitzern bestellt. Die Versammlung beschloss weiter, dass der bisherige Name des Ortsverbandes, „OV Berg, Sitz Seuversholz“, entfallen soll. Künftig soll der Zusammenschluss heißen: „CSU-Ortsverband Pollenfeld“. Am 7. März 1973 traf man sich im Gasthaus Wittmann in Wachenzell zu einer weiteren Versammlung. 40 Mitglieder waren anwesend. Vorsitzender Josef Braun berichtete über die Kreisdelegiertenversammlung in Stammham und zur anstehenden Kreistagswahl. -

Das Mitteilungsblatt Der Verwaltungsgemeinschaft Nassenfels
DAS MITTEILUNGSBLATT DER VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT NASSENFELS 12 2020 ADELSCHLAG – EGWEIL– NASSENFELS Foto: Gabler Seite 15 Seite 16 Seite 20 Weihnachtsfeier VdK Adelschlag Neue Trikots für den TSV Egweil Leonhardiritt in Meilenhofen Bürgerservice Öffnungszeiten der VG Nassenfels Rufnummern Vormittags: VG Nassenfels Mo., Mi., Do. und Fr. 8.00–12.00 Uhr Di. geschlossen Die Rufnummer der VG lautet: (0 84 24) 89 11 0, Fax: 89 11 55 Nachmittags: Vorsitzender der VG 1. Bürgermeister Montag 14.00–17.00 Uhr Andreas Birzer 89 11 30 Mittwoch 16.00–18.00 Uhr Geschäftsleitung Robert Flauger 89 11 26 (bis 19.00 Uhr ist nur das Einwohnermeldeamt besetzt!) Sitzungsdienst Florian Kleinhans 89 11 58 Bürgermeistersprechstunden: Adelschlag: Donnerstag von 16.30–17.15 Uhr EDV Markus Burtz 89 11 59 Pietenfeld: Donnerstag von 17.30–18.15 Uhr Einwohnermeldeamt, Passamt Brigitte Redl, Bastian Schneider 89 11 20 Ochsenfeld: Donnerstag von 18.30–19.15 Uhr Rente Brigitte Redl 89 11 28 Möckenlohe: nach Vereinbarung Ordnungsamt Natalie Wunder 89 11 23 Weitere Sprechstunden nach Vereinbarung. Franz Schlamp 89 11 22 Egweil: Dienstag von 18.30–19.30 Uhr im Gemeindezentrum und nach Vereinbarung Kämmerei Bernd Fieger 89 11 32 Nassenfels: Mittwoch von 17.30–18.30 Uhr und nach Vereinbarung zu Christa Hirschberger 89 11 21 den Öffnungs zeiten des Rathauses Alexandra Husterer 89 11 31 E-Mail: [email protected] Abgaben/Gebühren/Abfall Cornelia Niederwald 89 11 34 Homepage: VG Nassenfels: www.vg-nassenfels.de Kasse Peter Brunner 89 11 36 Gemeinde Adelschlag: www.adelschlag.de -

Bayerischer Landtag
Bayerischer Landtag 17. Wahlperiode 30.01.2017 17/14455 Kommune mind. mind. mind. im Förder- Schriftliche Anfrage 1 30 50 Verfah- antrag der Abgeordneten Eva Gottstein FREIE WÄHLER Mbit/s Mbit/s Mbit/s ren? gestellt? vom 21.10.2016 Adelschlag 97,4 5,9 1,9 ja ja Altmannstein 99,1 6,9 2,6 ja ja Breitbandausbau in der Region 10 Beilngries 98,9 56,5 56,1 ja nein Böhmfeld 100,0 94,3 92,1 ja nein Ich frage die Staatsregierung: Buxheim 100,0 80,2 20,1 ja ja Denkendorf 100,0 13,5 2,3 ja ja 1. Wie hoch ist der Stand zum Juni 2016 beim Breitbandaus- Dollnstein 99,7 88,2 87,6 ja nein bau in den Landkreisen Eichstätt, Neuburg-Schroben- Egweil 100,0 0,0 0,0 ja ja hausen, Pfaffenhofen/Ilm und der Stadt Ingolstadt (bitte Eichstätt 100,0 95,2 93,7 ja nein aufgeschlüsselt nach den Landkreisen, den einzelnen Eitensheim 100,0 26,7 4,4 ja nein Kommunen und der Übertragungsrate (Mbit/s))? Gaimersheim 100,0 56,6 55,2 ja ja Großmehring 99,9 67,4 61,9 ja nein 2. Welche Gemeinden in der Region 10 haben bereits För- Hepberg 100,0 97,1 95,9 ja nein deranträge gestellt und welche nicht? Hitzhofen 100,0 3,4 3,4 nein nein Kinding 97,4 59,5 59,2 ja ja 3. Welche Anbieter erhielten den Zuschlag bei bereits Kipfenberg 94,3 10,0 1,0 ja nein durchgeführten Maßnahmen? Kösching 99,6 51,0 50,6 ja ja 4. -

Adelschlag – Egweil– Nassenfels
DAS MITTEILUNGSBLATT DER VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT NASSENFELS 06 2019 ADELSCHLAG – EGWEIL– NASSENFELS Foto: Gabler Seite 15 Seite 19 Seite 21 Ehrungen in Pietenfeld Egweiler Kommunionkinder basteln Kreuze Maibaumaufstellen in Wolkertshofen Bürgerservice Öffnungszeiten der VG Nassenfels Rufnummern Vormittags: Mo., Mi., Do. und Fr. 8.00–12.00 Uhr VG Nassenfels Di. geschlossen Nachmittags: Die Rufnummer der VG lautet: (0 84 24) 89 11 0, Fax: 89 11 55 Montag 14.00–17.00 Uhr Vorsitzender der VG 1. Bürgermeister Mittwoch 16.00–19.00 Uhr Thomas Hollinger 89 11 33 (ab 18.00 Uhr ist nur das Einwohnermeldeamt besetzt!) Bürgermeistersprechstunden: Geschäftsleitung Robert Flauger 89 11 26 Adelschlag: Donnerstag von 16.00–17.00 Uhr Sitzungsdienst Nadine Thiede 89 11 58 Pietenfeld: Donnerstag von 17.15–18.15 Uhr EDV Markus Burtz 89 11 59 Ochsenfeld: Donnerstag von 18.30–19.30 Uhr Einwohnermeldeamt, Passamt Birgit Sauer, Brigitte Redl 89 11 20 Möckenlohe: nach Vereinbarung Weitere Sprechstunden nach Vereinbarung. Rente Birgit Sauer, Brigitte Redl 89 11 28 Egweil: Dienstag von 18.30–19.30 Uhr im Gemeindezentrum und nach Ordnungsamt Natalie Wunder 89 11 23 Vereinbarung Franz Schlamp 89 11 22 Nassenfels: Mittwoch von 17.30–18.30 Uhr und nach Vereinbarung zu den Öffnungs zeiten des Rathauses Kämmerei Bernd Fieger 89 11 32 E-Mail: [email protected] Christa Hirschberger 89 11 21 Homepage: VG Nassenfels: www.vg-nassenfels.de Alexandra Husterer 89 11 31 Gemeinde Adelschlag: www.adelschlag.de Abgaben/Gebühren/Abfall Cornelia Niederwald 89 11 34 Gemeinde -

Ferien (S)Pass 2021
WWW.KJR-EI.DE FERIEN (S)PASS 2021 - 1 - - 1 - : DIESER FERIEN(S)PASS GEHORT: DAS PROGRAMM ZUM FERIEN(S)PASS: ADRESSE: Bei Ausflügen, Workshops, Veranstaltungen oder beim Spielbus des Kreisjugendrings Eichstätt kommen die Kinder in den Sommerferien auf ihre Kosten. Fast an jedem Tag findet irgendwo im Landkreis eine Aktion statt. Ein Ferienpass kostet 1 €. Künstlervorführungen sind mit dem Ferienpass kostenlos, ohne Pass 3,- € Eintritt. Bei Künstlerveranstaltungen wird keine Aufsichtspflicht übernommen. ALTER: Bei allen Kursen, Workshops, Tagesausflügen, bei der Hofwoche sowie bei den Ponyhof Tagen ist jeweils eine Anmeldung erforderlich. Auch bei den Aktionen des Spielbusses sowie bei den Künstlerveranstaltungen ist dieses Jahr eine Anmeldung nötig. Nutzen Sie bitte die Online-Anmeldung auf unserer Homepage (https://www.kjr-ei.de/index.php/veranstaltungen). Anmeldungen per E-Mail können nicht berücksichtigt werden. Das Anmeldetool ist ab 12.07.21, 8.00 Uhr für Euch freigeschaltet. AUSKUNFT/VERANTWORTLICH: FINDE UNS IM WEB! Ein Teil des Ferienpasses gilt in den Sommerferien 2021. Der Rest gilt auch für die kom- GESCHÄFTSFÜHRER PETER KRACKLAUER menden Herbst-, Weihnachts-, Oster- und Pfingstferien. Mit dem Ferienpass können viele Bäder, Museen, Minigolfanlagen usw. kostenlos besucht werden. KREISJUGENDRING EICHSTÄTT Den Ferienpass gibt es bei allen Sparkassen, Raiffeisen- und Volksbanken, bei vielen SCHÖNFELDERSTR. 16 Schulen, einigen Gemeinden und natürlich beim Kreisjugendring Eichstätt. 85132 SCHERNFELD Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen des Kreisjugendrings Eichstätt TELEFON: 08422/99633-0 (https://www.kjr-ei.de/images/Allgemeine_Teilnahmebedingungen.pdf). FAX: 08422/99633-34 Besonders weisen wir darauf hin, dass bei nicht rechtzeitiger Abmeldung die Teilnehmer- gebühr bis zur vollen Höhe ggf. zuzüglich Bearbeitungsgebühr in Rechnung gestellt wird.