Seite 42.173, Freiburg | Elexikon
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

L'assemblée Générale
CAS section la Gruyère Président Serge Blanc Pré-Vert 38, 1791 Courtaman, 026 684 15 78 Adresse du club Case postale 502 - 1630 Bulle 1 Sites internet http://www.cas-gruyere.ch http://www.gjgruyere.ch E-mail [email protected] Local de la section Bâtiment Setam - Ch. de Bouleyres 79 - 1630 Bulle Janine et André Scheurer, tél. 079 620 39 14 Rédaction du bulletin Colette Dupasquier, Rte de Broc 20, 1663 Epagny, Numéro 026 921 28 51 ou 079 697 26 22 10 Octobre 2014 E-mail : [email protected] 11 Novembre 2014 Gestion des membres Francis Van Wynsberghe Route de la Buchille 27, 1633 Marsens 026 915 03 36 et 079 244 31 71 E-mail : [email protected] Photo de couverture Les cabanes de la section Invitation à l’assemblée générale Tous les membres du CAS de la Gruyère sont cordialement invités à l’assemblée générale le samedi 13 décembre à la Maison du Gruyère de Pringy à 17 heures. Plus de précisions et modalités d’inscription suivront dans le bulletin du mois de décembre. Sommaire Animation au stamm 3 Groupement jeunesse 13 Reflets de la section 5 Les courses de la section 17 Les cabanes de la section 9 Récits de courses 32 Animations au stamm Conférence-échange de François Gachoud Vendredi 24 octobre à 20 h Professeur retraité du Collège du Sud, François Gachoud a publié « Sagesse de la Montagne ». Il viendra nous présenter son livre dans le but d’un partage avec les clubistes : une approche cordiale autour de quelques textes choisis pour nous rappeler la riche beauté d’un monde qui élève à la fois le corps et l’esprit. -

Le Bouquetin Le Bouquetin
Le Bouquetin BULLETIN MENSUEL DU CAS LA GRUYÈRE 09-2017 SEPTEMBRE 2017 Promotion: Nouvelle radio de détresse Rega pour Fr. 280.- Visitez notre nouvelle exposition à la rue de l’Industrie 2 à Bulle. Vous pourrez découvrir nos dernières nouveautés. Renseignements: 026 912 83 88 Infos utiles PRÉSIDENTE Chantal Python Nikles, route du Couchant 3, 1723 Marly, tél. 079 385 15 91 E-mail : [email protected] ADRESSE DU CLUB Case postale 502 - 1630 Bulle 1 SITES INTERNET www.cas-gruyere.ch / www.gjgruyere.ch E-mail : [email protected] Infos utiles 01 LOCAL DE LA SECTION Bâtiment Setam, chemin de Bouleyres 79, 1630 Bulle Editorial 03 Janine et André Scheurer, tél. 079 620 39 14 RÉDACTION DU BULLETIN Activités au stamm 05 Colette Dupasquier, route de Broc 20, 1663 Epagny Tél. 026 921 28 51 ou 079 697 26 22 E-mail : [email protected] Au stamm en novembre 06 GESTION DES MEMBRES Francis van Wynsberghe, route de la Buchille 27, Cabanes de la section 07 1633 Marsens Tél. 079 244 31 71 Activités en cabane 13 E-mail : [email protected] Reflets de la section 15 CABANE DE BOUNAVAUX Grandvillard Responsables : Evelyne et André Dubath Groupement jeunesse 17 Réservation : 079 603 68 78 CABANE DES CLÉS Courses de la section 21 Moléson-sur-Gruyères Responsables : Team Les Clés Passion 33 Réservation : 079 625 17 07 CABANE DES MARINDES Récits de course 37 Charmey Responsable : Bernard Mooser Demande d’admission 44 Réservation : 079 790 45 33 CABANE DE L’OBEREGG Jaunpass Responsable : Raphaël Pipoz Réservation : 079 816 88 57 CABANE DES PORTES Vuadens Responsables : Joël Bach et Jean-François Vienny Réservation : 077 409 18 36 PHOTO DE COUVERTURE BIVOUAC DU DOLENT Bivouac Regondi La Fouly Claude Heckly | Juin 2017 Responsable : Léonardo Zanon Informations : 079 312 28 52 SEPTEMBRE 2017 CAS LA GRUYÈRE 01 CRÉATION GRAPHIQUE - IMPRESSION NUMÉRIQUE ET OFFSET Vous avez écrit un livre ? Faites-vous plaisir ! Faites plaisir ! Partagez ! Pas de quantité minimum. -

Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis Zum Geleit 8 Vorwort der Autoren 10 Übersichtskarte des Kantons Freiburg 12 Zum Gebrauch des Führers 14 Sicherer unterwegs im Sommer 18 Informationen Sommer 24 Die Wanderskala des SAC 26 SAC-Schwierigkeitsskalen 28 Gipfel nach Schwierigkeiten 30 Literatur 34 Erste Hilfe 36 Umweltfreundlich unterwegs 38 Geologie 42 Le Moleson 52 1.1 Le Molöson 56 1.2 Teysachaux - Le Molfeson 60 1.3 Niremont - Les Alpettes 64 1.4 Les Deux Dents - La Vudalla 68 1.5 DentdeLys 72 1.6 Vanil Blanc - Grand Sex - Dent de Lys 76 1.7 Folliu Borna - Vanil des Artses - Cape au Moine - Corb£ 80 1.8 Dent de Hautadon - Grande Chaux de Naye 86 1.9 DentdeCorjon 90 Höhlenforscher auf dem Gipfel 94 Vanil Noir 96 2.1 DentdeBroc 100 2.2 Dent de Broc - Dent du Chamois - Dent du Bourgo 104 2.3 Les Merlas - Le Van -Tsermon - Le Curtillet 108 5 http://d-nb.info/1044260629 Inhaltsverzeichnis 2.4 Vanil Noir 112 2.5 Vanil Noir - Vanil de l'Ecri - Pointe de Paray 116 2.6 Les Millets 122 2.7 L'Aiguille - Chaux de Culand - Pointe du Chevrier 126 2.8 Pointe de Cray - Pra de Cray - Vanil Carre - Gros Perrö 130 2.9 Dent de Brenleire - Dent de Folliöran 136 2.10 Dent de Brenleire - Vanil Noir - Tour de Dorena - Dent des Bimis 142 2.11 Gros Haut Cr§t Sud - Vanil de la Monse 146 Zur Höhenmessung der Freiburger Gipfel 150 Gastlosen 156 3.1 Hochmatt - Cheval Blanc 160 3.2 Oberrügg - Brendelspitz - Brendel 164 3.3 Gratflue - Gastlosenspitze - Marchzähne - Eggturm 168 3.4 Rüdigenspitze - Wandflue - Zuckerspitz 174 3.5 Dent de Ruth - Dent de Savigny - Vanil de la Gobette 180 -

Ali Baba (Gastlosen)
Ali Baba (Gastlosen) - samedi 8 juin 2014 Simon Beaud rapidement dans un bosquet épineux qui Première expérience d’escalade dans cette lui rappelle qu’il faut bien étudier les topos partie des Gastlosen. Cette zone pitto- avant de s’élancer. Au final, le sommet resque est à l’image du nom qu’elle porte. semble à sa portée mais il doit déchanter… Tout le monde en a entendu parler, mais le secret d’Ali Baba restera toujours inac- personne ne sait où elle se trouve. cessible. Morgiane et Ali Baba supervisent les ma- nœuvres. Ils dispensent leurs savoir-faire et soutiennent leurs convives du jour. Tout se passe à merveille… mais toujours pas de piste pour ce fameux trésor. Le soleil se manifeste tout au long de la journée et met à mal les réserves de liquide. Une petite pause pique-nique très salutaire est organi- Pour l’occasion Elodie, notre cheffe de sée. Ultime concertation pour définir une course de la journée, ressemble très étran- stratégie de recherche, mais rien n’y fait, le gement à la Morgiane de notre conte des mystère reste entier. Dernier assaut sur mille et une nuits. Cette cette paroi, afin de découvrir jeune femme emmène l’entrée de cette fameuse joyeusement son petit grotte mais choux blanc car groupe de 5 personnes dans rien ne correspond au fa- les contreforts de notre meux conte. mystérieuse montagne. Un peu désabusé de n’avoir L’approche se fait très dou- pas pu percer ce secret, mais cement. Le sentier n’est pas hyper content d’avoir passé spécialement accueillant et une superbe journée de est spécialement dissimulé grimpe avec pleins de jolis afin de ne laisser quasiment souvenirs en tête, Morgiane personne trouver l’endroit reprend la direction du de ce site magique. -

Etude Paysagère Du Projet De Contributions À La Qualité Du Paysage Des Vallées De L’Intyamon Et De La Jogne
Fribourg Etude paysagère du projet de contributions à la qualité du paysage des vallées de l’Intyamon et de la Jogne Rapport de projet Château-d’Oex, le 15 décembre 2013 Givisiez, le 29 janvier 2014 (pour les chapitres 4 & 5) Givisiez le 14 mai 2014 révisé, variante finale S’intéresser au paysage de sa région ne se résume pas à l’expression vaguement nostalgique d’un passéisme qui tendrait à faire du passé un temps idéal (qu’il n’a jamais été !), voire à muséifier la nature ou l’habitat rural. Au contraire, l’attention vivante au paysage quotidien dans ses manifestations les plus humbles est indispensable si on veut éviter que ce paysage disparaisse par indifférence, par lassitude ou seulement parce que personne n’en saurait plus interpréter les signes. François Walter, préface de Une histoire du paysage fribourgeois, Espace, territoire, habitat, de Jean- Pierre Anderegg, service cantonal des biens culturels, Fribourg, 2002 Ces paysages, entièrement façonnés par trois siècles de monoculture du fromage, ne sont pas immuables. Depuis quelques années, une prise de conscience émerge dans la population et les notions de parc naturel régional, de tourisme doux, de paysage en tant que patrimoine culturel et capital touristique font leur chemin. Ainsi a-t-on compris que ce paysage, produit d’une authentique civilisation, la « civilisation du fromage », s’égrenant de Gruyères à Gstaad de part et d’autre du cours de la Sarine, est aussi précieux que fragile. Patrice Borcard, L’ancien Comté de Gruyère, une culture, des fromages, Association de l’ancien -

CAS Section La Gruyère Présidente Florence Luy Le Village 359, 1628 Vuadens / Tél
CAS section la Gruyère Présidente Florence Luy Le Village 359, 1628 Vuadens / tél. 079 293 53 08 Adresse du club Case postale 502 - 1630 Bulle Sites internet http://www.cas-gruyere.ch http://www.gjgruyere.ch E-mail [email protected] Local de la section Bâtiment Setam - Ch. de Bouleyres 79 - Bulle Tél. 026 912 24 98 Georgette Maillard / tél. 026 912 87 39 Rédaction du bulletin Lise Ruffieux Attention nouvelle adresse Cité St-Michel 12A / 1635 La Tour-de-Trême Tél. 026 913 11 68 / E-mail : [email protected] Photo de couverture Dent de Ruth et Dent de Savigny, en descendant de la Wandflue, photo offerte par Pierre-André Kolly N° 9 septembre 2008 Conférence d’automne Vendredi 17 octobre, 19 h 30 Stamm du CAS la Gruyère à Bulle Dans le cadre des conférences d’automne organisées conjointement par les sections fribour- geoises du CAS, la section Moléson vous invite cette année à une conférence de Annick Rast et Daniel Rebetez, tous deux géologues et membres de la section Moléson sur le thème Géologie des Gastlosen Nos deux géologues aborderont lors de cette conférence la formation des Alpes, et plus particulièrement des Gastlosen, si chères au cœur des Fribourgeois. En leur qualité de géologues et de montagnards avertis, Annick et Daniel sauront très certai- nement vous captiver. Alors, inscrivez tout de suite cette date dans vos agendas ! Sommaire Reflets de la section 3 Groupement jeunesse 13 Infos cabanes 5 Les courses du mois 17 Gardiennages du mois 9 Récits de course 27 R. Pittet & Fils Vins et spiritueux Qualité - Prix Service - Accueil 1663 Epagny/Gruyères Site: www.pittetvins.ch Tél. -
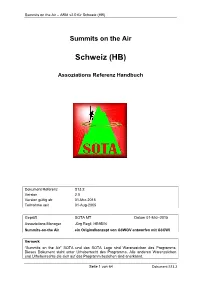
Summits on the Air – ARM V2.0 Für Schweiz (HB)
Summits on the Air – ARM v2.0 für Schweiz (HB) Summits on the Air Schweiz (HB) Assoziations Referenz Handbuch Dokument Referenz S13.2 Version 2.0 Version gültig ab 01-Mrz-2015 Teilnahme seit 01-Aug-2005 Geprüft SOTA MT Datum 01-Mrz–2015 Assoziations Manager Jürg Regli, HB9BIN Summits-on-the Air ein Originalkonzept von G3WGV entworfen mit G3CWI Vermerk “Summits on the Air” SOTA und das SOTA Logo sind Warenzeichen des Programms. Dieses Dokument steht unter Urheberrecht des Programms. Alle anderen Warenzeichen und Urheberrechte die sich auf das Programm beziehen sind anerkannt. Seite 1 von 64 Dokument S13.2 Summits on the Air – ARM v2.0 für Schweiz (HB) Inhaltsverzeichnis 1 ÄNDERUNGSPROTOKOLL..................................................................................................................... 4 ASSOZIATIONS REFERENZ DATEN ........................................................................................................... 11 1.1 REGIONSEINTEILUNG ........................................................................................................................... 12 1.2 GENERELLE INFORMATIONEN .............................................................................................................. 12 1.3 KARTENMATERIAL ............................................................................................................................... 12 1.4 HAFTUNGSAUSSCHLUSS ....................................................................................................................... 13 1.5 LETZTE WORTE................................................................................................................................... -

Fribourg Region the Leisure Activities and Discoveries Guide Welcoming Delicious Unexpected 2018
FRIBOURG REGION THE LEISURE ACTIVITIES AND DISCOVERIES GUIDE WELCOMING DELICIOUS UNEXPECTED 2018 FULFILMENT WALKING MAKES YOU SMILE ! IT HAS BEEN SCIENTIFICALLY PROVEN ADRENALINE MOUNTAIN BIKING, A STATE OF MIND! SLOW FOOD IN SEARCH OF AUTHENTIC FLAVOUR www.fribourgregion.ch 2 FRIBOURG REGION CONTENTS THE STREET WITH A CLICK, YOUR WHERE FRIBOURG ADVENTURE BEGINS! REINVENTS ITSELF PAGE 20 PAGE 16 An original blend : Walking makes cyclist and wine grower 4 you smile! 22 A keen sportsman at the Domaine Scenery as important as the du Vieux Moulin effort involved In search of Three little turns authentic flavour 8 and then take flight 24 The traditional delights of the Four de Your mind and body have never l'Adde bakery in Cerniat felt so light Mountain biking, The secret blast of a state of mind ! 10 the Alpine horn 26 Pedal your way to nature Samuel Descloux reveals the mysteries of the Alpine horn Mustards of the abbey 13 Island charm at the lakeside 28 A place of peace and innovation Drop anchor at Estavayer-le-Lac, The street where as though at sea Fribourg reinvents itself 16 A roof made entirely The trendy district for designers of wood 32 and foodies Léon Doutaz keeps a traditional craft alive What is Dzin? 20 Online 35 A truly unique experience FRIBOURG REGION 3 IN SEARCH OF AUTHENTIC ISLAND CHARM FLAVOUR AT THE LAKESIDE PAGE 8 PAGE 28 EDITORIAL Publisher THE LOCALS FRIBOURG REGION OF FRIBOURG INVITE Layout YOU TO JOIN THEM So Graphic Studio, Bulle Editorial Mélanie Rouiller, Susi Schildknecht The region of Fribourg is teaming with experiences to enjoy in good company. -
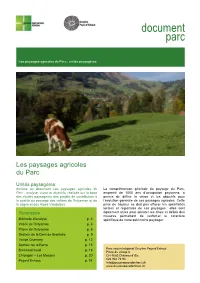
Document Parc
document parc Les paysages agricoles du Parc : unités paysagères Les paysages agricoles du Parc Unités paysagères Annexe au document Les paysages agricoles du La compréhension générale du paysage du Parc, Parc : analyse, vision et objectifs, réalisée sur la base empreint de 1000 ans d’occupation paysanne, a des études paysagères des projets de contribution à permis de définir la vision et les objectifs pour la qualité du paysage des vallées de l’Intyamon et de l’évolution générale de ses paysages agricoles. Cette la Jogne et des Alpes Vaudoises. prise de hauteur ne doit pas effacer les spécificités locales et régionales de ces paysages : elles sont Sommaire également utiles pour orienter les choix et définir des mesures permettant de renforcer le caractère Méthode d’analyse p. 2 spécifique de notre patrimoine paysager. Vallée de l’Intyamon p. 3 Plaine de l’Intyamon p. 6 Secteur de la Dent de Brenlaire p. 9 Val de Charmey p. 12 Secteur de la Berra p. 15 Breccaschlund p. 18 Parc naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut Place du village 6 L’Hongrin – Les Mosses p. 20 CH-1660 Château-d’Œx Pays-d’Enhaut p. 24 026 924 76 93 [email protected] www.gruyerepaysdenhaut.ch document Les paysages agricoles du Parc 2 parc Unités paysagères Méthode d’analyse La méthode préconisée par l’Office fédéral de l’environnement pour évaluer les qualités naturelles et paysagères d’une commune lors de la création d’un parc naturel a servi de base pour l’analyse des unités paysagères. Elle a permis une évaluation standardisée des différentes unités paysagères, basée sur la présence de divers éléments paysagers tels que la géomorphologie, la géologie, les différents milieux naturels, les éléments historico-culturels ainsi que les diverses atteintes. -

Fribourg Region the Leisure Activities and Discoveries Guide Welcoming Delicious Unexpected
FRIBOURG REGION THE LEISURE ACTIVITIES AND DISCOVERIES GUIDE WELCOMING DELICIOUS UNEXPECTED Fine food FINGERS IN THE CHOCOLATE GÉRALDINE MARAS, THE BEST WOMAN CHOCOLATE-MAKER IN THE WORLD Experience PASSIONATE ABOUT GOATS Sensory THE WHOLE WORLD IN A GARDEN www.fribourgregion.ch 2 FRIBOURG REGION CONTENTS “IF I WAS A WINE, I WOULD BE A FREIBURGER” PAGE 15 Cherry jam and Aperitif and Gruyère d’Alpage 4 sculpture 20 In the cool of the Marc Bucher’s family Murith’s chalet creative aperitifs Sharing his love The Chalet du Soldat 24 for the mountains 8 A view over the Gastlosen, Raoul Colliard in his Alpine a climbers’ paradise restaurant, La Saletta The tightrope walker Passionate who loves to be free 26 about goats 10 Hugo Minnig defies the Ursula Raemy’s laws of gravity 120 adorable goats The whole world The dawn in a garden 28 fisherman 12 Go barefoot with Fréderic Perritaz A boat trip with on a sensory journey Claude Delley Online 31 “If I was a wine I would be a Freiburger” 15 Fabrice Simonet, oenologist for the Petit Château family business Fingers in the chocolate 18 Géraldine Maras, the best woman chocolate-maker in the world FRIBOURG REGION 3 THE TIGHTROPE WALKER WHO LOVES TO BE FREE PAGE 26 APERITIF AND 12 La désalpe SCULPTURE en Gruyère PAGE 20 Editorial Publisher PEAKS OF FRIBOURG REGION Layout ADVENTURE AND Agence Symbol, Châtel-St-Denis Editorial A SIESTA BENEATH Mélanie Rouiller, Susi Schildknecht THE TREES Pictures Pascal Gertschen, Mélanie Rouiller, Nicolas Geinoz, Eric Fookes, Aurélie Felli, Free4style, Anthony Demierre, Marc-André Marmillod, In a world where everything keeps getting faster, Claude-Olivier Marti, Elise Heuberger, rediscover the joy of the moment, with your feet Nicolas Repond, Agence Symbol, Switzerland Tourism, Tourist Offices in a stream or your head in the clouds at the top of FRIBOURG REGION, of a mountain. -
Freiburg Gipfelziele
Daniel Anker / Manuel Haas Freiburg Gipfelziele / Gras und Fels, Käse und Wein – Gipfel und Glück Mittelpunkt der Freiburger Alpen ist die Region Gruyère. Hier ste- hen sich der berühmteste und der höchste Gipfel gegenüber: der Alpinwandern / Gipfelziele Moléson und der Vanil Noir (2389 m). Hier lockt auch das Freiburger Matterhorn mit atemberaubenden und blumenreichen Routen. Grasig-felsig sind überhaupt viele der Zinnen. Aber es warten auch Freiburg locker erreichbare Ziele auf Gipfelstürmer, wie La Berra und der Alpinwandern Käsenberg am Röstigraben. Dieser Führer stellt mit präzisen Routen- beschreibungen und chüschtigen Texten alle wanderbaren Gipfel des Kantons Freiburg vor – bis zum Mont Vully mit seinen Rebber- gen. Anders gesagt: Die 49 Gipfelziel-Touren bedeuten auch Käse und Wein. Wenn das nicht zusammengehört! Le Moléson bis Kaiseregg Vanil Noir bis Mont Vully Alpinwandern / Gipfelziele UMSCHLAGBILD: BLICK VOM NORDGRAT DES VANIL NOIR AUF DIE DENT DE FOLLIÉRAN, DEN CERVIN DES ALPES FRIBOURGEOISES 0_Titelbogen_UG.indd Alle Seiten 11.07.14 15:31 Daniel Anker / Manuel Haas Freiburg Le Moléson bis Kaiseregg Vanil Noir bis Mont Vully Alpinwandern / Gipfelziele SAC Verlag 0_Titelbogen.indd 3 11.07.14 14:23 Die Angaben in diesem Buch wurden mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen der Autoren zusammengestellt. Eine Gewähr für deren Rich- tigkeit wird jedoch nicht gegeben. Die Begehung der vorgestellten Routen erfolgt auf eigene Gefahr. Fehlermeldungen, Ergänzungen oder Änderungswünsche sind zu richten an: SAC-Geschäftsstelle, Alpinwandern / Gipfelziele – Freiburg, Postfach, 3000 Bern 23. Für Ralph Schnegg (1956 – 2011) und Christophe Martinez (1981– 2012). Sie liebten die Alpes fribourgeoises und stürzten an höheren Gipfeln zu Tode. -

Freiburg Le Moleson Bis Kaiseregg Vanil Noir Bis Mont Vully
Schweizer Alpen-Club SAC Club Alpin Suisse Club Alpino Svizzero Club Alpin Svizzer Daniel Anker/Manuel Haas Freiburg Le Moleson bis Kaiseregg Vanil Noir bis Mont Vully Alpinwandern / Gipfelziele SAC Verlag Inhaltsverzeichnis Zum Geleit — ® Vorwort der Autoren 10 Obersichtskarte des Kantons Freiburg 12 Zum Gebrauch des Führers 14 Sicherer unterwegs im Sommer 18 Informationen Sommer 24 Die Wanderskala des SAC 26 SAC-Schwierigkeitsskalen 28 Gipfel nach Schwierigkeiten 30 Literatur 34 Erste Hilfe 36 Umweltfreundlich unterwegs 38 Geologie 42 Le Moleson 52 1.1 Le Moleson 56 1.2 Teysachaux - Le Moleson 60 1.3 Niremont - Les Alpettes 64 1.4 Les Deux Dents - La Vudalla 68 1.5 Dent de Lvs 72 1.6 Vanil Blanc - Grand Sex - Dent de Lys 76 1.7 Folliu Borna - Vanil des Artses - Cape au Moine - Corb£ 80 1.8 Dent de Hautadon - Grande Chaux de Naye 86 1.9 DentdeCorjon 90 Höhlenforscher auf dem Gipfel 94 Vanil Noir 96 2.1 DentdeBroc — 100 2.2 Dent de Broc - Dent du Chamois - Dent du Bourgo 104 2.3 Les Merlas-Le Van-Tsermon - Le Curtillet 108 Inhaltsverzeichnis 2.4 Vanil Noir 112 2.5 Vanil Noir-Vanil de l'Ecri - Pointe de Paray 116 2.6 Les Millets 122 2.7 L'Aiguille-Chaux de Culand - Pointe du Chevrier 126 2.8 Pointe de Cray - Pra de Cray - Vanil Carrö - Gros Perr6 130 2.9 Dent de Brenleire - Dent de Folli6ran 136 2.10 Dent de Brenleire - Vanil Noir - Tour de Dorena - Dent des Bimis 142 2.11 Gros Haut Cret Sud - Vanil de la Monse 146 Zur Höhenmessung der Freiburger Gipfel 150 Gastlosen 156 3.1 Hochmatt - Cheval Blanc 160 3.2 Oberrügg - Brendelspitz - Brendel